
Theologische Biographien
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dust in the windBewegte Zeiten in Bochum, Berlin und MarburgAndreas Mertin Für Reinhard und Kirsten – Am AnfangWann entscheidet man sich, Theologe zu werden? Wann habe ich mich entschieden, Theologe zu werden? I close my eyes ... all my dreams pass before my eyes, a curiosity ... All they are is dust in the wind heißt es 1978 im Lied der US-amerikanischen Rockband Kansas. Am Anfang, so meine ich mich zu erinnern, wollte ich eigentlich gar nicht Theologe, sondern einfach nur Pfarrer werden und das Theologie-Studium war das notwendige Mittel dazu. Das war in der Boomer-Generation, zu der ich gehöre, gar nicht so selten. In dem Semester, in dem ich zu studieren begann, waren an der theologischen Fakultät Bochum über 100 Studienanfänger*innen der sog. Volltheologie. Heute würde das für mehrere Jahrgänge reichen. Mein Wunsch, Pfarrer zu werden, hatte rückblickend betrachtet vermutlich nicht zuletzt familiäre Gründe. Meine Eltern waren beide Sozialarbeiter des Diakonischen Werkes der evangelischen Kirche von Westfalen, ein Großvater Leiter einer evangelischen Schule in der Diaspora des Münsterlandes, die anderen Großeltern kamen aus der Gemeinde Barmen-Gemarke. Man wuchs so in engem Kontakt mit der Kirche und ihren Vertretern auf. Früh war ich engagiert in der kirchlichen Kindergottesdienst- und Jugendarbeit. Ich vermute, eine Vielzahl theologischer Werdegänge entwickeln sich so aus dem biographischen Umfeld der Jugendzeit. Es plausibilisiert sich nach und nach. In der Schulzeit hatten wir in der Sekundarstufe I zeitweise einen ziemlich eindrücklichen Religionslehrer, der gerade aus der Entwicklungshilfearbeit gekommen war und deshalb Religion ganz anders vermitteln konnte als seine Kollegen, die uns nur religiöses Wissen vermittelten. In der Oberstufe bis zum Abitur bekamen wir dann einen schon älteren Religionslehrer, der zwar für das Unterrichten junger Menschen nicht wirklich gut geeignet war, aber, weil er an der Universität über Exodus 3, 14 zu promovieren begonnen hatte[3], uns Religion bzw. Theologie auf einem Niveau vermittelte, dass man die ersten Semester an der Universität gleich hätte überspringen können. Über die gesamte Bultmannschule und zentrale theologische Fragestellungen war ich informiert, bevor ich die Universität zum ersten Mal betrat. Kurz vor dem Abitur war ich dann in zwei aufeinander folgenden Jahren mit dem Dienst an den Schulen der Ev. Kirche von Westfalen auf einer Freizeit im schweizerischen Seengen im Kanton Aargau.[4] Das war deshalb etwas Besonderes, weil man durch die Dozenten Heinrich Halverscheidt und Dietrich Redecker ein Gefühl dafür vermittelt bekam, warum es sich lohnt, zentrale Fragen der menschlichen Existenz auch in jungen Jahren intensiv unter religiöser Perspektive zu erörtern. Auf dieser Freizeit hörte ich zum ersten Mal nicht nur Stairway to heaven von Led Zeppelin, sondern auch etwas von Kierkegaards „Tagebuch eines Verführers“[5] und damit von der Gegenüberstellung von Ethik und Ästhetik und ihren damit gegebenen Herausforderungen, sowie von Max Horkheimers SPIEGEL-Gespräch über „Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen“, ein Gespräch, das kurz zuvor im Furche-Verlag als Buch erschienen war.[6] Das hat mir zum ersten Mal die kritische Theorie, die mich später mit ihren nicht zuletzt ästhetischen Fragen so intensiv beschäftigen sollte, nahegebracht.[7] Man wurde mit anderen Worten nicht Theologe, weil man besonders fromm war und / oder die Welt bekehren wollte, sondern weil die religiöse Reflexion der Welt zu den sinnvollen Möglichkeiten der Existenz eines aufgeklärten Individuums gehörte. Man hätte auch Philosophie oder Germanistik studieren können, aber das Studium der Theologie war so etwas wie ein Generalstudium, bei dem der Fokus eben nicht nur auf ein einzelnes Element, sondern auf das Ganze gelegt war. Von der Schönheit (der Welt / der Theologie)
Nach dem Abitur, genauer während der Semesterferien des Grundstudiums bin ich dann mit einem Freund in mehreren aufeinander folgenden Touren über viele Monate durch Süd-, Nord- und Westeuropa gefahren – bis der VW-Bus im schönen Val de Loire seinen Geist aufgab. Diese Reisen waren zunächst einmal ein grundlegendes Studieren der Welt außerhalb des vertrauten engeren Kosmos‘ des östlichen Ruhrgebiets, aber es war langfristig theologisch unendlich bedeutsamer, als es mir damals bewusst war. Das Fundament jener Form von Kulturtheologie, die mich bis heute antreibt, wurde auf diesen Reisen gelegt: Die sorgfältige Wahrnehmung und Analyse der Vielfalt und Geschichtlichkeit regionaler kultureller wie religiöser Ausdrucksformen seit den frühesten vorgeschichtlichen Zeiten. Warum wir diese Reise überhaupt so stark kulturell angelegt haben und nicht einfach nur touristisch oder spaßorientiert, können wir beide heute im Rückblick nicht mehr sagen. Vielleicht wollten wir einfach nur „das Wichtigste“ in Europa sehen.
Die sich anschließende Tour nach Skandinavien war in ganz anderer Hinsicht interessant. Wir trafen bei der Ausfahrt aus Oslo zwei Studentinnen, die ihre früheren über ganz Norwegen verstreut lebenden Klassenkameraden besuchen wollten und nahmen sie mit und lernten so ganz ungezwungen norwegische Kultur und das vitale Alltagsleben kennen. Besser hätte es nicht sein können. Tief im WestenAn der Ruhr-Universität Bochum zu studieren war naheliegend, es war die nächste Universität zu meiner Heimatstadt Hagen, auch wenn mit Münster, Bonn und den kirchlichen Hochschulen Bethel und Wuppertal veritable Alternativen zur Verfügung standen. Aber mein Bruder studierte schon Theologie in Bochum und so bot es sich an, zusammen zur Uni zu fahren. Es waren damals gesellschaftspolitisch überaus stürmische und kontroverse Zeiten, das Land befand sich im so genannten Deutschen Herbst, jeden Morgen starrten einen, wenn man die Ortsgrenze von Witten Richtung Bochum-Querenburg verließ, die Läufe von Maschinengewehren junger Polizisten an.
Es war damals und ist es vermutlich heute noch schwer, einem Außenstehenden zu erklären, warum man ausgerechnet an der Ruhr-Uni in Bochum-Querenburg studierte. Das Ensemble aus 13 Hochhäusern mit jeweils neun Stockwerken im modernen Stil des Brutalismus galt wegen seiner scheinbaren Unwirtlichkeit nach einer freilich unzutreffenden urban legend als jener deutsche Studienort mit der höchsten Selbstmordrate. Wenn man Bochum mit Tübingen, Heidelberg oder Marburg vergleicht, dann fehlt natürlich etwas von der alten Studierendenherrlichkeit – vor allem in den Abendstunden. Mein Gefühl war damals aber, dass dies durch einen stärkeren inneren Zusammenhalt kompensiert wurde. Obwohl Bochum durchaus auch bekannte und berühmte Professoren der Theologie hatte (u.a. Siegfried Herrmann im Alten Testament, Horst Robert Balz im Neuen Testament, Johannes Wallmann in der Kirchengeschichte, Oswald Bayer in der Systematik, Hans-Eckehard Bahr in der Praktischen Theologie) studierte man dort nicht wegen des Renommees der Fakultät (da hätten sich mit Bonn oder Münster auch andere Universitäten angeboten), sondern weil man im Ruhrgebiet bequem zuhause wohnen bleiben konnte und einfach jeden Tag zur Universität pendelte. Architektonisch war die Universität so konzipiert, dass man zwischen den Vorlesungen jeden Punkt der Uni in 15 Minuten erreichen konnte, so dass man als Studierender in den geisteswissenschaftlichen Fächern durchaus auch vom Lehrangebot der naturwissenschaftlichen, technischen oder medizinischen Fächer profitieren konnte. Genutzt wurde das aber selten. Was habe ich im Theologiestudium in Bochum gelernt? Rückblickend fällt mir auf, wie wenig ich bei den etablierten C4-Professoren studiert habe. Zumindest sind mir ihre Vorlesungen und Seminare nicht wirklich in der Erinnerung geblieben. Häufiger war ich in Seminaren der Privatdozenten, Assistenten, der apl. Professoren oder Lehrbeauftragten. Das lag nicht zuletzt daran, dass die Seminare der Professoren mit weit über 100 Teilnehmer*innen derart überlaufen waren, dass ein sinnvolles Studieren im Sinne des kontroversen Austausches von Ansichten gar nicht möglich war. Das war bei den Seminaren, die ich dann besucht habe, anders. Ich erinnere mich an ein Seminar von Michael Trowitzsch, damals Assistent am kirchengeschichtlichen Seminar (später Professor für Systematische Theologie in Münster und Jena), in dem wir im kleinen Kreis Woche für Woche über Theologie und zeitgeschichtliche Fragen diskutierten. Das konkrete Thema des Seminars ist mir nicht erinnerlich, aber es waren intensive und kontroverse Diskussionen. Eines Tages berichtete er uns, dass er die Ehre habe, den Lehrstuhlinhaber während einer Vorlesungsstunde zu vertreten (was damals für noch nicht Habilitierte wirklich etwas Besonderes war) und lud uns ein, an dieser Vorlesungsstunde teilzunehmen. Und diese Stunde werde ich nicht vergessen, weil er eine kirchengeschichtliche Vorlesung mit einer verdichteten Beschreibung der Eröffnungssequenz des gerade gestarteten Films „Apocalypse now“ von Francis Ford Coppola begann. Er sagte nicht: ich erzähle Ihnen mal von meinem letzten Kinobesuch, sondern er stieg gleich ein in die detaillierte und die Atmosphäre präzise einfangende Beschreibung der ersten Bilder, Töne und Geräusche, also des Intros des Films.[11] Den Zuhörenden wurde schnell klar: es ging nicht einfach nur um cineastische Impressionen, sondern um Erkenntnis. Genauer um theologische Erkenntnis: Die Geschichte, die in unserem Kopf spielt, die von Erinnerungsfetzen, von ikonischen Bildern, von Geräuschen, ja Gerüchen, jedenfalls von Sinnesdaten bestimmt ist, muss zu einer Erzählung verdichtet werden. So etwas vergisst man als Student nicht. Theologie muss sich eindrücklich machen, es ist nichts – sei es als Kirchengeschichte oder sei es als systematische Theologie – was sich fern der Lebenswelt abspielt. Auch im Kino begegnen einem die zentralen theologischen Fragen. Man muss sie nur wahrnehmen. Ich schrieb ja schon, dass wir in bewegten politischen Zeiten lebten, die gerade auch uns Theologie-Studierende umtrieben. Da war es wichtig im Kopf Klarheit darüber zu bekommen, wie sich das Verhältnis von Kirche und Staat, Theologie und Politik theologisch denken lässt. Gelegenheit dazu bot ein Seminar von Edgar Thaidigsmann, Assistent in der systematischen Theologie (später Professor in Weingarten). Er las mit uns Karl Barths „Christengemeinde und Bürgergemeinde“[12]. Das war ein Text, den Barth frei als Vortrag gehalten hatte und später dann publizierte. Wo verortet sich die Christengemeinde im Verhältnis zur Bürgergemeinde? Das waren nicht Fragen der Vergangenheit, sondern Fragen, die uns als Studierende akut umtrieben. Und hier brachte Barth das Bild der konzentrischen Kreise ins Spiel, nach dem die Christengemeinde idealerweise den Kern der Bürgergemeinde darstellt. Das war hilfreich bei den eigenen politischen Aktivitäten, die man nun auch theologisch zu reflektieren lernte. Einige Jahre später wurde mir Edgar Thaidigsmanns Aufsatz „Gottes schöpferisches Sehen“[13], eine Auseinandersetzung mit Luthers Magnifikat-Auslegung wichtig, weil sie mir half, meine Ästhetik theologisch zu präzisieren. Vor allem aber war es Jürgen Ebach, damals noch apl. Professor (später Professor in Paderborn und Bochum), der uns Studierende mit Form und Inhalt der Lehrveranstaltungen fesselte. Wir waren ja die Generation nach den 68ern, jenen ewig jung bleibenden Besserwisser*innen, die nach sich keine Generation anerkennen wollten und uns als neue narzisstische Generation abwerteten.[14] Jürgen Ebach dagegen konnte uns zeigen, dass jede Generation ihre Fragen und Antworten hatte. Während die vorangegangene sich an Hosea und Amos und den sozialkritischen Propheten abarbeitete, war es nun die Krise der Weisheit, die in den Fokus des Interesses trat. Nicht mehr die selbstgewissen Antworten, sondern der Zweifel und die Ambivalenz, ja Ambiguität war das, was einem zum Verstehen der Welt verhalf. Ich hörte bei Ebach u.a. die Anthropologie des Alten Testaments, in der nicht einfach nur etwas vorgetragen wurde, sondern in die der Dozent auch vorderasiatische Gewürze zum Riechen und Schmecken mitbrachte. Wir hörten Folklieder wie Pete Seegers „Turn, turn, turn“ und lernten so, dass einerseits die Welt des Vorderen Orients etwas notwendig fremd Bleibendes war und andererseits viel mit unserer Lebenswelt zu tun hat. Jürgen Ebach machte uns mit Arno Schmidt bekannt und zugleich mit der Notwendigkeit, Literatur, Musik, Kunst mit dem Studium der biblischen Schriften zu verbinden.[15]
Am eindrücklichsten war Jürgen Ebachs in einer Vorlesung entfaltete Auseinandersetzung mit dem Buch Hiob und hier vor allem mit den Gottesreden und dem Schluss des Buches. Ich blättere gerade noch einmal durch das nun fast 40 Jahre alte Buch „Leviathan und Behemoth. Eine biblische Erinnerung wider die Kolonisierung der Lebenswelt durch das Prinzip der Zweckrationalität“[17] und bin überrascht von der fortdauernden Aktualität dieser Texte. Ich erlaube mir, auch wenn die Textgattung, in der ich hier schreibe, die des „personal essay“ ist, wie Wolfgang Vögele in seinem Beitrag zu diesem Heft hervorhebt, an dieser Stelle einen Abschnitt aus Ebachs Buch zu zitieren:
Für solche Sätze bin ich Jürgen Ebach unendlich dankbar – gerade auch in der aktuellen Debatte. Theologie treiben war, wenn man sich konsequent auf theologische Texte bezog, auch politisch nicht folgenlos. Nach einer heftigen Auseinandersetzung im Fakultätsrat wurden eine Studierendenvertreterin und ich von einem der Professoren beim Verfassungsschutz mit dem Satz denunziert, wir würden die Zuspitzung der politischen Auseinandersetzungen „mit klammheimlicher Freude“ begleiten. Das war, auch wenn die Zeiten des Göttinger Mescalero bereits vorbei waren und der Deutsche Herbst Vergangenheit, keine ungefährliche Mitteilung – zumal sie in der Sache völlig substanzlos war. Wir hatten als Vertreter der Studierenden im Fakultätsrat für die Berufung eines bestimmten Professors plädiert, die Mehrheit der Fakultät war dagegen, die Rhetorik eskalierte. Aber das war es dann auch. Für mich aber war es ein Anlass, nach einem anderen Studienort zu suchen und der ideale Studienort schien das in mehrfacher Hinsicht multikulturelle Berlin. Ideal: BerlinIn Berlin habe ich aber dann doch nur sehr kurz gelebt und dabei nicht einmal richtig studiert – zumindest nicht an der Universität. Eigentlich habe ich die Kirchliche Hochschule ausschließlich zur Immatrikulation und zur Exmatrikulation betreten, sonst war ich nicht dort. Das lag nicht an der Hochschule und ihrem Angebot, sondern an der Zeit. Es waren auch in Berlin bewegte Zeiten, es gab zunächst den großen bis heute folgenreichen zweiten Berliner S-Bahn-Streik, es gab vor allem die Hausbesetzerszene und infolge dessen im Dezember 1980 Straßenkämpfe im Zentrum von Berlin. An ein geruhsames Studieren war nicht zu denken. Aber es gab nicht nur Politik, sondern es gab auch Buchhandlungen, Buchhandlungen, Buchhandlungen und natürlich Galerien sowie Museen, mit anderen Worten: es gab Kultur. Ich wohnte im Wohnheim der TU in der Hardenbergstraße, also im Zentrum Westberlins und allein die vom Programm her sehr unterschiedlichen Buchhandlungen (und Antiquariate) im Umkreis von 500 Metern hätten gereicht, einen über die ganze Zeit in Beschlag zu nehmen.
Aber das war eben nicht die einzige Buchhandlung. In der Carmerstraße gab es die Autorenbuchhandlung. Diese war wenige Jahre zuvor, genauer 1976 eröffnet worden:
Das wäre heute so gar nicht mehr denkbar. Jedenfalls stöberte ich dort des Öfteren und eines Tages wurde ich dann von der Buchhändlerin auf ein ausgestelltes Exemplar von Arno Schmidts „Zettels Traum“ hingewiesen, in dem ich blättern durfte.[22] Das war jener Arno Schmidt, von dem Jürgen Ebach in seinen Vorlesungen erzählt hatte und dessen Erzählwelten ich mir zwischenzeitlich angeeignet hatte.[23] Ein wenig weiter in der Kneesebeckstraße gleich zwei Buchhandlungen: die des Verlages „Das europäische Buch“ mit orthodox-marxistischer Literatur und vor allem die „Marga Schoeller Bücherstube“. Und im gleichen Viertel gab es zahlreiche Antiquariate, u.a. eines mit einer Erstausgabe der Schriften von Novalis von 1802, die ich mir damals leider nicht leisten konnte.
Für zeitgenössische Kunst interessierte ich mich damals noch nicht. Ich besuchte durchaus Ausstellungen mit aktueller Kunst, verstand aber ehrlich gesagt wenig davon. Ich erinnere mich an einen Besuch in der Nationalgalerie, die Werke von Arnulf Rainer zeigte. Nun waren das nicht die Bilder, die die Gemeinden heute so schätzen, also die fast schon zu schönen Kreuzübermalungen, sondern es waren jene Werke, die nahezu schwarz übermalt waren. Das verstörte mich damals sehr. Auch die gerade im Jahr zuvor entstandenen Bilder einer Parallelmalaktion mit Schimpansen machten die Sache nicht besser. Aber es forderte eben heraus, sich mit diesen kulturellen Gegebenheiten auseinanderzusetzen. Und Provokationen habe ich immer geschätzt. Ansonsten eroberten wir uns all die Museen in Dahlem, insbesondere natürlich die Gemäldegalerie, die heute freilich viel besser im Kulturforum am Mattäikirchplatz präsentiert wird. Aber wir taten dies als Kulturbürger und noch nicht als Kunstinteressierte. Das änderte sich erst mit dem Umzug nach Marburg. Marburg
Mein Bruder war nicht mit nach Berlin gezogen, sondern war gleich nach Marburg gewechselt und wir folgten ihm dorthin. Marburg wurde dann für vierzehn Jahre der Mittelpunkt meines Lebens. Zum ersten Mal war ich wirklich in einer Studierendenstadt mit ihren diversen Kulturen. Die Philipps-Universität selbst „wurde 1527 von Landgraf Philipp dem Großmütigen als protestantische Hochschule gegründet und ist damit die älteste hessische Hochschule und die älteste noch bestehende Universität, die auf eine protestantische Gründung zurückgeht“ (Wikipedia). Sie konnte sich historisch und auch zur damaligen Zeit einer Fülle berühmter theologischer Forscher (aber damals noch keiner Forscherinnen) rühmen. Als ich nach Marburg kam und dort studierte, lehrten unter anderem Otto Kaiser und Erhard S. Gerstenberger Altes Testament, Wolfgang Harnisch und Dieter Lührmann Neues Testament, Wolfgang A. Bienert Kirchengeschichte, Stephan Pfürtner, Wolfgang Huber, Hans-Martin Barth Systematische Theologie und Dietrich Stollberg und Gerhard Marcel Martin Praktische Theologie. Anfang der 80er Jahre zeichnete sich eine ästhetische Kehre nicht nur in der Philosophie (Kolloquium Kunst und Philosophie 1981[25]), sondern nach und nach auch in der Praktischen Theologie ab. Wer etwas vom Geist der Zeiten verstand, der wusste, dass alle Fragen der Theologie künftig auch ästhetisch reflektiert werden mussten. Schon zehn Jahre vorher hatte Dorothee Sölle über das Verhältnis von Theologie und Dichtung habilitiert.[26] Es war nur eine Frage der Zeit, bis dies auch allgemein theologisch relevant wurde. Schon an der Ruhr-Universität hatte ich Ende der 70er-Jahre Horst Schwebel kennengelernt, der dort auf Vermittlung von Hans-Eckehard Bahr einen Lehrauftrag hatte und danach Professor für Praktische Theologie in Marburg und Leiter des dortigen Instituts für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart geworden war. Als ich dann in Marburg zu studieren begann, belegte ich einige Seminare bei ihm. Das erste Seminar hatte das Thema „Christlicher Glaube und Gegenwartsliteratur“. Ich schrieb eine Seminararbeit über „Die Verarbeitung biblischer Motive in Alfred Döblins ‚Berlin Alexanderplatz‘ am Beispiel des Hiobkapitels.“ Dass ich mich ausgerechnet für diesen Aspekt gemeldet hatte, war sicher eine Folge des Studiums bei Jürgen Ebach.
Im Sommersemester 1983 veranstalteten Horst Schwebel und Hans Martin Barth ein kirchengeschichtlich-praktisch-theologisches Hauptseminar zum Thema „Bild – Bilderverbot – Bildersturm. Ein Kapitel ökumenischer Theologie“ und ich übernahm ein Referat über den byzantinischen Bilderstreit – ein scheinbar exotisches Thema. Ich las dazu Horst Bredekamps einige Jahre zuvor erschienene Dissertation „Kunst als Medium sozialer Konflikte“. Bredekamp schrieb darin:
Das fand ich einen überaus aufregenden Gedanken. Wie war er im Blick auf die aktuelle Praxis der Kirchen weiterzudenken? Wenn Ikonoklasmus nicht eo ipso als verwerflich anzusehen ist (wie die gegenreformatorische Propaganda behauptete), ja wenn er durchaus auch als erkenntnisproduktiv angesehen werden kann, wie wäre er dann im Blick auf die Gegenwart der Kirche theologisch zu deuten? Diese Frage sollte mich die nächsten fünf Jahre beschäftigen.[30] Denn im Anschluss an das Seminar fragte mich Horst Schwebel, ob ich nicht Interesse hätte, auf einer freigewordenen Stelle am Institut zu arbeiten. Sein Vorschlag: Ich sollte über die Bildausstattung von Kinderbibeln forschen. Das war aber nicht mein Thema, Kinderbibeln waren das letzte, was mich interessierte! Im Gegenzug schlug ich ihm vor, lieber über den Umgang mit zeitgenössischer Kunst in Kirchengemeinden zu forschen. Das erschien mir in der Logik des Seminars zu sein, an dem ich gerade bei ihm teilgenommen hatte. Das fand auch Horst Schwebel sinnvoll und so begann eine bis heute, also bald 40 Jahre währende Zusammenarbeit und Freundschaft. Die Kultur am Marburger Institut Etwas, was das Institut auszeichnete, war der Gestaltungsraum, der einem gewährt wurde. Man brauchte nur Vorschläge zu machen und stieß auf Interesse und Unterstützung. Das lag vor allem an der ausgesprochenen Liberalität von Horst Schwebel, der wenig steuerte, aber viel förderte. Ich will dafür ein Beispiel nennen. Ich hatte damals im Rahmen meiner Studien zur Bedeutung des Ikonoklasmus für die christliche Kirche in einem Sammelband zur Kunstsoziologie einen Text von Christian Rittelmeyer über „Dogmatismus, Intoleranz und die Beurteilung moderner Kunstwerke“ gelesen, der dazu vor 1969 in Marburg geforscht hatte.[31] Und ich stellte mir die Frage, wie die Ergebnisse der Untersuchung wohl ausgesehen hätten, wenn man nicht Psychologiestudierende, sondern Theologiestudierende befragt hätte. Könnte man in einer Studie die unterschiedlichen religiösen Bindungen von Erstsemester*innen der Theologie erheben und sie zugleich im Blick auf ihr Verhältnis zur Kultur der Moderne befragen? Und was würde das zeigen? Ich fragte Horst Schwebel, ob er sich vorstellen könnte, eine derartige Studie vom Institut finanzieren zu lassen. Und er stimmte zu, obwohl es ein ziemlich teures und hochriskantes Unternehmen war, denn das Ergebnis könnte ja unter Umständen für die finanzierenden evangelischen Kirchen gar nicht vorteilhaft aussehen. Tatsächlich haben wir die Untersuchung zusammen mit einem Mitarbeiter des psychologischen Instituts erfolgreich durchgeführt und das Ergebnis war sogar hoch signifikant. Publiziert wurde es nie, weil das Kuratorium des Instituts Einspruch erhob, da es nicht anginge, dass wir Forschungen betrieben, die zu Lasten der Ev. Kirche wirken könnten. An Horst Schwebel hat es aber nicht gelegen. Der gute Geist des Instituts war die Sekretärin Ingrid Witzel, immer präsent, immer ansprechbar, immer mit Rat und Tat zur Stelle. Man merkte das, wenn sie einmal im Urlaub war und plötzlich niemand mehr erreichbar war. Das Institut stand plötzlich still und wurde erst wieder lebendig, wenn sie zurückkehrte. Noch Jahre nach meinem Ausscheiden aus dem Institut war sie mir eine treue Hilfe, wenn es darum ging, Informationen zu bekommen oder etwas zu organisieren. Als mein Kontakt zu Horst Schwebel einmal kurzzeitig gestört war, war sie es, die alles wieder auf den guten Weg brachte. Die WG Darüber hinaus gab es einen festen Kreis von Freundinnen und Freunden, die sich dort trafen (vor allem zu ausgefeilten mehrgängigen Menüs) und über tagespolitische, aber auch theologische Fragen diskutierten. Zu diesem Kreis gehörte etwa Bodo Nebling, ehemals Assistent bei dem Pastoraltheologen Dietrich Stollberg, dann Pfarrer im Siegerland. Mit Bodo habe ich viele coole Seminare am Marburger Institut organisiert und durchgeführt und bedaure es noch heute, dass wir seitdem irgendwie den Kontakt verloren haben. Zur Gruppe gehörte seine Frau Annette Tettenborn, heute Professorin in der Schweiz, mit der ich mich noch immer jedes Jahr zusammen mit meinen besten Freund*innen an den Kult(ur)orten dieser Welt treffe. Ebenso gehört dazu meine damalige Mitbewohnerin, die Theologiestudentin Uta Tettenborn, die später den Weg in die Säkularität und die Berliner Szene, sprich zum Restaurant Borchardts wählte. Es gehörten aber auch Vagabunden dazu, die vielleicht ein oder zweimal auftauchten und dann wieder in die anderen Zirkel der Universitätsstadt abtauchten, wie etwa die feministische Theologin Stefanie Schäfer-Bossert. Zu dem Kreis gehörten später auch die Studierenden der Seminare, die Bodo Nebling und ich organisierten, etwa Anne Gidion, die heutige Leiterin des Pastoralkollegs der Nordkirche, oder Karin Wendt, die seit Jahrzehnten meinen Weg in Sachen Theologie und Ästhetik begleitet. Diese WG wurde möglich, weil das Marburger Institut eine Anlaufstelle war, die viele interessante Menschen anzog, nicht gerade den konventionellen Menschentyp, sondern die Dissidenten, die Differenzierten und die Differenzierenden. Forschungen Paul Gräb passte perfekt zum Institut, er pflegte die gleiche Kultur der Cortesia, der Gastfreundschaft. Seine Freundschaften beginnen im zweiten Weltkrieg mit den expressionistischen Künstlern Otto Dix und Erich Heckel und haben mit deren Nachfolger*innen und dann wieder deren Nachfolger*innen kein Ende genommen.[32] Er hat sicher das Glück gehabt, den rechten Moment, den Kairos der kulturellen Entwicklung nutzen zu können (heute und selbst in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts wäre so etwas nicht mehr denkbar), aber man muss diese Gelegenheit eben auch ergreifen. Paul Gräb hatte kein theologisches Programm, er war nur unendlich neugierig darauf, was seine Künstlerfreund*innen schaffen. Fragen nach religiösen Inhalten von Kunstwerken haben ihn nie interessiert. Das war das erste, was ich bei ihm lernte. Kunst ist als Kunst für Theolog*innen wichtig.[33] Wir haben deshalb gemeinsam viele Künstler*innen besucht, uns die neuesten Werke zeigen und erläutern lassen. Und erst wenn man das über Jahre gemacht hat, bekommt man einen Blick dafür, ist nicht nur den Zufällen einer Begegnung oder Idee ausgeliefert. Wie bei einem Zen-Meister ist es aber ein (lebens-)langer Prozess. Nach Paul Gräb schickte mich Horst Schwebel zu Georg Meistermann, ihn sollte ich als Künstler zum Thema Kunst und Kirche interviewen. Ein Fenster von Meistermann hatte ich schon kennengelernt, denn er hatte das Wohnzimmerfenster von Paul Gräb in Bad Säckingen geschaffen. Dem Interview spürt man meine damalige Unbedarftheit noch an.[34] Georg Meistermann war damals ein Grandseigneur der Kunstszene, und hatte gerade die Fenster für die Kirche von St. Gereon in Köln fertiggestellt. Diese Arbeit bezeichnete Meistermann später „als sein religiöses Testament und Krönung seiner Lebensarbeit“. Er war ein rheinischer Katholik durch und durch und das spürte man bei seinen Ausführungen. Sein zentrales Stichwort war die Glaubwürdigkeit – der Kunst wie der Kirche. Parallel zum Kennenlernen der Kunst und der Künstler*innen verlief die theoretische Aneignung dessen, was eigentlich „ästhetische Erfahrung“ bedeutet. Und das hieß: Lesen, lesen, lesen. So wollte sowohl Kants Kritik der Urteilskraft wie auch zum Beispiel der tschechische Strukturalismus von Roman Jacobson rezipiert werden, die phänomenologischen Ansätze von Roman Ingarden ebenso wie die Ästhetik Adornos. Es ist das eine, sich mit konkreten Kunstwerken auseinanderzusetzen, das andere ist es, zu wissen, was man da eigentlich sagt, wenn man über ein Objekt urteilt, es sei Kunst. Die Mehrzahl der Menschen akzeptiert es, wenn ihnen im Museum oder in der Galerie etwas „als Kunst“ vorgesetzt wird. Aber das ist lange noch kein Kunsturteil. Es kann das bloße Einverständnis mit einem kulturgeschichtlichen Urteil sein – etwa bei den betenden Händen von Albrecht Dürer. Oder auch der Verzicht darauf, überhaupt ein eigenes ästhetisches Urteil zu fällen und nur in einem Geschmacksurteil zu verlautbaren, ob es einem gefällt oder nicht. Das war ja unter anderem die Herausforderung, die einem Pierre Bourdieu stellte, wenn er in seinem Buch „Die feinen Unterschiede“ auf die Schichtabhängigkeit von Urteilen über Kunstobjekte hinwies. Wo der Arbeiter ein Bild nach seinen funktionalen Kontexten betrachtete, urteilte der Bildungsbürger nach formalen Kriterien. Das alles wollte begriffen werden. Hilfreich dazu waren Seminare, die Horst Schwebel zur ästhetischen Theoriebildung anbot, und in denen wir abends beim Wein diverse ästhetische Theorien der Moderne durchbuchstabierten.
Ich hätte danach in kirchliche Dienste treten können, entschloss mich aber, nicht Pfarrer zu werden, sondern als freier Theologe weiter im Bereich von Kunst und Kirche tätig zu sein. Die Freiheit, die ich in der Begegnung mit Künstler*innen und ihrer Kunst kennengelernt hatte, schien mir in der Kirche nicht gewährleistet zu sein, zu kulturell begrenzt, um nicht zu sagen provinziell wurde und wird in ihr gedacht und gehandelt.[37] Zumindest für eine gewisse Zeit wollte ich etwas anderes probieren. Ich hatte zwischenzeitlich begonnen, auch auf dem Gebiet der Religionspädagogik zu arbeiten und war seit 1984 Mitglied der hessischen Lehrplankommission für Ev. Religion Sekundarstufe I. Im Zuge der sich durchsetzenden Symboldidaktik sollte ich dort meine Kompetenz in ästhetischen Fragen in die didaktischen Entwürfe einbringen. Das hieß aber auch, sich in ein völlig neues Arbeitsfeld einzuarbeiten. Diese Arbeit zusammen mit dem Marburger religionspädagogischen Institut und ihrem Leiter Bernhard Böttge verlief aber eigentlich parallel zum Studium und der universitären Kultur und bildet die andere Seite meiner theologischen Existenz – die als Medienpädagoge (davon erzähle ich hier nicht, es ist ein anderes Kapitel, ja eine andere Welt). Episode Kirchensturm Seinen Reiz hatte das, weil Kirchen im Mittelalter natürlich immer zentrale Kommunikationsorte waren, aber auch, weil der hessische Staat der Eigentümer dieser Kirche war und er ja auch der Ansprechpartner des studentischen Protestes war. Zur Besetzung ist es dann nicht gekommen, zwar waren die Studierenden mit ihren Schlafsäcken und dem Fernsehen vor Ort, aber einige Kommilitonen hatten sie beim Probst verpfiffen und die Kirchengemeinde hatte die Portale geschlossen. Fürs Fernsehen gab es schöne symbolische Bilder von protestierenden Studierenden vor dem verschlossenen Kirchenportal und Professor Gerstenberger hielt eine Vorlesung über sozialkritische Propheten. Nach einigen Tagen des Protests war der Spuk vorbei. Der Arbeitskreis Theologie und Ästhetik Frank Hiddemann, Assistent bei Hans Eckehard Bahr an der Ruhr-Universität Bochum, lud im Rahmen eines Kolloquiums „Theologie und Ästhetik“ im Juni 1989 Albrecht Grözinger und mich zu Vorträgen über Moderne und Post-Moderne ein und so referierte ich zum „Zum Verhältnis von Theologie und Ästhetik in der Postmoderne“. Im Anschluss an die Vorträge saßen Grözinger, Hiddemann und ich in einem Bochumer Café zusammen und sinnierten darüber, ob es nicht an der Zeit sei, in Analogie zum berühmten Kolloquium „Poetik und Hermeneutik“ einen „Arbeitskreis für Theologie und Ästhetik“ zu gründen, in dem interessierte Fachwissenschaftler*innen auf Einladung evangelischer Akademien über theo-ästhetische Fragen diskutieren könnten. Wir fragten die befreundeten Studienleiter Eveline Valtink (Ev. Akademie Hofgeismar) und Dietrich Neuhaus (Ev. Akademie Arnoldshain), ob sie sich ein derartiges Format vorstellen könnten. Beide sagten zu und so kam es dann 1990 zur ersten Tagung des Arbeitskreises „Theologie und Ästhetik“ in Arnoldshain unter dem von Frank Hiddemann entworfenen Titel „Von der Schwere Gottes und der Leichtigkeit des Seins“.[39] Eröffnet wurde die Tagung vielleicht nicht ganz zufällig von Jürgen Ebach mit einem Vortrag über „Kabod – Über die Schwere Gottes“. Und ebenso wenig zufällig folgte ihm ein Vortrag von Henning Luther über „Subjektwerdung zwischen Schwere und Leichtigkeit – (auch) eine ästhetische Aufgabe?“. Ergänzt wurde das noch von einem Vortrag des (Kunst-) Philosophen Rainer Piepmeier über „Die Schwere des Sinns und die (schwere) Leichtigkeit der Kunst“. Ein illustres Publikum war der Einladung zur Tagung gefolgt, ich erinnere mich zumindest an Herman Timm, Klaas Huizing und Thomas Erne. Alle drei haben dann auf späteren Tagungen vorgetragen.
Rückkehr
Mitte der 90er Jahre bin ich zurückgekehrt nach Hagen, meiner westfälischen Heimatstadt, jener Alptraumstadt, von der die Hagener Gruppe Extrabreit singt, die aber doch so ganz anders ist (wenn man nicht gerade in Hagen-Wehringhausen lebt). Heute kann man es sich kaum vorstellen, aber Hagen war einmal für kurze Zeit so etwas wie eines der künstlerischen Zentren der Welt. Der westdeutsche Impuls aus der Zeit des Kunstförderers Karl Ernst Osthaus ist da und dort in der Stadt bis heute noch spürbar, ich habe darüber in der 111. Ausgabe des Magazins unter dem Titel „Geboren unter Ferdinand Hodler“ geschrieben. Ausstellungspraxis für die Ev. Kirche 1995 hatte ich zusammen mit Paul Gräb auf dem Hamburger Kirchentag eine Ausstellung zeitgenössischer Kunst der Gegenwart organisiert, aber die Hauptarbeit hatte Paul Gräb gemacht und ich war nur Mitarbeiter, Mitdenker und Begleiter.
Aber es ist das eine, eine Ausstellung zeitgenössischer Kunst für Kirchentagsbesucher zu machen, das andere ist es, parallel zur Documenta in einer Kirche Kunst auszustellen. Es ist (und bleibt) natürlich Hybris – so gut können die Kenntnisse des Betriebssystems Kunst gar nicht sein, als dass man mit der Documenta „konkurrieren“ könnte. Meine Überlegung war daher, ob es nicht etwas gäbe, über das die Documenta aus prinzipiellen Gründen nicht verfügen könnte: und das war ein religiöser Raum. Und das konnte nicht bloß eine aufgegebene Kirche oder eine City-Kirche sein (also eine leere religiöse Schale), sondern nur eine Kirche mit einem vitalen religiösen Leben. Deshalb lautete mein Vorschlag an die Evangelische Kirche: ladet Künstler*innen für 100 Tage ohne Vorgaben in eure zentrale (Bischofs-) Kirche ein, lasst sie in den Raum eingreifen und schaut, wie ihr mit ihnen in dieser Zeit zusammenleben könnt. Zeigt euch von eurer besten Seite. Die Künstler*innen, die ich der Kirche vorschlug, kannte ich zur Hälfte über Paul Gräb (Madeleine Dietz, Günter Scharein, Robert Schad, Thomas Lohmann), zu einem gewissen Teil über die Galerie Anita Beckers (Christina Kubisch, Alba D’Urbano), zum Teil über Tipps von Freund*innen (Victoria Bell, Christian Hanussek). Die kuratorische Idee dieser Ausstellung unter dem Titel „Inszenierung und Vergegenwärtigung“ war, liturgische Punkte der Kirche (Tympanon, Altar, Kanzel, Chorraum, Seitenschiff) so zu „besetzen“, dass Gottesdienst zwar weiter möglich war, er aber aus seiner Selbstverständlichkeit gerissen wurde. Die Künstler*innen haben sich freundlicherweise darauf eingelassen. Einige Arbeiten wurden von mir scheinbar beiläufig gezeigt (Hanussek, Bell, Scharein, Lohmann), sie mussten von den Besucher*innen entdeckt und erschlossen werden, andere erwiesen ihre explosive Produktivität, indem sie sich den Gemeindegliedern in den Weg stellten und völlig neue Einsichten eröffneten (Schad, d’Urbano, Kubisch und Dietz). Darin sah ich durchaus eine Verbindung zu all den theoretischen theo-ästhetischen Einsichten, die ich mir seit 1983 im Rahmen meiner Arbeiten am Marburger Institut angeeignet hat: Kunst als performativer Ikonoklasmus, der die geronnenen Bilder der Welt wieder in Fluss bringt. Die Reaktionen auf die Ausstellung sagen viel über die Kontexte theologischer Existenz heute, womit wir zu kämpfen und womit wir zu ringen haben. Vor 20 Jahren hat mein Bruder in diesem Magazin aus gegebenem Anlass dazu unter der Überschrift „Die Angst der Kirche vor der Gegenwart. Eine Interpretation zur Praxis der Begegnung von Kunst und Kirche“ geschrieben. Die Proteste, die schon im Vorfeld der Ausstellung aus der Kirchengemeinde artikuliert wurden, verstörten mich zutiefst. Ich habe den Künstler*innen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, immer vertraut. Das habe ich bei Paul Gräb gelernt. Man musste sie eher motivieren, noch einen Schritt weiter zu gehen, als dass man sie begrenzen müsste. (Ausnahmen bestätigen die Regel.)
Trotzdem oder auch deshalb war die Ausstellung in der Martinskirche Kassel ein Erfolg, nicht zuletzt weil sie gerahmt war von einem intensiven religiösen und kirchenmusikalischen Programm. Der Protestantismus bot seine besten Prediger*innen auf, um Woche für Woche Gottes Wort auszulegen. Und die Kunst sprach für sich und beeindruckte die Besucher*innen. Im Anschluss erwarb die Kirchengemeinde eine Installation von Christina Kubisch, die bis heute in der Kirche unter der Orgelempore zu sehen ist. Die Kirche von Kurhessen fragte mich auch für 2002 an, die Documenta-Begleitausstellung vorzubereiten. Ich zog Karin Wendt, die damalige und heutige Mitherausgeberin des Magazins für Theologie und Ästhetik, als Co-Kuratorin hinzu. Und das war gut so, denn die Herausforderungen, vor die uns die Künstler*innen stellten, waren immens. Der freie Blick – so hieß die Ausstellung – sollte die Freiheit der Kunst von jeglicher kirchlichen Bevormundung zeigen. Der so möglich werdende Einbruch der Kunst in die Kirche wurde zumindest von zwei der beteiligten Künstler*innen wortwörtlich genommen. Alle drei gezeigten Künstler*innen waren mit herausragenden Arbeiten vertreten – die ja auch hier im Magazin vorgestellt wurden. Aber was Thom Barth mit seiner Installation RED LOOM 7. HIMMEL 8. STELLUNG vollbracht hat, ist sicher in der Nachkriegsgeschichte von Kunst und Kirche einzigartig. Ich frage mich heute noch manchmal, wie wir das hingekriegt haben. Aus der Erfahrung der ersten Ausstellung hatte sich so etwas wie eine verschworene Gemeinschaft von Aktiven gebildet, die vom Willen getrieben waren, auch dieses Mal etwas ganz Besonderes auf die Beine zu stellen: dazu gehörte der Oberkirchenrat Klaus Röhring, der Dekan Ernst Wittekindt und natürlich Eveline Valtink, die damalige Leiterin des Evangelischen Forums in Kassel – ohne deren unermüdliches Wirken vieles nicht möglich gewesen wäre. Ich hatte im Kunstforum international Bilder einer Installation von Thom Barth im Kunstraum Wuppertal gesehen, die ich künstlerisch absolut überzeugend fand.[43] Und ich fragte ihn an, ob er das nicht auch im Kirchenraum in der Kasseler Martinskirche realisieren könnte. Aber Thom Barth ist kein Freund der Wiederholung von Kunstprojekten. „Das habe ich doch schon gemacht“, sagte er zu mir. Wir schauten uns also gemeinsam die Kirche an und danach hörte ich drei Monate nichts mehr von ihm. Und dann schickte er mir Fotos davon, wie er sich seine Arbeit in Kassel vorstellt. Er hatte die gesamte Kirche in seinem Atelier maßstabsgerecht nachgebaut und schlug uns nun vor, wir sollten aus vier vor der Kirche jeweils übereinander gestapelten Baucontainern einen Zugang schaffen, der mitten durch ein Kirchenfenster in etwa 8 Meter Höhe in die Kirche hineinführte und im Inneren durch weitere Baucontainer fortgesetzt werden sollte.
Wenn man überhaupt von einer Sekunde auf die andere ein Magengeschwür bekommen kann, dann war das damals bei mir der Fall. Sollte, konnte, durfte man so etwas realisieren - und vor allem wie? War das überhaupt denkbar, war es theologisch vermittelbar? Es war mir sofort klar, dass dies ein Projekt war, das alle Dimensionen sprengte – zugleich aber so viele ästhetische, künstlerische, kulturgeschichtliche und theologische Perspektiven eröffnete, dass man sich ihm kaum entziehen konnte – außer mit Verweis auf die Finanzen. Thom Barths erste Idee war es, in den Containern Asylanten wohnen zu lassen. Das konnte ich ihm gerade noch ausreden, weil das Kirchenasyl für die Evangelische Kirche nichts Neues gewesen wäre. Schließlich kam er auf die Idee einer temporär begehbaren Skulptur. Man sollte einen freien Blick in die Kirche werfen.
Auch Nicola Stäglich hatte in den Kirchenraum eingegriffen, aber in einer ganz anderen Art und Weise, und zwar indem sie das Emporenband mit einer hellen Signalfarbe überzog. Dieser Eingriff war für künstlerisch wie religiöse Augen deshalb so gravierend, weil er den gewohnten Blick in einer gotischen Kirche zur Decke durchbrach und auf halber Höhe fesselte.
Der Kunstkritiker Marcus Lütkemeyer schrieb dazu in der Zeitschrift Kunstforum International:
Was hat das nun mit meiner theologischen Biographie zu tun? Ich sehe die Ausstellung von 2002 als Konvergenzpunkt meiner theologischen Ausbildung mit den verschiedenen Impulsen/Lehren aus Bochum, Berlin und Marburg. Wenn theologische Biographie auch impliziert, dass man nicht nur etwas lernt, sondern es umsetzen und etwas bewirken will, dann wäre das mit diesem Kunstprojekt gegeben. Etwas Ähnliches war wenige Jahre zuvor auch in der Zusammenarbeit mit Madeleine Dietz in der Paderborner Abdinghofkirche gelungen. In einem Briefwechsel mit Reinhard Mawick, Chefredakteur der Zeitschrift Zeitzeichen schrieb ich kürzlich: „Ich versuche seit Jahrzehnten darauf hinzuwirken, dass der Protestantismus auf Augenhöhe mit dem Betriebssystem Kunst kommuniziert, so dass etwa Documenta-Leiter ganz selbstverständlich davon ausgehen können, auch im Protestantismus auf sachverständige Gesprächspartner*innen zu stoßen. So wie Horst Schwebel auf Augenhöhe mit Joseph Beuys sprechen konnte oder der im letzten Jahr verstorbene Pfarrer Paul Gräb mit nahezu allen bedeutenden Künstler*innen der Bundesrepublik Deutschland.“ Bei der Ausstellung 2002 besuchte mit Okwui Enwezor erstmalig ein Leiter der Documenta die Begleitausstellung der Evangelischen Kirche und fünf Jahre später bot Roger M. Buergel, der Leiter der nachfolgenden Documenta sogar an, die Ausstellung der Evangelischen Kirche in das Documenta-Programm zu integrieren. Denn auch 2007 wurde ich von der EKKW gebeten, die Begleitausstellung zur Documenta vorzubereiten. Meine erste Frage war, welche theo-ästhetischen Fragestellungen noch nicht bearbeitet waren, was noch einer künstlerischen und theologischen Klärung harrte. Zwar hatten wir 2002 mit Bjørn Melhus bereits eine Videoarbeit in der Kirche gezeigt, mich interessierte aber noch weitergehender die Frage, wie die multimediale Kunstarbeit dieser Zeit, die im Betriebssystem Kunst nun schon seit langem selbstverständlich war, in der Kirche zu thematisieren sei. Welchen Beitrag konnten Vision und Audition in künstlerischer Durchdringung leisten? Erstmalig bekam ich von der Kirche zwei Kirchenräume zur Verfügung gestellt, so dass ich kuratorisch in ganz anderen Dimensionen arbeiten konnte.
Zwischenbemerkung: Natürlich gab es in meiner Biographie auch gescheiterte Projekte, solche die gar nicht erst zustande kamen (wie das von Künstler*innen gestaltete Haus der Religionen zur Kulturhauptstadt im Ruhrgebiet) und solche, die zustande kamen, aber mir schlicht misslungen sind. Die im Auftrag des Diakonischen Werkes zur Expo 2000 organisierte Ausstellung zu den Werken der Barmherzigkeit war so ein misslungenes Projekt, weil ich mich auf die alte Konzeption einer thematischen Ausstellung einließ und nicht raumbezogen gearbeitet habe. Ein Fehler, der sich nicht wiederholen soll. Aber über Holzwege schreibt man nicht gerne in biographischen Texten. Das Magazin Aber die Entwicklung von tà katoptrizómena brauche ich nicht zu schildern, sie liegt den Leser*innen seit 23 Jahren vor Augen. Damit schließt sich sozusagen der Kreis. The Absence of PresenceHarald Schroeter-Wittke schreibt in seinen theologisch-biographischen Notizen in diesem Heft im Anschluss an Vilém Flusser von der Bodenlosigkeit. Für mich persönlich würde ich eher die Ortlosigkeit in Anschlag bringen. Auch dafür könnte man sich auf Vilém Flusser berufen.[46] Freilich ist meine Existenz keine nomadische wie die von Flusser beschriebenen. Aber ortlos ist sie darin, dass sie sich nicht fest verorten lässt: Als freiberuflicher Theologe, als Privatier, Grenzgänger zwischen dem Theologischen und dem Kulturwissenschaftlichen. Ich habe einmal begonnen Theologie zu studieren, um Pfarrer zu werden, der ich dann bewusst nicht geworden bin. Ich habe lange Zeit evangelische Theologie getrieben, um mich dann verstärkt der Kulturwissenschaft zuzuwenden, weil mir zwar nicht die evangelische Theologie selbst, wohl aber die notwendig mit ihr verbundene Gestalt der evangelischen Kirche in der aktuellen Erscheinungsform fraglich geworden ist, ihre Formelhaftigkeit, ihr zunehmender Drang zur Zentralisierung und zur Reglementierung des religiösen Lebens. In der Kunst gibt es Gott sei Dank keine Leuchttürme. Aber natürlich gibt es keine Theologie ohne Gemeinde. Meine ‘Gemeinde’ ist nun seit 23 Jahren eine virtuelle: tà katoptrizómena. 42 Jahre nach „Dust in the wind“ veröffentlicht die US-amerikanische Rockband Kansas in neuer Besetzung 2020 im Jahr der Corona-Krise ihr Lied „The Absence of Presence“. Unter erkennbarer Aufnahme von 1. Korinther 13, 12 heißt es dort:
Immer durch einen Spiegel und niemals (immer noch nicht) von Angesicht zu Angesicht. Das ist das katoptrische Universum der Gegenwart:
So ist es, aber so muss es nicht bleiben. Am Ende / Zum Ende / Als Ende / Statt eines Endes ...
Postskiptum: MusiklisteDieser Personal Essay wurde von diversen Musiktiteln begleitet. Wer nicht alle hinterlegten Musikstücke gefunden hat, für den ist hier noch einmal eine Liste zusammengestellt mit den entsprechenden Videos auf Youtube. Bei einigen Liedern habe ich neuere bzw. Live-Versionen verlinkt (etwa bei Grönemeyer), weil sie mir authentischer erschienen als die offiziellen Musikvideos.
Anmerkungen[1] Mertin, Andreas (1999): Brot statt Böller? Überlegungen zum Sinngehalt einer evangelischen Zeichenhandlung. In: Praktische Theologie 33-34 (2), S. 105–112. [2] Kansas, Dust in the wind, 1978 [3] Cramer-Naumann, Samuel (1993): Gott als geschehende Geschichte. Die elohistische Interpretation JHWHs als des Kommenden im [ehyeh asher ehyeh] von Ex 3,14. Bochum: Brockmeyer. [4] 1976 unter dem Thema „Was ist der Mensch“, 1977 unter dem Thema „Arbeit – Freizeit – Muße“. [5] Ich hörte es wortwörtlich, uns wurde eine Hörspielfassung vorgespielt, ich vermute, es war diese: www.deutschlandfunkkultur.de/hoerspielklassiker-das-tagebuch-eines-verfuehrers.3692.de.html?dram:article_id=344730 [6] Horkheimer, Max; Gumnior, Helmut (1975): Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen. Hamburg: Furche-Verl. (Stundenbücher, 97). [7] Vgl. Mertin, Andreas (1994): Die ästhetische Kritik der Ethik in Theodor W. Adornos "Minima Moralia". Marburg/Lahn. Online verfügbar unter http://www.amertin.de/aufsatz/1994/magister0.htm . [8] Karl Barth 1934: Offenbarung, Kirche, Theologie [9] Damals war der Besuch von Saintes-Maries-de-la-Mer nur der Folge der Empfehlung des Reiseführers, heute wäre er die Auseinandersetzung mit einer der weitgehend verborgenen Traditionen des Christentums. Nach einer Überlieferung aus dem 11. Jahrhundert soll die schwarze Sara als Dienerin von Maria Magdalena und Maria von Bethanien am leeren Grab am Ostermorgen und damit Zeugin der vollzogenen Auferstehung Jesu gewesen sein. Vgl. dazu https://www.heiligenlexikon.de/BiographienS/Sara-la-Kali.html [10] Herbert Grönemeyer, 4630 Bochum. 1984 (hier die wunderschöne Gelsenkirchener aufnahme von 2003) [11] Eine ganz gute Beschreibung bietet Carlo Affatigato in seinen Text „Inside the beauty of Apocalypse Now’s opening sequence“. Er schreibt: „Darkness. Muffled noises reverberate in a closed space that probably is our own head. The trees of the tropical forest, flourishing but dull, seen through the yellow steam of the human presence. Then the explosions, scary, silent. Apart from that recurring noise of a helicopter propeller, which flies in our braincase like a butterfly crazed inside a lightbulb, the only sound that you hear is the voice of Jim Morrison and The End. A peculiar way of representing Captain Willard’s state of mental alteration, those spirited blue-eyed that stare at the emptiness of that hotel room in Saigon. Vietnam. The war. Willard saw the horror too. But he didn’t know that there was much more than what he thought.” [Quelle] [12] Barth, Karl (1989): Rechtfertigung und Recht. Christengemeinde und Bürgergemeinde. 4. Aufl. Zürich: Theol. Verl. (Theologische Studien, 104). [13] Thaidigsmann, Edgar (1987): Gottes schöpferisches Sehen. Elemente einer theologischen Sehschule im Anschluss an Luthers Auslegung des Magnificat. In: Neue Zeitschrift für Systematische Theologie (NZSTh) (29), S. 19–38. [14] Ziehe, Thomas (1981): Pubertät und Narzißmus. Sind Jugendliche entpolitisiert? 4., unveränd. Aufl. Frankfurt a.M.: Europ. Verl.-Anst. [15] Vgl. auch Ebach, Jürgen (2014): Menschensohn. Eine biblische Wortverbindung, ins Gespräch gebracht mit Sigmar Polkes Glasfenster „Der Menschensohn“ oder: Warum mehr als eine Verstehensmöglichkeit „schriftgemäß“ ist. In: tà katoptrizómena, Jg. 16, H. 91. http://www.theomag.de/91/je1.htm. [16] Ebach, Jürgen (1987): Kassandra und Jona. Gegen die Macht des Schicksals. Frankfurt am Main: Athenäum Verlag. [17] Ebach, Jürgen (1984): Leviathan und Behemoth. Eine biblische Erinnerung wider die Kolonisierung der Lebenswelt durch das Prinzip der Zweckrationalität: Schöningh Paderborn. Online abrufbar unter [18] Ebd. S. 34 [19] Ideal, Berlin, 1980 [22] Ich vermute rückblickend, dass es sich eher um ein Exemplar der Faksimile-Ausgabe des Fischer-Verlages von 1973 handelte und nicht um eines der Originalexemplare, bin mir aber nicht sicher. [23] Schmidt, Arno (1974): Leviathan und Schwarze Spiegel (Fischer-Bücherei). [24] Deutsche Sagen und Sitten in hessischen Gauen. Kassel 1854 [25] Oelmüller, Willi (Hg.) (1981): Kolloquium Kunst und Philosophie 1. Ästhetische Erfahrung (Uni-Taschenbücher, 1105). Oelmüller, Willi (Hg.) (1982): Kolloquium Kunst und Philosophie 2. Ästhetischer Schein. Paderborn: Schöningh (Uni-Taschenbücher, 1178). Oelmüller, Willi (Hg.) (1983): Kolloquium Kunst und Philosophie 3. Das Kunstwerk. Paderborn: Schöningh (Uni-Taschenbücher, 1276). [26] Sölle, Dorothee (1973): Realisation. Studien zum Verhältnis von Theologie und Dichtung nach der Aufklärung. Darmstadt: Luchterhand (Sammlung Luchterhand, 124). [27] Es begab sich aber zu der Zeit ... Bestandsaufnahme erzählender Theologie für d. Religionspädagogik "forum religion" 4/83, S. 14-37. Stuttgart: Kreuz (mit J. Herrmann, B. Böttge und U. Dietrich; eigene Beiträge: 1, Punkt 2 u.3, 4b und d, 5, 7b.) sowie Bilder erzählen ... Zur Arbeit mit Bildern im Religionsunterricht. Zwei Unterrichtsideen für Sek I+II "forum religion" 3/84, S. 1-16, Stuttgart: Kreuz. (mit J. Herrmann, B. Böttge und E. Bark-Nawrath) [28] Ich habe erst 1992 begonnen, mich analytisch mit populärer Kultur auseinanderzusetzen. Ein erster Ertrag erschien dann 1994 in den Schönberger Heften: „Religion in der Alltagswirklichkeit. Am Beispiel des Video-Clips "Like a prayer" von Madonna“. [29] Bredekamp, Horst (1975): Kunst als Medium sozialer Konflikte. Bilderkämpfe von der Spätantike bis zur Hussitenrevolution. Frankfurt am Main: Suhrkamp (Edition Suhrkamp, 763). S. 112-113. [30] Mertin, Andreas (1988): Der allgemeine und der besondere Ikonoklasmus. Bilderstreit als Paradigma christlicher Kunsterfahrung. In: Andreas Mertin und Horst Schwebel (Hg.): Kirche und moderne Kunst. Eine aktuelle Dokumentation. Frankfurt am Main: Athenäum Verlag, S. 146–168. [31] Rittelmeyer, Christian (1979): Dogmatismus, Intoleranz und die Beurteilung moderner Kunstwerke (1969). In: Rainer Wick und Astrid Wick-Kmoch (Hg.): Kunstsoziologie. Bildende Kunst und Gesellschaft. Köln: DuMont (DuMont Taschenbücher, 80), S. 296–313. [32] Schmidt, Heinz-Ulrich (1988): Der Kunst verpflichtet. Kunst und Diakonie in Wehr-Öflingen. In: Andreas Mertin und Horst Schwebel (Hg.): Kirche und moderne Kunst. Eine aktuelle Dokumentation. Frankfurt am Main: Athenäum Verlag, S. 30–40. Grundsätzlich Stiftung Hanna & Paul Gräb; Epting, Karl Ch; Gräb, Paul; Mutter, Anne-Sophie (Hg.) (2012): Netze. Hanna & Paul Gräb - Ein Lebenswerk . Freiburg: Modo Verlag. [33] Dass dies auch Karl Barth 50 Jahre zuvor in seinen Vorlesungen zur Ethik gesagt hatte, wusste ich damals noch nicht. [34] Mertin, Andreas; Meistermann, Georg (1988): Erfüllt von allen Sinnen. Georg Meistermann: Ein Künstler im Gespräch. In: Andreas Mertin und Horst Schwebel (Hg.): Kirche und moderne Kunst. Eine aktuelle Dokumentation. Frankfurt am Main: Athenäum Verlag, S. 124–134. [35] Mertin, Andreas; Schwebel, Horst (Hg.) (1988): Kirche und moderne Kunst. Eine aktuelle Dokumentation. Frankfurt am Main: Athenäum Verlag. [36] Schwebel, Horst; Mertin, Andreas (Hg.) (1989): Bilder und ihre Macht. Zum Verhältnis von Kunst und christlicher Religion. Stuttgart: Verl. Kath. Bibelwerk. [37] Man könnte auch sagen: Bevor es auseinander bricht / Je eher, je eher du gehst / Um so leichter, um so leichter wird's für mich. (Grönemeyer, Flugzeuge im Bauch) [38] Grözinger, Albrecht (1987): Praktische Theologie und Ästhetik. Ein Beitrag zur Grundlegung der praktischen Theologie. München: Kaiser. [39] Neuhaus, Dietrich (Hg.) (1992): Von der Schwere Gottes und der Leichtigkeit des Seins. Evangelische Akademie Arnoldshain (Arnoldshainer Protokolle, 4/92). [40] Heller, Barbara (Hg.) (1997): Kulturtheologie heute? [Dokumentation einer Tagung der Evangelischen Akademie Hofgeismar in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft "Theologie und Ästhetik" 6. - 9. Juni 1996]. Evangelische Akademie Kurhessen-Waldeck. Hofgeismar: Evang. Akad (Hofgeismarer Protokolle, 311). [41] Neuhaus, Dietrich; Mertin, Andreas (Hg.) (1999): Wie in einem Spiegel. Begegnungen von Kunst, Religion, Theologie und Ästhetik: Haag + Herchen GmbH. [42] Extrabreit, Alptraumstadt, 1980 [43] Berg, Stephan (1995): Thom Barth. "Die Ornamente Kommen nie zum Schluss". In: Die fotografische Dimension. Ruppichteroth: Verlag Kunstforum (Kunstforum International, 129.1995), S. 204–217.. [44] Lütkemeyer, Marcus (2002): "You know why you're here today?". „Der freie Blick – Künstlerische Interventionen in den religiösen Raum“ Thom Barth, Bjørn Melhus, Nicola Stäglich. In: Kunstforum International (162), S. 310–311. [45] Kansas, The Absence of Presence, 2020 [46] Flusser, Vilém (1994): Von der Freiheit des Migranten. Einsprüche gegen den Nationalismus. Bensheim: Bollmann. [47] Horkheimer, Max; Adorno, Theodor W. (2003): Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente. 14. Aufl., ungekürzte Ausg. Frankfurt/Main: Fischer Taschenbuch. [48] Karl Barth (1934): Offenbarung, Kirche, Theologie, München, S. 34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/129/am721.htm |
 Wir fuhren zunächst über Avignon und Arles bis zur Mittelmeerküste nach Saintes-Maries-de-la-Mer und lernten dort mit dem
Wir fuhren zunächst über Avignon und Arles bis zur Mittelmeerküste nach Saintes-Maries-de-la-Mer und lernten dort mit dem  Ich will gar nicht die ganze Reise – die ich bis heute als wichtigen Teil meiner theologischen Existenz begreife – beschreiben, maßgeblich waren aber sicher die Erfahrungen von vorneuzeitlich multikulturellen Städten wie Granada (mit der
Ich will gar nicht die ganze Reise – die ich bis heute als wichtigen Teil meiner theologischen Existenz begreife – beschreiben, maßgeblich waren aber sicher die Erfahrungen von vorneuzeitlich multikulturellen Städten wie Granada (mit der  Jahre später war ich noch zwei Mal in dieser Stadt und jedes Mal war es etwas Besonderes. Einmal erlebten wir die
Jahre später war ich noch zwei Mal in dieser Stadt und jedes Mal war es etwas Besonderes. Einmal erlebten wir die 

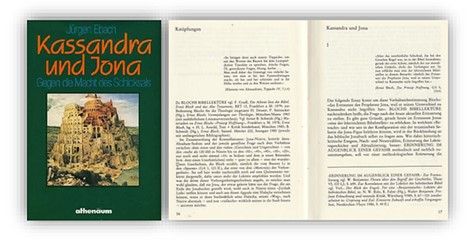 Deutlich wurde mir, wie wichtig die Form bei der Vermittlung theologischer Inhalte ist. Man kann am einige Jahre später erschienenen Buch „Kassandra und Jona“
Deutlich wurde mir, wie wichtig die Form bei der Vermittlung theologischer Inhalte ist. Man kann am einige Jahre später erschienenen Buch „Kassandra und Jona“ „Es erzählt vom Ende dieses einen Leidens und bezeichnet damit partiell, konkret utopisch, die Utopie, dass jedes Leiden ein Ende haben kann. Freilich ist diese Utopie von der Intention, unter den konkreten Bedingungen des gegenwärtigen Lebens, der Ausbeutung und Gewalt, nicht mehr leiden zu wollen, ebenso weit entfernt wie der Gedanke der Erlösung von den Versprechungen der Pharmaindustrie. Wäre der Gedanke, das Leiden abzuschaffen, ein zynischer Unterwerfungsakt unter die Regeln kapitalistischer Verwertung, so wäre umgekehrt der Gedanke, die Vorstellung vom Leiden sei von der vom Menschen nicht zu trennen, ein Unterwerfungsakt unter die zur Natur erstarrte Geschichte. Eine Theologie, die es mit dem Reden von der Erlösung ernst meint — und nur sie darf zu Recht sich Theologie nennen —, hat gegen jene beiden Formen der Unterwerfung
„Es erzählt vom Ende dieses einen Leidens und bezeichnet damit partiell, konkret utopisch, die Utopie, dass jedes Leiden ein Ende haben kann. Freilich ist diese Utopie von der Intention, unter den konkreten Bedingungen des gegenwärtigen Lebens, der Ausbeutung und Gewalt, nicht mehr leiden zu wollen, ebenso weit entfernt wie der Gedanke der Erlösung von den Versprechungen der Pharmaindustrie. Wäre der Gedanke, das Leiden abzuschaffen, ein zynischer Unterwerfungsakt unter die Regeln kapitalistischer Verwertung, so wäre umgekehrt der Gedanke, die Vorstellung vom Leiden sei von der vom Menschen nicht zu trennen, ein Unterwerfungsakt unter die zur Natur erstarrte Geschichte. Eine Theologie, die es mit dem Reden von der Erlösung ernst meint — und nur sie darf zu Recht sich Theologie nennen —, hat gegen jene beiden Formen der Unterwerfung  Bemerkenswert war die heute leider nicht mehr existente Heinrich-Heine-Buchhandlung unter der Hardenbergbrücke am Bahnhof Zoo. Das war eine Art
Bemerkenswert war die heute leider nicht mehr existente Heinrich-Heine-Buchhandlung unter der Hardenbergbrücke am Bahnhof Zoo. Das war eine Art  Unter den anwesenden Schriftstellern und Kulturschaffenden waren u. a. Hildegard und Reinhard Baumgart, Peter Bichsel, Heinrich Böll, Elias Canetti, Ingeborg Drewitz, Tankred Dorst, Marianne Frisch, Ernst Jandl, Urs Jaeggi, Uwe Johnson, Allen Ginsberg, Wolfgang Hildesheimer, Walter Höllerer, Elfriede Jelinek, Walter Kempowski, Brigitte Kronauer, Wolf Lepenies, Friederike Mayröcker, Margarete Mitscherlich, Oskar Pastior, Elisabeth Plessen, Gerlind Reinshagen, Klaus Staeck, Uwe Timm, Vicco von Bülow, Klaus Wagenbach, Martin Walser und Peter Weiss.
Unter den anwesenden Schriftstellern und Kulturschaffenden waren u. a. Hildegard und Reinhard Baumgart, Peter Bichsel, Heinrich Böll, Elias Canetti, Ingeborg Drewitz, Tankred Dorst, Marianne Frisch, Ernst Jandl, Urs Jaeggi, Uwe Johnson, Allen Ginsberg, Wolfgang Hildesheimer, Walter Höllerer, Elfriede Jelinek, Walter Kempowski, Brigitte Kronauer, Wolf Lepenies, Friederike Mayröcker, Margarete Mitscherlich, Oskar Pastior, Elisabeth Plessen, Gerlind Reinshagen, Klaus Staeck, Uwe Timm, Vicco von Bülow, Klaus Wagenbach, Martin Walser und Peter Weiss. Neben den Buchhandlungen standen die Galerien im Fokus. In der Hardenbergstraße lag auch die renommierte
Neben den Buchhandlungen standen die Galerien im Fokus. In der Hardenbergstraße lag auch die renommierte  Im folgenden Wintersemester 1982/83 veranstaltete der Assistent des Instituts ein Seminar über „Moderne Kunst und die Frage nach dem Sinn“ und auch hier schrieb ich eine Arbeit: „Negative Sinnkonstitution in Max Beckmanns Gemälde ‚Der Traum‘“. Im parallel stattfindenden homiletischen Hauptseminar lernte ich dann Jörg Herrmann kennen, der zusammen mit mir in einer Seminargruppe eine Predigtarbeit schrieb. Das begründete eine bis heute währende Freundschaft, die ziemlich bald auch in eine produktive gemeinsame Schreib- und Publikationstätigkeit mündete.
Im folgenden Wintersemester 1982/83 veranstaltete der Assistent des Instituts ein Seminar über „Moderne Kunst und die Frage nach dem Sinn“ und auch hier schrieb ich eine Arbeit: „Negative Sinnkonstitution in Max Beckmanns Gemälde ‚Der Traum‘“. Im parallel stattfindenden homiletischen Hauptseminar lernte ich dann Jörg Herrmann kennen, der zusammen mit mir in einer Seminargruppe eine Predigtarbeit schrieb. Das begründete eine bis heute währende Freundschaft, die ziemlich bald auch in eine produktive gemeinsame Schreib- und Publikationstätigkeit mündete. In der theologischen Fakultät in Marburg war das Institut für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart eine Enklave für sich. Das wurde schon dadurch deutlich, dass es nicht im Gebäude der Alten Universität lokalisiert war, sondern in einem anderen Gebäude, Am Plan 3, in dem auch im Erdgeschoss die Religionsgeschichte und im dritten Stock die Ostkirchengeschichte residierte. Diese Differenz der Orte entsprach durchaus dem Selbstverständnis des Instituts, das sich nicht als normaler universitärer Lernort für Theolog*innen verstand. Man lebte in diesem Institut. Dadurch, dass nicht nur die Universität, sondern auch die beiden hessischen Landeskirchen und die EKD das Institut trugen, verfügte es über eine für damalige Verhältnisse exzellente Ausstattung. Es hatte eine eigene Bibliothek samt Bibliothekarin (zwischenzeitlich war dies die spätere Chefredakteurin der taz,
In der theologischen Fakultät in Marburg war das Institut für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart eine Enklave für sich. Das wurde schon dadurch deutlich, dass es nicht im Gebäude der Alten Universität lokalisiert war, sondern in einem anderen Gebäude, Am Plan 3, in dem auch im Erdgeschoss die Religionsgeschichte und im dritten Stock die Ostkirchengeschichte residierte. Diese Differenz der Orte entsprach durchaus dem Selbstverständnis des Instituts, das sich nicht als normaler universitärer Lernort für Theolog*innen verstand. Man lebte in diesem Institut. Dadurch, dass nicht nur die Universität, sondern auch die beiden hessischen Landeskirchen und die EKD das Institut trugen, verfügte es über eine für damalige Verhältnisse exzellente Ausstattung. Es hatte eine eigene Bibliothek samt Bibliothekarin (zwischenzeitlich war dies die spätere Chefredakteurin der taz,  Wir wohnten in Marburg in der Rosenstraße, in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof gelegen, aber wir hatten eine Wohnung mit einem wirklich fantastischen Blick auf die Elisabethkirche und das Marburger Schloss. Wenn ich heute etwas an Marburg vermisse, dann ist es dieser abendliche Blick aus dem Schlaf-/Arbeitszimmer und aus dem Wohnzimmer auf die hellerleuchteten Highlights von Marburg. Die Wohngemeinschaft hatte sich im Laufe der Jahre zu so etwas wie einem theologisch-philosophischen Salon entwickelt – sagen mir jedenfalls Leute, die dabei waren und die ich nach Jahren heute noch treffe. Mir war das damals nicht so bewusst. Sicher haben wir uns mit Studierenden dort regelmäßig getroffen, haben gefeiert,
Wir wohnten in Marburg in der Rosenstraße, in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof gelegen, aber wir hatten eine Wohnung mit einem wirklich fantastischen Blick auf die Elisabethkirche und das Marburger Schloss. Wenn ich heute etwas an Marburg vermisse, dann ist es dieser abendliche Blick aus dem Schlaf-/Arbeitszimmer und aus dem Wohnzimmer auf die hellerleuchteten Highlights von Marburg. Die Wohngemeinschaft hatte sich im Laufe der Jahre zu so etwas wie einem theologisch-philosophischen Salon entwickelt – sagen mir jedenfalls Leute, die dabei waren und die ich nach Jahren heute noch treffe. Mir war das damals nicht so bewusst. Sicher haben wir uns mit Studierenden dort regelmäßig getroffen, haben gefeiert,  Als ich damals sagte, ich würde gerne über den Umgang von Kirchengemeinden mit zeitgenössischer Kunst arbeiten und forschen, hatte ich nicht wirklich einen Begriff von dem, wie ich das angehen sollte. Man hat ja ganz verschiedene Möglichkeiten, so etwas zu realisieren. Horst Schwebel schlug mir vor, als erstes nach Bad Säckingen zu reisen und dort mit dem Pfarrer Paul Gräb zu sprechen, der im Protestantismus das bedeutendste
Als ich damals sagte, ich würde gerne über den Umgang von Kirchengemeinden mit zeitgenössischer Kunst arbeiten und forschen, hatte ich nicht wirklich einen Begriff von dem, wie ich das angehen sollte. Man hat ja ganz verschiedene Möglichkeiten, so etwas zu realisieren. Horst Schwebel schlug mir vor, als erstes nach Bad Säckingen zu reisen und dort mit dem Pfarrer Paul Gräb zu sprechen, der im Protestantismus das bedeutendste  Im Fachbereich Philosophie gab es einen Philosophen, der zwar von Religion wenig hielt, von Theologen aber umso mehr, weil sie nämlich Latein und Griechisch konnten, seiner Meinung nach eine wichtige, wenn nicht sogar unentbehrliche Voraussetzung philosophischer Arbeit. Und dieser Philosoph, der Kantforscher
Im Fachbereich Philosophie gab es einen Philosophen, der zwar von Religion wenig hielt, von Theologen aber umso mehr, weil sie nämlich Latein und Griechisch konnten, seiner Meinung nach eine wichtige, wenn nicht sogar unentbehrliche Voraussetzung philosophischer Arbeit. Und dieser Philosoph, der Kantforscher 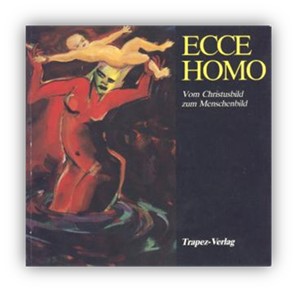 Währenddessen war das Marburger Institut verstärkt mit der Organisation von Ausstellungen zeitgenössischer Kunst vor allem unter religiösen Fragestellungen beschäftigt. 1985 organisierte Horst Schwebel zusammen mit einem Vorbereitungskreis die Ausstellung „Die andere Eva. Wandlungen eines biblischen Frauenbildes“, die zuerst auf dem Düsseldorfer Kirchentag gezeigt wurde und dann durch Deutschland wanderte, u.a. im Frauenmuseum Bonn und in der Kunsthalle in Darmstadt. 1987 wurde dann die Documenta-Begleitausstellung „Ecce Homo. Vom Christusbild zum Menschenbild“ in der Kasseler Brüderkirche gezeigt. Die Vorbereitung dieser Ausstellungen nahm immer das ganze Institut in Beschlag. Künstler*innen mussten ausgewählt und besucht werden,
Währenddessen war das Marburger Institut verstärkt mit der Organisation von Ausstellungen zeitgenössischer Kunst vor allem unter religiösen Fragestellungen beschäftigt. 1985 organisierte Horst Schwebel zusammen mit einem Vorbereitungskreis die Ausstellung „Die andere Eva. Wandlungen eines biblischen Frauenbildes“, die zuerst auf dem Düsseldorfer Kirchentag gezeigt wurde und dann durch Deutschland wanderte, u.a. im Frauenmuseum Bonn und in der Kunsthalle in Darmstadt. 1987 wurde dann die Documenta-Begleitausstellung „Ecce Homo. Vom Christusbild zum Menschenbild“ in der Kasseler Brüderkirche gezeigt. Die Vorbereitung dieser Ausstellungen nahm immer das ganze Institut in Beschlag. Künstler*innen mussten ausgewählt und besucht werden,  Mit der Publikation der beiden Bücher „Kirche und moderne Kunst. Eine aktuelle Dokumentation“
Mit der Publikation der beiden Bücher „Kirche und moderne Kunst. Eine aktuelle Dokumentation“ Auch wenn ich in Marburg eigentlich nicht mehr politisch aktiv sein wollte, kam es dann doch noch dazu – wenn auch nur indirekt. Die Studienverhältnisse waren so prekär geworden, dass 1989 ein studentischer Streik geplant wurde und die theologische Fachschaft diskutierte, wie sie sich an diesem Streik beteiligen könne. Ich weiß nicht mehr, warum ich bei dieser Studierendenversammlung überhaupt anwesend war, jedenfalls schlug ich den Studierenden vor, sie könnten doch die historische Elisabethkirche „besetzen“ und den Lehrbetrieb dorthin verlegen. Man würde in der Kirche schlafen und die Dozenten bitten, ihren Lehrbetrieb dort abzuhalten.
Auch wenn ich in Marburg eigentlich nicht mehr politisch aktiv sein wollte, kam es dann doch noch dazu – wenn auch nur indirekt. Die Studienverhältnisse waren so prekär geworden, dass 1989 ein studentischer Streik geplant wurde und die theologische Fachschaft diskutierte, wie sie sich an diesem Streik beteiligen könne. Ich weiß nicht mehr, warum ich bei dieser Studierendenversammlung überhaupt anwesend war, jedenfalls schlug ich den Studierenden vor, sie könnten doch die historische Elisabethkirche „besetzen“ und den Lehrbetrieb dorthin verlegen. Man würde in der Kirche schlafen und die Dozenten bitten, ihren Lehrbetrieb dort abzuhalten.  Von 1990 bis 1997 tagte der Arbeitskreis Theologie und Ästhetik jedes Jahr und wurde mit der Zeit so populär, dass die Akademien die finanzielle Last nicht mehr stemmen konnten (sie bezahlten bis dahin Kost und Logis aller Teilnehmer*innen), und wir die Veranstaltung in normale Publikumstagungen umwandelten. Ein besonderer Höhepunkt war dann 1996 die Tagung zur „Kulturtheologie heute“ auf der alle wichtigen Kulturtheolog*innen Deutschlands versammelt waren.
Von 1990 bis 1997 tagte der Arbeitskreis Theologie und Ästhetik jedes Jahr und wurde mit der Zeit so populär, dass die Akademien die finanzielle Last nicht mehr stemmen konnten (sie bezahlten bis dahin Kost und Logis aller Teilnehmer*innen), und wir die Veranstaltung in normale Publikumstagungen umwandelten. Ein besonderer Höhepunkt war dann 1996 die Tagung zur „Kulturtheologie heute“ auf der alle wichtigen Kulturtheolog*innen Deutschlands versammelt waren.
 Die Befürchtungen der Kirchengemeinden gingen aber immer in die entgegengesetzte Richtung. Sie hatten Angst, Angst vor der Gegenwart der Kunst. Das habe ich nie verstanden. Auch 1997 artikulierte sich diese Angst, es gab Proteste, man drohte mit öffentlichen Protestauftritten bei der Eröffnung, Bischof Zippert musste intervenieren, um die Aggressionen im Zaum zu halten. Entzündet hatten sich die Bedenken an der Altarüberbauung von Madeleine Dietz, einem einzigartigen Objekt, das wie kaum ein anderes – sieht man einmal von Thom Barths noch vorzustellender Intervention ab – die Vitalität der Religion befragte.
Die Befürchtungen der Kirchengemeinden gingen aber immer in die entgegengesetzte Richtung. Sie hatten Angst, Angst vor der Gegenwart der Kunst. Das habe ich nie verstanden. Auch 1997 artikulierte sich diese Angst, es gab Proteste, man drohte mit öffentlichen Protestauftritten bei der Eröffnung, Bischof Zippert musste intervenieren, um die Aggressionen im Zaum zu halten. Entzündet hatten sich die Bedenken an der Altarüberbauung von Madeleine Dietz, einem einzigartigen Objekt, das wie kaum ein anderes – sieht man einmal von Thom Barths noch vorzustellender Intervention ab – die Vitalität der Religion befragte. Das Merkwürdige war, dass mehr als zehn Jahre später dieselbe Gemeinde die gleiche Künstlerin bat, an derselben Stelle die
Das Merkwürdige war, dass mehr als zehn Jahre später dieselbe Gemeinde die gleiche Künstlerin bat, an derselben Stelle die 

 Karin Wendt und ich sind dann mit der "verschworenen Gemeinschaft von Aktiven“ an den Bodensee gereist, um mit Thom Barth vor dem Modell die Realisierungsmöglichkeiten (und Implikationen) seines Kunstprojektes zu erörtern. Die Containerlösung ging dann aus bautechnischen Gründen nicht, aber eine Gerüstlösung ließ sich tatsächlich realisieren und führte zu einem Ergebnis, wie es sich wohl auch Thom Barth vorab nicht hätte ausdenken können.
Karin Wendt und ich sind dann mit der "verschworenen Gemeinschaft von Aktiven“ an den Bodensee gereist, um mit Thom Barth vor dem Modell die Realisierungsmöglichkeiten (und Implikationen) seines Kunstprojektes zu erörtern. Die Containerlösung ging dann aus bautechnischen Gründen nicht, aber eine Gerüstlösung ließ sich tatsächlich realisieren und führte zu einem Ergebnis, wie es sich wohl auch Thom Barth vorab nicht hätte ausdenken können.
 Die neu hinzugekommene Karlskirche war auch deshalb reizvoll, weil sie nicht nur ein reformierter Kirchenraum war, sondern auch, weil sie Jahre zuvor bereits einmal Spielort der Documenta war. Denn auf der documenta 8 realisierte John Cage 1987 dort die Klanginstallation Writing through the Essay ‚On the Duty of Civil Disobedience‘. Mit den Arbeiten von
Die neu hinzugekommene Karlskirche war auch deshalb reizvoll, weil sie nicht nur ein reformierter Kirchenraum war, sondern auch, weil sie Jahre zuvor bereits einmal Spielort der Documenta war. Denn auf der documenta 8 realisierte John Cage 1987 dort die Klanginstallation Writing through the Essay ‚On the Duty of Civil Disobedience‘. Mit den Arbeiten von