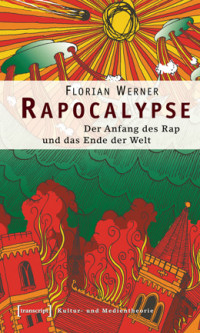Popmusik |
Time is running outZur Rezeption der Apokalpyse im Rap - Eine RezensionAndreas Kubik
Florian Werner, Rapocalypse: Der Anfang des Rap und das Ende der Welt Zum InhaltDas Ziel, welches sich das Buch vorsetzt, ist auf den ersten Blick eingeschränkt: Es möchte „die wichtigsten Transformationen, welche das Konzept des Millenialismus im afro-amerikanischen Diskurs durchlief, anhand von Textbeispielen vor allem aus dem Bereich der orature nachzeichnen“ (12). Sein Untersuchungsfeld sind die ursprünglich mündlichen Artikulationsformen der black communities, „deren Rezeption in der Regel eher auditiv denn visuell (…) und eher kollektiv als einzeln stattfindet – beispielsweise Lieder, Predigttexte oder Reden.“ (13) Hinter diesem bescheiden anmutenden Programm verbirgt sich dann aber eine faszinierende Reise durch in europäisch-wissenschaftlichen Kreisen und theologischen Zirkeln weithin unbekanntes Land. Werner spannt den Bogen weit auf. Bis wir im siebten und letzten Kapitel endlich zu den Anfängen des Rap gelangen, haben wir große Gebiete der afro-amerikanischen Musikgeschichte durchschritten. Den roten Faden bildet dabei stets das millenialistische Motiv. Dies wird im ersten Kapitel zunächst auf seine biblischen Wurzeln hin untersucht, wobei die eschatologischen Passagen des Hesekiel-Buches, Daniel und natürlich die Johannes-Offenbarung im Vordergrund stehen. Auslegungsgeschichtliche Schlaglichter von Irenäus bis zu den Theologen der Amerika-Auswanderer führen zu einer Ausdifferenzierung des Millenialismus-Konzepts in einen Prä-, einen A- und eine Postmillenialismus: Das tausendjährige Reich steht unmittelbar bevor, es wird spirituell transformiert oder ist bereits real angebrochen: die Parousie findet erst post millenium statt. Das zweite Kapitel widmet sich der „Amerikanisierung des Milleniums“ vor allem in den Apokalypse-Auslegungen der puritanischen Auswanderer (Samuel Sewall, Cotton Mather u.a.) In ihnen wird Amerika eine wichtige Position im göttlichen Heilsplan zugewiesen – eine Denkfigur, die sich bis in heutige Anschauungen amerikanischer Politiker erhalten hat. Die Kehrseite ist das othering der amerikanischen Ureinwohner als der verfluchten Söhne Hams (Gen 9, 18-27); diese Stelle wurde gerne „heranzitiert, um die Vertreibung der Native Americans und später die Versklavung der Afrikaner zu rechtfertigen“ (52). Die Christianisierung der Sklaven dient einerseits deren Disziplinierung (etwa mit Kol 3,22) und eschatologischer Vertröstung, andererseits erschließt sie diesen einen Diskursraum, der Sprach- und Gedankenmaterial für eigenständige Artikulationen zur Verfügung stellte. Innerhalb dieser Ambivalenz kommt dann auch die eindringliche Auslegung der Spirituals im dritten Kapitel zu stehen. Diese werden von Werner vor allem auf ihre emanzipativen Dimensionen hin untersucht, und dabei stehen naturgemäß eschatologische Motive im Vordergrund: „Was auf den ersten Blick affirmativ-gefügig wirkt, birgt auf den zweiten revolutionäre Sprengkraft.“ (71) Die Spirituals sind Bildungen von ‚Hybriden’ – wie Werner im Anschluss an Homi Bhaba ausführt –, die eine eigene Bibelhermeneutik und afrikanische musikalische Traditionen so miteinander verbanden, dass sie von den Sklavenhaltern lediglich als ‚primitive’ (und somit wünschenswerte), gefügig machende Gesänge verstanden wurden. Ihre ästhetische, identitätsstiftende und verschlüsselte Botschaften – später im so genannten ‚signifying’ perfektioniert – transportierende Bedeutung wurde nicht erkannt. Kapitel 4 bearbeitet die Idee der ‚Kolonisierung’ Afrikas durch freigelassene Sklaven und deren Niederschlag in Pro- und Anti-Colonization Songs, ein Diskurs, der zunächst nur von ‚Weißen’ geführt wurde. Leitend wurde der eschatologisch ausgelegte Bibelvers Ps 68,31: „Ethiopia shall soon stretch out her hands unto God“, wobei „Äthiopien“ pars pro toto für ganz Afrika stand. Tatsächlich kam es zu kleineren Rückführungsbewegungen – vor allem nach Liberia –, aber die meisten Freigelassenen waren nicht bereit, ihre mühsam erworbene afroamerikanische Teilidentität wieder abzulegen. Das Verhältnis von ‚afrikanischer’ und ‚afroamerikanischer’ Identität wird bis heute von Rap- und HipHop-Gruppen kontrovers diskutiert. Für die Entwicklung der speziellen Musikalität des Rap sind indessen andere Traditionen von Belang, die Werner in seinem fünften Kapitel traktiert: der so sogenannte chanted sermon und natürlich der Blues.[2] Von der spezifischen Tonalität der old-time negro preacher existieren nur wenige Schallplattenaufnahmen. Die apokalyptischen Predigten wirken „vor allem durch außerliterarische Mittel, durch Strategien der Mündlichkeit; vor allem durch konsequentes tonales Sprechen innerhalb einer Blues-Skala.“ (122)[3] Akzentuierung, Phrasierung, Rhythmus, sowie das interaktive Einbeziehen der Gemeinde („ya’ll know what I mean?“) sind bestimmende Formmerkmale. Der Blues fokussiert in anderer Weise auf das singende Subjekt, das im Gesang seine „somebodiness“[4] (140) wiederherstellt, die repressive Umstände immer wieder antasten. Zu einem förmlichen Krimi wird das Buch im sechsten Kapitel, das die verschlungenen Interdependenzen der Ras Tafari Bewegung (sich speisend aus der Verehrung des äthiopischen [!] Königs Haile Selassie in Jamaika und anderswo), der Nation of Islam[5] und dessen Seitenverbindungen zum amerikanischen Protestantismus, der vom black power inspirierten Umdeutungen der schwarzen Hautfarbe zum erstrebenswerten Normalfall und Ausgangspunkt der Weltgeschichte[6] sowie des Aufstiegs ‚schwarzer’ Clans im Musikbusiness luzide auseinanderpuzzelt. All dies hat seine klar identifizierbaren Spuren im Rap hinterlassen. Dessen Anfänge werden im siebten Kapitel dargestellt – unter besonderer Berücksichtigung der stilbildenen Gruppen The Last Poets und der Sugarhill Gang –, bevor anhand von ausgesuchten Fallstudien die musik- und motivgeschichtlichen Studien gebündelt werden: Die Apokalypse wird im Rap mit atomaren, ökologischen oder rassistischen Ängsten verknüpft und druckvoll durch die Lautsprecher gejagt. Ein Fazit fragt nach der Funktion der millenialistischen Motivik im Rap: Treu zum apokalyptischen Genre macht Werner sieben solcher Motive aus (250-255):
Kritik und WürdigungAußerordentlich wohltuend wirkt, dass Werner sich von sämtlichen apologetischen Anliegen frei hält. Der alte bildungsbürgerliche Vorwurf, Rap sei doch keine Musik, wird nur in einem Nebensatz einmal erwähnt und ansonsten wirkungsvoll dekonstruiert, indem er historisiert und mit seinen sozioökonomischen Voraussetzungen korreliert wird: Das Arbeiten mit bereits bestehenden beats und sounds ist auch „ein Resultat des wirtschaftlichen Niedergangs der Bronx“ (209); noch der Ärmste kann rappen, wenn er an einen ghettoblaster herankommt und sich ein fixes Mundwerk antrainiert. Unbefangen und respektvoll geht Werner auch mit den verschiedensten religiösen Traditionen um, die für sein Thema eine Rolle spielen. Weder wird die Religiosität der Unterdrückten naiv abgefeiert, noch werden die zum Teil reichlich seltsam anmutenden Glaubensvorstellungen etwa der Nation of Islam ironisiert: Auch diese haben noch einen erschreckenden Hintergrund in der rassistischen Geschichte der USA und sind zugleich kulturell produktiv. Als Beispiel kann das Mythologem Elijah Muhammads gelten, dass im Jahr 2000 ein Raumschiff die Erde zerstören, die Gläubigen aber retten werde: In einer global immer mehr von ‚Weißen’ dominierten Welt müssen Rettungssehnsüchte geradezu „in immer weitere Fernen schweifen“ (171), wenn nicht einmal mehr der Kontinent Afrika dafür herhalten kann. Der ‚feurige Himmelswagen’ der Apokalypse kann dann probehalber als Raumschiff ausgelegt werden. Zudem lebten die verschleppten Sklaven schon immer „die Entfremdung, die sich SF-Autoren ausmalen[7] (…) Dies ist ein Gefühl, das besonders in der HipHop Kultur fortlebt.“ (172) Der break dance etwa ist nichts anderes als der Ausdruck des Bewusstseins „der eigenen Roboterhaftigkeit“ (ebd.; der Sklave als Roboter). Das Raumschiff wird somit „zum selbstverständlichen Inventar der afro-amerikanischen Idiomatik“ (176). Gerade die Verhaltenheit von Werners Schreibart macht die dramatischen und mitunter furchtbaren Hintergründe besonders transparent. An zwei Stellen hätte ich mir noch etwas mehr Ausführlichkeit gewünscht. Erstens, wenig ist von der Bedeutung des Produzententums im Rap die Rede, wie überhaupt die Bedeutung des music business – auch bei der ‚weißen’ Vereinnahmung der ‚schwarzen’ Musik – etwas kurz kommt.[8] Werner belässt es bei dem lapidaren Hinweis, dass „zahlreiche Rapper (…) inzwischen ganze Geschäftsimperien“ (190) führen. Ob und inwieweit dadurch Stile oder Motive auch gesetzt und diktiert werden, bleibt offen. Zweitens, ‚schwarze’ Musik hat von Gospel und Blues bis zum Rap eine weltweite Erfolgsgeschichte angetreten. Diese auch nur ansatzweise erklären zu wollen wäre Stoff für mindestens ein weiteres Buch. Aber ein kleiner Ausblick auf die Aufnahme des Rap in Deutschland und Umformungen des apokalyptischen Motivs hätte zumindest in der veröffentlichten Fassung vielleicht drin sein können.[9] Doch das grenzt hart ans Beckmesserische, wenn man bedenkt, dass gerade die poptheologisch Interessierten im Grunde vier Bücher in einem bekommen. Zum ersten erhält man eine kleine Geschichte und Theologie des Rap. Dies ist deshalb von Belang, weil die deutschsprachige Poptheologie sich natürlich explizit gegen die Unterscheidung von E- und U-Musik abgrenzen muss, diese aber in gewisser Weise dadurch reproduziert, dass sie faktisch zumeist zwischen ‚hochkulturellem’ (= interpretierenswertem) Edel-Pop weißer Intellektueller sowie globaler Konsensphänomene wie Michael Jackson einerseits und dem ganzen Rest, der nicht behandelt wird, andererseits unterscheidet. Gemessen an dem enormen Einfluss, den HipHop hat, ist das natürlich zu wenig. Zum zweiten erhält man eine motivgeschichtliche Untersuchung zur Apokalypse, von der die Theologie bislang kaum Notiz genommen hat,[10] samt der Erinnerung, dass hier eine extrem ambivalente Rezeptionsgeschichte vorliegt, da auch die „heilsgeschichtliche Legitimation der Sklaverei“ (45) zu ihr gehört. Insofern liegt auch ein Baustein zur Religionsgeschichte der USA vor. Zum dritten ist das Buch eine Art Geschichte der ‚schwarzen’ Musik im 20. Jahrhundert; auf die vielen Verknüpfungen und Verbindungen von Gospel und Rap muss man erst einmal kommen. So wird auch klar, warum Musiker wie Jamie Foxx, der eigentlich im Rap und im R&B zu Hause ist, als Darsteller von Ray Charles eine vielfach ausgezeichnete performance abliefert: Die Stile gehören schlicht ins gleiche Fach.[11] Die Ästhetik des HipHop und seine verschiedenen ‚handwerklichen’ Techniken werden von Werner kundig erläutert. Und schließlich liefert Werner auch eine Geschichte des amerikanischen Rassenkonflikts im Medium von Songs, welcher auf die populäre Kultur einen kaum zu überschätzenden Einfluss hatte. Was für „Herausforderungen“ all dies an die (Pop-) Theologie mit sich bringt, ist angesichts dieses vierfachen Aufklärungsertrags vielleicht erst einmal zweitrangig. Anmerkungen
|
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/68/ak2.htm
|
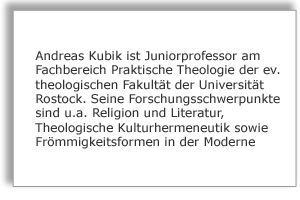 Theologische Sekundärliteratur zu Popmusik und zur pop culture überhaupt kann ihre anstrengenden Seiten haben. Da sieht sich die Theologie ständig ‚Herausforderungen’ gegenüber; da steht das Christentum häufig gleichsam mit dem Rücken zur Wand angesichts Tausender Lebensdeutungsbausteine und narrativer Sinnschnipsel, denen gegenüber seine große Erzählung wie ein schwer zu navigierender Öltanker wirkt. Religionstheologische Vereinnahmungs- oder apologetische Überbietungsbemühungen sind nur zwei der möglichen Reaktionen.
Theologische Sekundärliteratur zu Popmusik und zur pop culture überhaupt kann ihre anstrengenden Seiten haben. Da sieht sich die Theologie ständig ‚Herausforderungen’ gegenüber; da steht das Christentum häufig gleichsam mit dem Rücken zur Wand angesichts Tausender Lebensdeutungsbausteine und narrativer Sinnschnipsel, denen gegenüber seine große Erzählung wie ein schwer zu navigierender Öltanker wirkt. Religionstheologische Vereinnahmungs- oder apologetische Überbietungsbemühungen sind nur zwei der möglichen Reaktionen.