
Blindness and Insight |
Es ist Krieg
Der Begriff der Resonanz verbindet sich im ästhetischen Denken mit den Überlegungen des Philosophen und Psychologen Theodor Lipps (1851-1914), der das Moment der Einfühlung als zentralen Mechanismus der ästhetischen Rezeption erläuterte. Der Künstler Wassily Kandinsky (1866-1944) griff den Begriff auf, um damit den spezifischen Widerhall des Wirkungsspektrums von Form und Farbe im Betrachter zu umschreiben, und auch dies durchaus in einem physikalischen Sinne. So unmittelbar nachvollziehbar dieser Begriff im Bereich der abstrakten und vor allem konkreten Kunst ist, bei Kunst also, die im weitesten Sinne raumästhetische Probleme bearbeitet, so erklärungsbedürftig halte ich ihn doch im Zusammenhang mit narrativer Kunst, mit Medienreflexionen und auch mit der Kunst der Performance – und dies in besonderer Weise dann, wenn es um Arbeiten geht, die um das das Thema „Individuum und Krieg“ kreisen. Wenn man dem Betrachter hier mehr abfordert als die bloße Einfühlung im Sinne der Wirkungsästhetik, muss man in einem erweiterten Sinne vom Mechanismus der Resonanz sprechen. Kunst besitzt eine Eigenfrequenz, durch die die individuelle Perspektive verstärkt zum Schwingen gebracht wird. Kunst, so könnte man sagen, argumentiert aus Freiheit und ermöglicht so die freie Antwort des Betrachters. Im Hinblick auf die Ausstellung „Krieg/Individuum“ würde ich daher sagen, der Resonanzraum bildet sich nicht nur deshalb, weil eine „sichere Distanz“ abgebaut wird, sondern weil eine andere Form der Distanzierung ermöglicht wird. Die Kunstwerke appellieren nicht an unser Mitleid im Sinne des sozialen oder politischen Engagements, sondern sie fordern die Reflexion über unsere (Un-)Fähigkeit des Mitleidens heraus. Darin liegt ihr – wenn man so will – pazifistisches Potenzial. Das gilt aber für jede Kunst, nicht nur für die, die Gewalt und Zerstörung zum expliziten Gegenstand hat. Auch wenn die Erfahrung von extremer Gewalt für viele der ausgestellten Arbeiten den biographischen Hintergrund bildet, konzentrieren sich die Ausstellungsmacher auf das Zeigen der Kunstwerke. So werden diese selbst Anstoß, um zeitgeschichtliche und persönliche Hintergründe und Zusammenhänge zu recherchieren. Im folgenden greife ich einige der Arbeiten heraus, die mich in besonderer Weise zum Nachdenken angeregt haben. SchönheitIch beginne meinen kurzen Rundgang bei den Arbeiten von Barbara Hlali (*1979). Besonders eindrucksvoll fand ich den Trickfilm „painting paradise“ (2008). Die Künstlerin schreibt dazu auf ihrer Internetseite: „Medienberichte zeigen, wie die Mauer, die das Schiiten-Viertel in Bagdad umgibt, mit schönen Landschaftsbildern übermalt wird: Ästhetische Gestaltung wird eingesetzt, um militärische Maßnahmen und Kriegsauswirkungen zu kaschieren. Ähnlich verfahre ich im Film mit der Gesamtsituation: Bilder aus Krisengebieten sind mit Farbe überdeckt, verändert, verschönert. Eine trügerische Idylle entsteht, die angesichts der realen (Kriegs-)Situation jedoch nicht aufrecht zu erhalten ist. Die Übermalung entlarvt umgekehrt gerade die übermalte Situation. Der Film deutet hin auf tatsächliche Schönheit in einer Gegend, in der der mythologische Paradiesgarten zu verorten ist und die (europäische) Träume vom Orient weckt, die aber Schauplatz von Krieg und Terror ist.“ Hlali, die für die Aufnahmen nach Jahren des Exils nach Afghanistan zurückkehrt, gelingt es, filmische Bilder und Malerei auf eine Weise zu verbinden, die in der Tat Sehnsuchtsmotive vollendet ausbildet und zugleich negiert. Die traumwandlerische Ästhetik ist verführerisch und darin einzigartig aufklärend. ZeichenhandlungAnders als Hlali, die im Sinne der Videoästhetik mit intensiven Farben und beschleunigt ineinander fließenden Bildern arbeitet, nimmt die Künstlerin Lida Abdul (*1973) in ihrem Film „in transit“ (2008) bewusst Geschwindigkeit und Farbe heraus. „In Transit stopft eine Schar von Kindern zunächst ein völlig zerschossenes Flugzeugwrack auf einem Fußballfeld mit Baumwolle aus. Dann versuchen sie, das Wrack wie einen Drachen zum Fliegen zu bringen, indem sie an vorher angebrachten Seilen ziehen. So wird das Flugzeug einerseits zu einem Transportmittel der Phantasie, das sie aus ihrer Lage befreit und andererseits zu einer Metapher für die transitorische Kraft der Kunst.“ (G. Rückert) Die gleichnishafte Intensität der Szenerie verweist zurück auf den vorausgegangenen Schmerz, die Verletzungen und Wunden, indem sie Wege der Befreiung und Heilung andeutet. Die Kunst von Abdul könnte man vielleicht eine Form der ästhetischen Traumatologie nennen, oder wie sie selbst schreibt: Es geht um das Erbitten einer anderen Welt, eine momenthafte Zerschlagung all dessen, was bequem ist: „For me art is always a petition for another world, a momentary shattering of what is comfortable so that we become more sophisticated in reclaiming the present.“ (L. Abdul) CharaktereSurreal verstörend, böse ironisch und rätselhaft verdichtet sind die Bildfindungen des kanadischen Künstlers Marcel Dzama (*1974). Die Ausstellung zeigt fünf Papierarbeiten (2004) und eine phantastische Skulptur mit dem Titel „sower of discord“ (2008). Es ist die Verkörperung vom „Sämann des Zwists“, einer Figur aus Dantes Göttlicher Kommödie. Anders als in traditionellen Darstellungen zeigt uns Dzama nicht den Teufel, sondern ein Wesen, das selbst Täter und Opfer zugleich zu sein scheint, in Lumpen gehüllt, in sich gefangen, geklammert an ein Maschinengewehr, den nicht menschlichen Kopf wie ein verletztes Tier nach oben gereckt. Cheryl Kaplan schreibt zur Kunst von Dzamas: „[Sein] Sinn für ironische Kostümierungen, Irrungen, Tollheit und Wahnwitz sind wesensverwandt mit den poetischen Verwechslungsspielen in Shakespeares Sommernachtstraum, und dabei ist sein Sinn für das Makabre durchaus ausgeprägt. Amputationen, Blutbäder und tanzende Bären sind die Komponenten einer archaischen Handlung, in die gelegentlich auch Figuren der Literaturgeschichte, wie James Joyce einbrechen, der in jüngerer Zeit immer häufiger als Nebendarsteller in Dzamas Welt fungiert.“ [1] Die Kuratoren der Ausstellung verweisen zudem auf die Tradition der Bilderbögen: „Die Figuren, die die erzählerischen Arbeiten bevölkern, entstammen einer unerschöpflichen Phantasiewelt, deren dunkle Seite eine zentrale Rolle spielt. Die märchenhaften und komischen, bisweilen auch grausamen Zeichnungen erinnern an Bilderbögen des 19. Jahrhunderts: Maskierte und Bewaffnete, Tanzende und Fechtende, Liebende, Quälende und Gequälte – sie gehören einer Welt an, in der Gewalt und Krieg dominieren.“ Gewaltverhältnisse werden bei Dzama in mehrfacher Weise gespiegelt. Wie im Märchen ist nichts so wie es scheint, alles ist doppelbödig und birgt Gegenteiliges, das Tragische scheint komisch, das Komische scheint tragisch. PerspektivenImmer wieder meinen wir, angesichts von Krieg und Elend eine eindeutig ablehnende Haltung einzunehmen. Die Arbeit „Parallel Universes“ (2008) der libanesischen Künstlerin Randa Mirza (*1978) zeigt uns dagegen, dass wir immer auch Beobachter sind. Als Beobachter nehmen wir eine ästhetische Haltung ein, „touristisch“ in einem gedankenlose Sinne, „kritisch“ in einem reflektierten Sinn. Beides Verhalten ist dem Leid gegenüber letztlich gleichgültig. Mirza pointiert, ja überzeichnet dieses Moment von Grausamkeit, indem sie in dokumentarische Aufnahmen aus dem libanesischen Bürgerkrieg Fotos von Freizeittouristen hineinmontiert, die so angesichts der Situation von Krieg und Zerstörung dieselbe Haltung einnehmen wie vor einem malerischen Bergmotiv oder einer archäologischen Stätte. Wir leben vielleicht in einer Welt, aber wir erfahren sie so verschieden wie unterschiedliche Universen. BilanzenDas Ende ist immer offen und so ein relativer Anfang. Zugleich ist jedes Ende absolut ohne irgendeinen Anfang. Die Logik des Sterbens macht das Video „The End“ (2009) des niederländischen Künstlers Helmut Smits (*1974) sichtbar. Es beginnt mit dem Titel „The End“ und führt dann in der Form eines Filmabspanns vor schwarzem Hintergrund alphabetisch und nach Nationen geordnet unzählige Namen auf. Es sind die Namen der Soldaten, die während der Kriegsoperation „Enduring Freedom“, die nach dem Terroranschlag vom 11. September 2001 gestartet worden war, gestorben sind. Die Musik, die den Film untermalt, stammt aus dem Soundtrack des Films „Good morning, Vietnam“ (USA 1987). Smits Zwischenbilanz ist flüchtig und monumental, episch und analytisch, präzise und sensibel zugleich, ein eindrucksvolles Statement gegen jede Form der Rechtfertigung von Vernichtung. Die Ausstellung „Krieg/Individuum“ ist eine dichte, in hohem Maße überzeugende Ausstellung. Sie ist nicht nur ein Plädoyer zeitgenössischer Künstler für die Würde des Individuums und gegen den Krieg, sondern ein Plädoyer für die Zeitgenossenschaft der Kunst in Zeiten des Kriegs. Anmerkungen[1] "Meine Zeichnungen waren Rache und Strafe", Marcel Dzama im Gespräch mit Cheryl Kaplan, db artmag, http://dbkunst.medianet.de/dbartmag/archiv/2006/d/4/2/449.html |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/64/kw66.htm
|

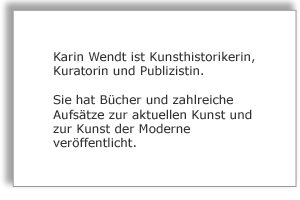 In einigen der jüngeren kuratorischen Konzepte bildender Kunst wird die Intention der Ausstellung als „Resonanzraum“ oder auch als „Interferenzraum“ beschrieben. So auch bei der von Susanne Düchting und Julia Wirxel kuratierten Gruppenaussstellung „Krieg/Individuum", die noch bis zum 25. April 2010 im AZKM in Münster zu sehen ist. In der Presseerklärung heißt es: „Die Ausstellung [...] will einen Resonanzraum bilden, in dem die Folgen und Auswirkungen kriegerischer Ereignisse für das Individuum, Gruppen und Gesellschaften des 20. und 21. Jahrhunderts sichtbar und bewusst werden. Die scheinbar sichere Distanz am Fernsehgerät oder beim Zeitung lesen soll von der Kunst aufgehoben werden.“
In einigen der jüngeren kuratorischen Konzepte bildender Kunst wird die Intention der Ausstellung als „Resonanzraum“ oder auch als „Interferenzraum“ beschrieben. So auch bei der von Susanne Düchting und Julia Wirxel kuratierten Gruppenaussstellung „Krieg/Individuum", die noch bis zum 25. April 2010 im AZKM in Münster zu sehen ist. In der Presseerklärung heißt es: „Die Ausstellung [...] will einen Resonanzraum bilden, in dem die Folgen und Auswirkungen kriegerischer Ereignisse für das Individuum, Gruppen und Gesellschaften des 20. und 21. Jahrhunderts sichtbar und bewusst werden. Die scheinbar sichere Distanz am Fernsehgerät oder beim Zeitung lesen soll von der Kunst aufgehoben werden.“