
Blindness and Insight |
Der Melancholiker im Flugzeug
Bemerkungen zu UP IN THE AIR (2009) von Jason ReitmanHans J. Wulff
Bingham verdient sein Geld in einer Firma, die im Auftrag von anderen Firmen, für die Bingham und andere Spezialisten unterwegs sind und die davor scheuen, die „Vertragsauflösungen“ selbst auszusprechen, Angestellten kündigen, die oft schon seit vielen Jahren für ihre Firmen arbeiten. Bingham ist transition counsellor („Übergangsberater“), wie man diesen Beruf zynischerweise nennt. Einer, der für eine erste Firma arbeitet, kündigt einem anderen, der für eine andere Firma arbeitet. Schon diese eigenartige Auslagerung der unangenehmen Begegnung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern deutet auf das Spiel der Verdoppelungen und Maskierungen, aus denen der Film sein bitter-komisches Potential bezieht. Es geht in den separation meetings (so werden Entlassungsgespräche im Jargon des Managements genannt) um die Formalisierung elementarster Beziehungen zwischen Firmen und ihren Angestellten - und damit um Widersprüche, die erst im Spätkapitalismus offen zu Tage treten. Die Rede von der corporate identity und einer auch emotionalen Bindung der Angestellten an ihre Firmen erweist sich als scheinhaft, als Lüge, die darüber hinwegtäuscht, dass Leute aufgrund ihrer Arbeits- und der darin berechenbaren Produktivkraft im Beschäftigungsverhältnis sind. Alle subjektive Identifizierung mit der Firma, alles Vertrauen darauf, dass man einen Schutz vor der Kündigung erwirbt, wenn man über Jahre seine Arbeit macht, ist nur einseitig. Eine Arbeit zu machen, in einer Firma beschäftigt zu sein, ist die vielleicht zentralste Tatsache, aus der Identität entstehen kann. Sich selbst in der Realität definieren zu können, ist gebunden auch an jene Bindung von einzelnen an ihre Firmen (mit durchaus auch materiellen Implikationen, vom eigenen Haus bis in die Finanzierung der Erziehung und Ausbildung der Kinder). Binghams Chef Craig Gregory (gespielt von Jason Bateman) stellt einmal ganz en passant fest, dass die Wirtschaft in der Krise stecke und seine Firma darum die vielen Aufträge kaum erfüllen könne. Zynischer läßt sich die immer größere Fragilität der Arbeitsbeziehungen kaum resümieren. Man spricht heute manchmal vom „Humankapital“ und bezeichnet damit in der Betriebswirtschaft einen eigenen, an das Wissen und die Kompetenz der Mitarbeiter gebundenen Produktionsfaktor, der neben der sächlichen und finanziellen Ausstattung von Firmen für deren Produktivkraft verantwortlich ist. Das Wort wurde 2004 zum „Unwort des Jahres“ erklärt - in einer solchen Redeweise degradiere man Menschen „zu nur noch ökonomisch interessanten Größen“, lautete die Begründung der Gesellschaft für deutsche Sprache. Up in the Air handelt von dieser Degradation, aber der Film ist keine platte Kapitalismuskritik. Einer Arbeit nachzugehen, eine Arbeitsstelle zu haben, hat in allen Industriegesellschaften zutiefst subjektive Bedeutungen, hängt eng mit den Lebensentwürfen der Arbeitenden zusammen; und es geht um viel basalere Dinge als um die Hoffnung auf Kontinuität und Stabilität. Bingham weiß um die individuellen Bedeutungen der Kündigung wie kaum ein zweiter. So smart, glatt und professionell er äußerlich wirkt, so sehr kann er sich vermeintlich in die Rolle seines jeweiligen Gegenübers hineinversetzen. Er weiß, welche Katastrophe er mitzuteilen hat. „Wir sind dazu da, die Vorhölle erträglich zu machen“, sagt er einmal. Aber er versucht zu mildern, manchmal sogar zu verkehren. Eine Arbeit aufzugeben, kann auch die Chance sein, das eigene Leben neu zu ordnen - zumindest suggeriert Bingham einem älteren Mann, dessen Personalakte er genau studiert zu haben scheint, zu seinem jugendlichen und nie realisierten Traum, Koch zu werden, zurückzukehren. Das Gespräch kann aber auch fatal enden: Einer jungen Kollegin erwidert einmal eine Frau, sie werde sich von der Brücke neben ihrer Wohnung stürzen; sie begeht tatsächlich Selbstmord; Binghams Kollegin ist bestürzt, sie hatte offenbar nicht damit gerechnet, dass der Ernstfall eintreten könnte. Sie ist frisch aus dem Studium in Harvard gekommen, einen glänzenden Abschluss in der Tasche; aber sie hat noch nie gearbeitet, ist in Binghams Firma gerade angefangen und soll als seine Begleiterin das professionelle Kündigen erst erlernen. Sie ist durch die Fassungslosigkeit mancher ihrer Klienten ebenso schockiert wie durch die Wut anderer, ihr Schweigen oder die Drohung, sich etwas anzutun. Von den biographischen Bedeutungen, die Arbeit hat, hat die junge Frau keine Ahnung; und sie weiß auch nichts von der Rolle, die Arbeit in der Identitätskonstruktion von Menschen gerade in postindustrieellen Gesellschaften hat. Dabei ist Natalie Keener (gespielt von Anna Kendrick) sogar der Vorbote einer noch weitergehenden Entfremdung der Arbeitsbeziehungen: Sie kam frisch von der Universität, als sie Binghams Chef vorschlug, die Kündigungen nicht mehr vor Ort vorzunehmen, sondern sie durch Videokonferenzen zu ersetzen - die Reisekosten der Firma könnten so auf 15% des bisherigen Umfangs reduziert werden. Der Film zeigt in seinen bedrückendsten Szenen einige Testläufe des neuen Verfahrens - und angesichts der Hilflosigkeit der Reaktionen der Gekündigten wird die Abwesenheit eines realen Gegenübers zu einem Moment größter empfundener Einsamkeit. In einem der Tests sitzt der Gekündigte hinter einer Milchglasscheibe dem Kündiger eigentlich gegenüber; aber er kann ihn nicht sehen. Der Film zeigt ihn als gerastertes Monitorbild; der Eindruck seiner Verlassenheit und Einsamkeit könnte kaum intensiver sein als im Rückschnitt auf Keener, die ihrerseits nur noch ihrem Ablaufplan für derartige Gespräche folgen kann, ebenso hilflos ist wie der Mann hinter der Scheibe, der sie nicht sehen kann. Im letzten Bild der kleinen Sequenz sehen wir den Mann mit hängenden Schultern herausgehen, hinter Keener, Bingham und dem Monitor. Dass Bingham Keener bestätigt, sie habe ihre Arbeit gut gemacht, vermag sie kaum zu trösten. Die Szene ist zugleich eine Station der Krise, die Keener durchmacht und die sie am Ende die Firma verlassen läßt. Eingangs der Geschichte hatte sie sich ebenso schnell wie ungerührt in die Aufgabe, Kündigungen zu rationalisieren und so weit zu formalisieren, dass sie letztlich von einem Online-Arbeitsplatz erledigt werden könnte, eingefunden; am Anfang stimmte der Macher-Habitus, mit dem sie auftrat, mit den heute so angesehenen Idealen der Coolness und eines übertriebenen Produktions-Rationalismus überein. Erst im Verlauf der Geschichte zeigt sich unter der Oberfläche eine tiefe Naivität, die die Strukturen, an denen sie selbst mitgearbeitet hat, weder beherrschen noch mittragen kann. In der symbolischen Welt von Gewinnen und Renditen, von Statussymboliken und Selbstinszenierungen wird von der Tatsache, dass Arbeitsbeziehungen Beziehungen zu realen Menschen und nicht zu abstrakten Stellgrößen eines Produktionsapparates sind, radikal abgesehen. Die Auflösung der traditionellen Bindungen zwischen Firmen und Beschäftigten und der Übergang in eine Vielzahl von Niedriglohn-Beschäftigungen und nur kurzfristige („prekäre“) Beschäftigungsverhältnisse lassen sich so lange symbolisch für den einzelnen ausgleichen, solange er zu den Gewinnern der durchgängigen Kapitalisierung sozialer Beziehungen gehört, solange Geld ausreichend zur Verfügung steht und solange der einzelne sich nicht durch das Eingehen langfristiger ökonomischer Abhängigkeiten (bis zur Übernahme von Pflegeverpflichtungen) in Gefahr bringt. „Wir sterben alle allein“, gibt Bingham Keener einmal zu verstehen, für sich alle Pläne, das Alter in den Modellen der Familie zu planen, von sich weisend.
Keine Figur der Handlung hat die Modernisierung der Lebensweisen so weit internalisiert wie Bingham. Die Beziehungen zu seiner Familie hat er weitestgehend aufgegeben. Er ist überzeugter Single, wird selbst nach eigenem Bekunden niemals eine längere Beziehung eingehen. Sexualität ergibt sich aus zufälligen Begegnungen, ist auf momentanen Genuss und nicht auf längere Bindung hin orientiert. Er hat alle Objektbindungen zu seiner Wohnung aufgegeben. Seine Orte sind öffentliche Orte, in denen er sich kompetent und routiniert verhält. Es sind keine Orte des Verweilens oder gar Bleibens, sondern durchgängerische Zonen. Ob Bingham ein verborgenes Lust-Zentrum hat, ein Residuum von Hoffnung (oder von Angst), bleibt lange verborgen. Dass er Mitglied des Clubs der 10-Millionen-Flugkilometer-Reisenden werden will, kann nur ironisch verstanden werden - als extremste Manifestation einer Persönlichkeit, die sich ausschließlich durch Statussymboliken zu definieren scheint. Geradezu als Gegenmodell dient eine Bitte, die Bingham einer Freundin seiner Schwester für deren Hochzeit verschiedentlich erfüllt: Sie hatte ihm ein etwa halbmeterhohes Bild des zukünftigen Paares geschickt, das die beiden in einer fröhlichen Umarmung zeigt; Bingham soll das Bild vor signifikante Gebäude in den zahllosen Städten, durch die er kommt, halten und davon ein Photo machen, als seien die beiden auf dem Bild an jenem Ort gewesen. Bingham hat kein Interesse und kein Auge für das, was die Bilder für die Schwester bedeuten sollen; gleichwohl macht er die Bilder, die er - als sie am Ende heiratet - über eine Unzahl anderer Bilder auf einer Pinnwand heftet, die aus den ganzen USA stammen. Eine dramaturgische Inversion - es geht es darum, dem Vielreisenden eine Karikatur derjenigen, die nie reisen, weil sie das Geld dazu nicht haben, sich aber mit Symbolisierungen des Reisens ausstatten, entgegenzuhalten; mobil zu sein, ist aber auch diesen, in einer skurril anmutenden Verkehrung, ein Wert.
Die Begegnung mit Alex Goran offenbart aber noch eine zweite, tiefere und weitgehend verborgene Schicht der Bingham-Figur: Aus der zufälligen Bekanntschaft scheint sich Tieferes zu entwickeln. Die beiden schreiben sich SMS-Nachrichten, legen sogar ihre Reiserouten so, dass sie einander sehen können. Nichts stabilisiert eine Liebe so wie die Routine - eine tiefere Bindung entsteht, sacht und schleichend. Bingham unterbricht einen seiner Vorträge, auf denen er den Zuhörenden ein Leben ohne Bindungen nahezubringen sucht - seine Metapher ist ein Rucksack, in den seine Adressaten hineinpacken sollen, was ihnen wichtig ist und was sie komplett wegwerfen sollen, am Ende bindungslos werden, wie er selbst versucht, es zu sein. Er unterbricht und fährt zu der Adresse in Chicago, die er von Goran hat - sie öffnet und erweist sich zu seiner Überraschung als verheiratete Mutter mehrerer Kinder: Hinter der Maske der ungebundenen und libertinären Frau des Geschäftslebens zeigt sich eine zweite traditionell-bürgerliche Existenz. Ihr Verhalten in den Hotels ist reines Rollenspiel, ist eine Fiktion, in die sie nur zeitweise eintritt. Interessanterweise wirft das zweite Gesicht, das sie so lange vor Bingham und dem Zuschauer verborgen hatte, ein Rücklicht auf Bingham, der irritiert zurückweicht und die Wohnung verläßt. Damit endet eine Kette von Irritationen, die mit der Hochzeit der Schwester Binghams begann: Anders als in fast allen anderen Szenen des Films tritt Bingham in dieser Phase der Geschichte in ein familiäres soziales Szenario ein, nimmt Teil an dem Fest seiner Schwester, an dem nicht Anonymität, sondern Zugehörigkeit die Eingangsbedingung ist. Die Andersartigkeit des Festes, die inneren Bezüglichkeiten der Beteiligten, die immer die anderen adressierenden Formen des Tanzens und Feierns sind scharf gegen eine andere Festszene des Films gesetzt, die sich aus dem Besuch einer Party anläßlich einer Elektronikmesse ergab und die genau jene Unverbindlichkeit und Zufälligkeit der Teilnahme zeigt, wie sie auch Diskotheken, Clubs und anderen Orten einer urbanen Unterhaltungskultur eignet. Jene andere Seite, die Binghams Figur auch hat und die das moralische und sympathische Zentrum des ganzen Films bildet, ist schon lange vorher immer spürbar gewesen. Es mag paradox anmuten, dass er derjenige ist, der anders als alle anderen Beteiligten weiß, worum es geht. Bingham hat Einsicht in die Bedeutung, die die Kündigung für seine Gegenüber hat. Er weiß, dass sie Opfer von blinden ökonomischen Interessen sind und nicht Klienten in einem Personal-Gespräch. Er ist derjenige, der die Folgen des Gesprächs abzuschätzen und abzumildern sucht, der sich - darin einem Psychiater ähnlich - auf die Partner der fatalen Begegnung einzustellen sucht. Er ist derjenige, der Trost zu spenden sucht und Mut zuspricht. Er ist Bote und Vollstrecker der schlimmen Botschaft und zugleich Therapeut, Priester und sozialer Partner. Er ist derjenige, der die Entmündigung und Versächlichung der Angestellten im Gespräch zumindest partiell abmildert, versucht, die Würde des Gegenübers zu wahren. Er ist der Mediator zwischen der Brutalität der Arbeitswelt und der subjektiven Bedeutung, die Arbeit für alle Beteiligten genießt. Er betreibt all dieses professionell - er kann die so schwierigen Gespräche von sich abstreifen, wenn sie beendet sind, sie belasten ihn nicht länger. Genau diese Professionalität im Umgang mit seiner Arbeit wie die Ambivalenz der kurzfristigen Beziehungen, die er zu den Opfern einnimmt, ist der Anlaß für die Sympathie, die die Figur von Beginn an genießt. Zumindest glaubt man ihr die Doppelbödigkeit ihres Tuns. Das mag zumindest zum Teil dem überaus positiven Image von George Clooney geschuldet sein - denn tatsächlich ist das, was er anzubieten hat, eine rein formelhafte „Rhetorik der Hilfe“ und eigentlich eine Dreistigkeit. Andererseits wird Bingham gegen Ende mehrfach in Bildern gezeigt, die größte Einsamkeit auszudrücken scheinen - wenn er entdeckt hat, dass seine heimliche Liebe Goran doppeltes Spiel treibt, sehen wir ihn in einem beleuchteten Fenster in einem gewaltigen Bürohochhaus, eine einsame Figur, die nach draußen guckt. Würde der Film hier enden, entstünde der Eindruck eines tragischen Helden, der am Ende auch die letzte soziale Bindung verloren hat, auf die er Wert gelegt hat. Der Film geht aber noch weiter, endet über den Wolken. Das Reisen geht weiter: „Mich zu kennen heißt, mit mir zu fliegen“ - Binghams Lebensmotto gilt auch am Ende noch. Der Film beginnt konsequenterweise mit unkommentiert hintereinandergeschnittenen Aufnahmen von Gekündigten, zeigt gleich zu Beginn das Spektrum der individuellen und subjektiven Katastrophen, deren Anlaß das ist, was Bingham überbringt. Dass die Entlassenen von Laien dargestellt werden, die die Tatsache der Entlassung am eigenen Leibe erfahren haben, sei nur am Rande festgehalten. Gleichwohl wird so schon am Beginn des Films der Akzent gesetzt, dass sie die hintergründigen Protagonisten der ganzen Geschichte sind. Dass die Bilder der Titelsequenz, die Luftaufnahmen amerikanischer Städte und Wolkenbilder zeigen, mit Woody Guthries altem Arbeiterlied „This Land Is Your Land“ unterlegt sind, tut ein übriges - der Film stellt auch die Frage nach den tatsächlichen und im Alltäglichen spürbaren Machtverhältnissen in einem Land wie den Vereinigten Staaten.
In vielen Szenen und Dialogen nutzt Up in the Air den Wortwitz und die Prägnanz der Sprachspiele der screwball comedy. Ähnlich wie sie, die ja so oft von sozialen Gegensätzen und Widersprüchen handelte, bleibt auch Up in the Air am Ende verhalten und optimistisch; aber der Film gestattet dem Zuschauer einen Blick in innere Verfaßtheiten der amerikanischen Gesellschaft (und nicht nur dieser) auf dem Höhepunkt der Krise, die es in sich hat und die genaueres Hinsehen lohnt. Der Film ist auf der einen Seite eine Etüde in Kapitalismus. Auf der anderen betreibt er eine warmherzige Zuwendung zu Figuren, die alle Gefangene ihres Systems sind und die nur selten eine wirkliche Freiheit der Wahl haben, die dieses aber wissen und mit Zynismus, Ironie oder Melancholie auszugleichen suchen. Sie haben sich eingerichtet und versuchen, das beste aus dem zu machen, was sie vorfinden. Das mag resignativ klingen, wären da nicht immer wieder blitzlichtartig sichtbar werdende Löcher in den Masken, die die Figuren angelegt haben, durch die hindurch Energien und individuelle Lebensentwürfe sichtbar werden, die sich nicht den Formen unterworfen haben, die die Welt des neuen Kapitalismus allen aufzuzwingen sucht. Anmerkung: Das Motiv der Kündigung im Film
Filmographische Angabe Up in the Air (Up in the Air) USA 2009. R: Jason Reitman. B: Jason Reitman, Sheldon Turner, nach einer Romanvorlage von Walter Kirn (Mr. Bingham sammelt Meilen. Köln: Kiepenheuer & Witsch 2003; Orig.: New York: Doubleday 2001). P: Ivan & Jason Reitman, Jeffrey Clifford, Daniel Dubiecki, für Paramount/Cold Spring/Rickshaw. K: Eric Steelberg. S: Dana E. Glauberman. M: Rolfe Kent. D: George Clooney, Vera Farmiga, Anna Kendrick, Danny McBride, Jason Bateman, Sam Elliott. 110min. Farbe. FSK: ohne Altersbegrenzung. Prädikat: besonders wertvoll. US-Start: 23.12.2009. BRD-Start: 4.2.2010. |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/64/hjw10.htm
|
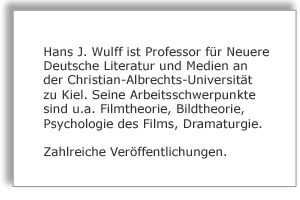 322 Tage im Jahr ist Ryan Bingham (gespielt von George Clooney) für seine Firma unterwegs - in Hotels oder auf Flughäfen, in den Firmen, für die er anreist, oder auf Parties; manchmal hält er auch Motivations-Vorträge in der Managerfortbildung. Er ist ein Profi. 322 Tage unterwegs - das heißt auch, dass er 43 quälende Tage in seiner Wohnung verbringen muss, einem spartanisch und nachlässig eingerichteten Appartement in Oklahoma. Bingham ist passionierter Vielflieger. Einmal gibt er als eines der Wunschziele seines Lebens an, er wolle die 10-Millionen-Meilen-Grenze überschreiten und damit zum Mitglied des höchst exklusiven Clubs der „Frequent Flyer“ werden; tatsächlich kann er auf einem Flug den Ausweis als Mitglied Nr. 7 vom Flugkapitän in Empfang nehmen.
322 Tage im Jahr ist Ryan Bingham (gespielt von George Clooney) für seine Firma unterwegs - in Hotels oder auf Flughäfen, in den Firmen, für die er anreist, oder auf Parties; manchmal hält er auch Motivations-Vorträge in der Managerfortbildung. Er ist ein Profi. 322 Tage unterwegs - das heißt auch, dass er 43 quälende Tage in seiner Wohnung verbringen muss, einem spartanisch und nachlässig eingerichteten Appartement in Oklahoma. Bingham ist passionierter Vielflieger. Einmal gibt er als eines der Wunschziele seines Lebens an, er wolle die 10-Millionen-Meilen-Grenze überschreiten und damit zum Mitglied des höchst exklusiven Clubs der „Frequent Flyer“ werden; tatsächlich kann er auf einem Flug den Ausweis als Mitglied Nr. 7 vom Flugkapitän in Empfang nehmen.

 Die Symboliken Binghams sind von ganz anderer Art, repräsentieren die Reisen selbst, den Luxus, den er genießt, den scheinbar unbegrenzten Zugang zu den Domänen des Reichtums und des unbegrenzten Konsums. Als er zufällig in einer Hotelbar die Geschäftsfrau Alex Goran (gespielt von Vera Farmiga) trifft, die ein ähnliches Leben auf Flughäfen und in Hotels zu führen scheint wie er, zeigen sich die beiden die verschiedenen Firmen- und Kreditkarten, die sie mit sich führen. Auch sammelt Bingham die Chipkarten aus teuren Hotels; mehrfach muß er mehrere Karten ausprobieren, bis er sein aktuelles Zimmer öffnen kann. Aparterweise sind die Szenen, die uns dieses sehen machen, immer Szenen, in denen er mit Goran in sein Zimmer einzutreten sucht, um mit ihr zu schlafen. Selbst der Vollzug von Sexualität wird so durch die exklusiven Objekte begleitet und aufgeschoben, die im Laufe eines Lebens als aufwendig Reisender anfallen. Das Begegnende sind Dienstleister; Gespräche über die Qualität von Autovermietungen etwa signalisieren jene besondere Art der Umweltwahrnehmung, die nicht an Szenarien, Orten der Schönheit oder der Ruhe interessiert ist, sondern ausschließlich an der effektiven Organisation von Bewegung.
Die Symboliken Binghams sind von ganz anderer Art, repräsentieren die Reisen selbst, den Luxus, den er genießt, den scheinbar unbegrenzten Zugang zu den Domänen des Reichtums und des unbegrenzten Konsums. Als er zufällig in einer Hotelbar die Geschäftsfrau Alex Goran (gespielt von Vera Farmiga) trifft, die ein ähnliches Leben auf Flughäfen und in Hotels zu führen scheint wie er, zeigen sich die beiden die verschiedenen Firmen- und Kreditkarten, die sie mit sich führen. Auch sammelt Bingham die Chipkarten aus teuren Hotels; mehrfach muß er mehrere Karten ausprobieren, bis er sein aktuelles Zimmer öffnen kann. Aparterweise sind die Szenen, die uns dieses sehen machen, immer Szenen, in denen er mit Goran in sein Zimmer einzutreten sucht, um mit ihr zu schlafen. Selbst der Vollzug von Sexualität wird so durch die exklusiven Objekte begleitet und aufgeschoben, die im Laufe eines Lebens als aufwendig Reisender anfallen. Das Begegnende sind Dienstleister; Gespräche über die Qualität von Autovermietungen etwa signalisieren jene besondere Art der Umweltwahrnehmung, die nicht an Szenarien, Orten der Schönheit oder der Ruhe interessiert ist, sondern ausschließlich an der effektiven Organisation von Bewegung. Die summa des Films bleibt dem Zuschauer überlassen. So sympathisch-glatt und am Ende sogar fragil die Figur Binghams auch ist, so vermeidet der Film eine allzu klare konservative Wendung am Schluß. Festzustellen, dass eine Identität, die sich nur in den Symboliken des Reichtums ausrichtet und die Ruhelosigkeit, die Orts- und Bindungslosigkeit des modernen Berufstätigen (zumindest im mittleren Management) hohl bleiben muß und notwendig in die biographische Krise hineintrudelt - das wäre zu einfach und angesichts der Realität der spätkapitalistischen Arbeitsverhältnisse illusorisch. Ebenso vermeidet der Film, offen für ein zynisches Verhältnis zur sozialen Realität der Arbeit zu plädieren (nur Binghams Chef vertritt diese Position und ist damit ein klare Antipathie-Figur) - das würde den Film zur Satire werden lassen. „Meine Filme sollen wie ein Spiegel funktionieren und dem Zuschauer den Blick auf sich selbst ermöglichen“, sagte Ivan Reitman in einem Interview (Berliner Zeitung, 4.2.2010).
Die summa des Films bleibt dem Zuschauer überlassen. So sympathisch-glatt und am Ende sogar fragil die Figur Binghams auch ist, so vermeidet der Film eine allzu klare konservative Wendung am Schluß. Festzustellen, dass eine Identität, die sich nur in den Symboliken des Reichtums ausrichtet und die Ruhelosigkeit, die Orts- und Bindungslosigkeit des modernen Berufstätigen (zumindest im mittleren Management) hohl bleiben muß und notwendig in die biographische Krise hineintrudelt - das wäre zu einfach und angesichts der Realität der spätkapitalistischen Arbeitsverhältnisse illusorisch. Ebenso vermeidet der Film, offen für ein zynisches Verhältnis zur sozialen Realität der Arbeit zu plädieren (nur Binghams Chef vertritt diese Position und ist damit ein klare Antipathie-Figur) - das würde den Film zur Satire werden lassen. „Meine Filme sollen wie ein Spiegel funktionieren und dem Zuschauer den Blick auf sich selbst ermöglichen“, sagte Ivan Reitman in einem Interview (Berliner Zeitung, 4.2.2010). Eine solche Konzentration der für viele realer werdenden Gefahr, den Arbeitsplatz zu verlieren, auf das entscheidende Entlassungsgespräch, wie Up in the Air es vornimmt, ist bislang in den Filmen, die sich der Entlassung und der folgenden Arbeitslosigkeit als dramatischem Stoff annehmen, noch nie erreicht worden. In den Filmen des Stoffkreises ist die Kündigung immer dramatischer Wendepunkt, Ausgangspunkt für verschiedenste Reaktionen. Manchen drohen in Lethargie unterzugehen (wie in Giorni e Nuovole / Tage und Wolken; Italien 2007, Mario Soldini), werden Amokläufer (wie schon in Hans Noevers Film Der Preis fürs Überleben, BRD 1980) oder begehen gar Selbstmord (wie in Tod durch Entlassung, aka: Jobkiller, Schweiz 2001, Christian Kohlund); manche gestehen der Familie die Tatsache des Arbeitsverlustes gar nicht erst ein und erhalten die Illusion regelmäßiger Arbeit weiter aufrecht (wie in L'emploi du temps /Auszeit; Frankreich 2001, Laurent Cantet) - ein Motiv, das übrigens schon 1953 in Georges Simenons Roman Maigret et ĺhomme du banc / Maigret und der Mann auf der Bank ausgeführt war. In der Komödie wird am Ende wiedereingestellt (wie in In Good Company / Reine Chefsache; USA 2004, Paul Weitz) oder die Familie hilft, die soziale und finanzielle Katastrophe zu überbrücken (wie in dem TV Film Vater Undercover - Im Auftrag der Familie, BRD 2006,Vivian Naefe). Die meisten der Geschichten spielen im Mittelschicht-Milieu der Höherbezahlten, der Management- und Führungsjobs. Die viel selteneren Filme, die die (Massen-)Entlassungen von Arbeitern thematisieren, handeln auffallend oft von der Solidarisierung der Entlasser mit den Opfern (wie etwa schon in Brassed Off, Großbritannien 1996, Mark Herman). Eigene Erwähnung verdient der Film Ressources humaines (1999, Laurent Cantet; der deutsche Fernseh- und DVD-Titel Der Jobkiller ist einigermaßen dümmlich und lenkt vom eigentlichen Thema des Films ab), der die Widersprüche zwischen der Realität der Arbeitswelt und subjektiven Lebensentwürfen als fatale Ungleichzeitigkeit von Aufstiegshoffnungen und den Bemühungen um Solidarität inszeniert. Er behandelte die Kündigung als spätakapitalistische Tragödie: ein Vater, der als Arbeiter jeden Groschen gespart hat, um seinem Sohn das Studium zu ermöglichen; ein Sohn, der nach dem Studium in der gleichen Firma Arbeit als Manager findet, in der auch sein Vater seit 30 Jahren arbeitet; und ein erster Arbeitsauftrag für den Sohn, eine Umfrage unter den Arbeitern zu organisieren - wovon er nichts weiß, ist, dass sie dazu dienen soll, die Arbeit durch Entlassungen zu rationalisieren; als der Sohn zufällig einen vertraulichen Brief im Computer des Personalleiters liest, entdeckt er, was das eigentliche Interesse an seiner Arbeit ist und dass auch sein Vater von den Entlassungen betroffen sein wird; der Sohn wechselt die Seiten, organisiert mit der Gewerkschaft einen Streik; er drängt den Vater, sich zu beteiligen - doch der sieht die Karriereaussichten seines Sohns gefährdet und weigert sich, den Streik zu unterstützen. Untersuchungen zum Stoff-Komplex stehen aus.
Eine solche Konzentration der für viele realer werdenden Gefahr, den Arbeitsplatz zu verlieren, auf das entscheidende Entlassungsgespräch, wie Up in the Air es vornimmt, ist bislang in den Filmen, die sich der Entlassung und der folgenden Arbeitslosigkeit als dramatischem Stoff annehmen, noch nie erreicht worden. In den Filmen des Stoffkreises ist die Kündigung immer dramatischer Wendepunkt, Ausgangspunkt für verschiedenste Reaktionen. Manchen drohen in Lethargie unterzugehen (wie in Giorni e Nuovole / Tage und Wolken; Italien 2007, Mario Soldini), werden Amokläufer (wie schon in Hans Noevers Film Der Preis fürs Überleben, BRD 1980) oder begehen gar Selbstmord (wie in Tod durch Entlassung, aka: Jobkiller, Schweiz 2001, Christian Kohlund); manche gestehen der Familie die Tatsache des Arbeitsverlustes gar nicht erst ein und erhalten die Illusion regelmäßiger Arbeit weiter aufrecht (wie in L'emploi du temps /Auszeit; Frankreich 2001, Laurent Cantet) - ein Motiv, das übrigens schon 1953 in Georges Simenons Roman Maigret et ĺhomme du banc / Maigret und der Mann auf der Bank ausgeführt war. In der Komödie wird am Ende wiedereingestellt (wie in In Good Company / Reine Chefsache; USA 2004, Paul Weitz) oder die Familie hilft, die soziale und finanzielle Katastrophe zu überbrücken (wie in dem TV Film Vater Undercover - Im Auftrag der Familie, BRD 2006,Vivian Naefe). Die meisten der Geschichten spielen im Mittelschicht-Milieu der Höherbezahlten, der Management- und Führungsjobs. Die viel selteneren Filme, die die (Massen-)Entlassungen von Arbeitern thematisieren, handeln auffallend oft von der Solidarisierung der Entlasser mit den Opfern (wie etwa schon in Brassed Off, Großbritannien 1996, Mark Herman). Eigene Erwähnung verdient der Film Ressources humaines (1999, Laurent Cantet; der deutsche Fernseh- und DVD-Titel Der Jobkiller ist einigermaßen dümmlich und lenkt vom eigentlichen Thema des Films ab), der die Widersprüche zwischen der Realität der Arbeitswelt und subjektiven Lebensentwürfen als fatale Ungleichzeitigkeit von Aufstiegshoffnungen und den Bemühungen um Solidarität inszeniert. Er behandelte die Kündigung als spätakapitalistische Tragödie: ein Vater, der als Arbeiter jeden Groschen gespart hat, um seinem Sohn das Studium zu ermöglichen; ein Sohn, der nach dem Studium in der gleichen Firma Arbeit als Manager findet, in der auch sein Vater seit 30 Jahren arbeitet; und ein erster Arbeitsauftrag für den Sohn, eine Umfrage unter den Arbeitern zu organisieren - wovon er nichts weiß, ist, dass sie dazu dienen soll, die Arbeit durch Entlassungen zu rationalisieren; als der Sohn zufällig einen vertraulichen Brief im Computer des Personalleiters liest, entdeckt er, was das eigentliche Interesse an seiner Arbeit ist und dass auch sein Vater von den Entlassungen betroffen sein wird; der Sohn wechselt die Seiten, organisiert mit der Gewerkschaft einen Streik; er drängt den Vater, sich zu beteiligen - doch der sieht die Karriereaussichten seines Sohns gefährdet und weigert sich, den Streik zu unterstützen. Untersuchungen zum Stoff-Komplex stehen aus.