
Communio |
Experimente
Vor OrtJörg Mertin
Als autonomes Kunstobjekt ist die gesamte Skulptur durchgehend funktional ein Raum der (inneren) Versenkung und der (äußeren) Stille und zeitweise funktional ein Raum für Gottesdienst. Während jene Besucher, die von der Ästhetik ausgehen und jene, die einen individuellen spirituellen Zugang nehmen, ihre Wahrnehmung weithin in einem organischen Zusammenhang mit dem Werk selbst entwickeln, scheint bei jenen Menschen, deren Fokus der kirchliche, gottesdienstliche Gebrauch ist, immer wieder die kreativ-widerständige Potenz des Raumes auf. Sie erkennen sofort, dass er anders als „normale“ Kapellen bzw. funktionsgleiche Räume ist. Tatsächlich ist seine vollendete Form ungewöhnlich, nämlich eine Ellipse, deren einer Brennpunkt durch die Steinskulptur bezeichnet ist. Seine äußere, hölzerne Begrenzung ist keine durchgehende, sondern eine durchbrochene Wand, die die Sicht zugleich verbirgt und freigibt. Ihm fehlen bis auf eine Ausnahme die standardmäßigen religiösen Symbole. Die innerkirchlichen, milieutypischen Reaktionen machen ein fundamentales kirchliches Syndrom identifizierbar. Der Raum entspricht nämlich nicht jener Raumerwartung, die sich heute weithin über die vorhandenen Kirchen und Kapellen gelegt hat. Erwartet und eingefordert wird ein Binnenraum, der von der Außenwelt getrennt ist und allenfalls durch farbig-symbolisch gestaltete Fenster eine mediale Verbindung zur Außenwelt erlaubt. Psychologisch gesehen handelt es sich bei diesen Erwartungen um den Wunsch nach Regression, genauer nach Rückkehr in den bergenden Mutterleib. Genau diesen Wunsch macht die Raumskulptur von Susanne Tunn erkennbar, und gleichzeitig verweigert sie die Wunscherfüllung. Stattdessen bietet die Skulptur Schutz und offene Beziehung, Rückkehr nicht ohne Aufklärung, eine relative, immer auch transparente Geschlossenheit, mit anderen Worten: ein Raummodell, das die Beziehung zur Außenwelt als Bestandteil der Innerlichkeit behauptet. Es ist zwar bedauerlich, aber muss auch nicht verwundern, dass es bisher keine akzeptierte Vereinbarung gibt, die vollendete ästhetische Form auch in der gottesdienstlichen Nutzung zu respektieren. Liturgen etwa greifen nach eigenem Gutdünken in den Raum ein. Zwar ist es so gut wie ausgeschlossen, die Raumskulptur im Sinne des Regressionswunsches zu verändern. Aber es zeigen sich sehr deutliche Tendenzen, den Raum "normalen" Kirchenräumen anzugleichen, von denen man die Bilder im Kopf hat. Das verweist sowohl darauf, dass der Raum von der Konvention abweicht, aber auch darauf, wie sehr manche Geistliche heute eine Übereinstimmung mit Hergebrachtem anstreben und wie sensibel und nervös sie auf Abweichungen reagieren.
Während die von der Skulptur vorgegebene Sitzordnung historisch betrachtet ein Zitat des Hochchors der alten Kathedralen ist, in dem das Domkapitel sich von gleich zu gleich gegenübersaß und heute als eine demokratische Ordnung des Gegenübers erscheint, bildet die Ordnung der eingebrachten Stühle das Gefälle von Priester und Laien ab. Die Laien sitzen dem Priester gegenüber, sehen ihn bei seinen Verrichtungen und lauschen seinen Worten. Es ist die Form der Wegekirche, die wie in einem unbewussten Zwang über die räumlich gegebene Ordnung gelegt wird. Diese Korrektur richtet die Menschen aus und ordnet sie priesterlicher Dominanz unter. Der Eingriff wird von denen, die ihn durchführen, als völlig selbstverständlich angesehen. Sie können sich gar nicht vorstellen, einen Gottesdienst in der durch den Raum vorgeschlagenen Ordnung zu feiern. Hinzu kommt vielleicht noch, dass durch die zusätzlichen Stühle der Raum mit Gegenständen gefüllt wird, zum Teil auch künstlich verkleinert wird im Sinne eines Stuhlkreises. Es könnte durchaus sein, dass die reine elliptische Form, die eine Fläche von ca 70 qm umschließt, als zu groß oder zu leer empfunden wird. Der Hang zu Stuhlkreisen, zu Gemütlichkeit, Nähe und Enge, zu gefüllten Mitten, der horror vacui im kirchlichen Milieu ist bekannt. Unter ästhetischem Gesichtspunkt wird die ausgewogene Form des Raumes durch die zahlreichen Kleinskulpturen der Stühle gründlich gestört. Erscheint eine Kirche ohne Stühle undenkbar (obwohl die historischen Kirchen jahrhundertelang nicht bestuhlt gewesen sind), so erscheint auch ein Altar ohne Blumenschmuck unmöglich. Susanne Tunn hat aus der Steinskulptur eine sehr feine, ausdrucksstarke Oberfläche herausgearbeitet, die sich von derjenigen hergebrachter Altäre insofern unterscheidet, als sie nicht ganz eben ist. Susanne Tunn hat reliefartig Plateaus stehen lassen, die auf dem jeweiligen Niveau sehr glatt sind. Damit zeigt sie unter anderem, dass ihre Skulptur nicht in ihrem durchaus vorgesehenen Gebrauch als Altar aufgeht. Das ist letztlich so evident, dass sie selbst für jemanden, der sich nicht mit zeitgenössischer Kunst auskennt, zu etwas sehr Besonderem wird. Vielleicht deshalb meinen manche, dass diese Steinarbeit zu einem Altar umgestaltet werden muss, so wie man eben Altäre in Kirchen erwartet. So werden etwa für den Gottesdienst Tücher darüber gelegt, Kerzen und Blumen auf ihm abgestellt. Während Tücher und Kerzen nach dem Gottesdienst entfernt werden, bleiben die Blumen auch außerhalb der Gottesdienstzeiten öfter stehen.
Dass es im kirchlichen Bereich auch anders geht, zeigt das Beispiel des neuen, von Klaus Simon entworfenen Altars in der katholischen Kirche St. Helena in Rheindahlen, der "auch in Zukunft nicht mit Tischdecken oder Blumenschmuck bedeckt werden", sondern "als in sich stehende Aussage frei bleiben" soll. Die standardisierte Umgestaltung der Mindener Kapelle im Sinne der kirchlichen Konvention sieht dann so aus: Rechts vorne auf dem Stein steht eine Vase mit einem Blumenarrangement, immer an derselben Stelle. Im Raum rechts vom Stein wird eine Dreiergruppe Stühle platziert, so dass sich eine diagonale Linie ergibt vom Kruzifix auf der linken Seite über die Blumen bis zu den Stühlen. Der Besucher wird auf Linie gebracht, schräg zum Raum, um den hölzernen Jesus und die Blumen anzubeten. Wohlgemerkt: Das ist die Situation außerhalb von Messen und Gottesdiensten. Diese Sakralisierung formaler Ästhetik ist ein dezidierter Widerspruch gegen den Willen der Künstlerin und gegen den Sinn des Raumes. Ohne einen stechenden Schmerz lässt sich so etwas in ästhetischer Hinsicht nicht betrachten.
Ist die Wahrnehmung der Skulptur durch kirchlich geprägte Menschen außerhalb von Gottesdiensten manchmal verengt, so ist sie es im Blick auf die Liturgie noch viel mehr. Die inneren Bilder der religiösen Konvention lassen eine wirkliche Wahrnehmung dessen, was vor Augen ist, offenbar kaum zu. Die Konvention wirkt als Wahrnehmungssperre. Liturgie (und der daraus erwachsende Umgang mit dem Raum jenseits des Gottesdienstes) vollzieht dann, gefühllos für das ästhetische Raumkonzept, eine einschneidende, rücksichtslose Überlagerung und temporäre Beschädigung des Ästhetischen. Das ist im konkreten Fall sogar die erklärte Absicht der beteiligten kirchlichen Institutionen: Gegen den ausdrücklichen Willen der Künstlerin versuchte die Kirche anzuordnen, dass dauerhaft mehrere Stühle in diesem Raum verbleiben sollten. Aggressiv sollte klargestellt werden, dass der Raum der Kirche gehört und dass sie ihn gestalten kann, wie sie will. Natürlich läßt sich das unter anderem aus urheberrechtlichen Gründen nicht durchführen. Aber der Versuch macht deutlich, wie Kirchen in manchen Fällen ausdrücklich gegen die Zumutungen und Herausforderungen der zeitgenössischen Ästhetik kämpfen. Dabei würde der Respekt vor der Autonomie der Kunst etwas sehr Bedeutsames wieder zum Leben erwecken, nämlich die ursprüngliche christliche Raumerfahrung. Denn im Ursprung christlicher Raumnutzung ist die Raumform zufällig und von dem, was darin geschieht (Mahlfeier und Verkündigung), unabhängig. Doch scheint das inzwischen kaum noch zugänglich zu sein, obwohl die protestantische Raumauffassung diese Ursituation im Grunde lebendig gehalten hat. Es ist aber vielleicht erklärbar, warum das nicht mehr verstanden wird. Denn man möchte gerne den Raum als Demonstration kirchlicher Macht und kirchlichen Einflusses haben. Daraus entsteht die nunmehr konventionelle Wahrnehmungsnorm als Resultat einer jahrhundertelangen Gewöhnung an eine angenommene substantielle, in religiösen Symbolen präsentierte Heiligkeit des Raumes, die aber letztlich nur kirchliche Machtsymbolik repräsentiert. Während die autonome Raumskulptur von Susanne Tunn den Weg zur ursprünglichen Unabhängigkeit von Raum und religiöser Handlung freimacht, erlebt man in der kirchlichen Praxis den Versuch, die entsprechende Wahrnehmung zu begrenzen, sie autoritativ und gleichzeitig fürsorglich im Sinne der historischen Konvention zu lenken. Mit den Eingriffen soll das, was zeitweise zum Gebrauch gegeben ist, in etwas Eigenes verwandelt, kirchlich angeeignet werden. Die autonome Raumskulptur berührt das religiöse Grundproblem des Umgangs mit dem, was uns gegeben ist. Ich zeige im folgenden, dass selbstverständlich der Gottesdienst ohne jeden Eingriff auch mit der gegebenen Raum- und Steinskulptur gefeiert werden kann, und zwar so, dass man ihre Formen und ihre irreduziblen materiellen Eigenarten wahrnimmt und respektiert. Im Bewusstsein, dass hier etwas vorgegeben ist, das wir nicht mehr schöner machen können, im Gedanken daran, dass der Raum uns einen Vorschlag macht, wie wir miteinander umgehen können, lassen sich hier Gottesdienste feiern. An dieser Stelle erscheinen Elemente des Communio-Gedankens aus der römisch-katholischen Kirche hilfreich. Susanne Tunn hat die Skulpturen ohne Kenntnis des Communio-Gedankens realisiert. Und doch entspricht der Raum erstaunlich präzise der Form, die die Vordenker der Communio favorisieren, nämlich der Ellipse. Wenn man so will, hat man eine Migration der Form vor sich. Zu dieser Form kommt der Liturg aus anderen Gründen als die Künstlerin. Wir müssen diese Prozesse hier nicht diskutieren, vielmehr geht es darum, mit der entdeckten Übereinstimmung zu arbeiten. Für eine communio-orientierte Liturgie in der römisch-katholischen Kirche wird ein elliptisches Raummodell mit zwei Brennpunkten diskutiert, wobei sich im einen Brennpunkt der Altar, im zweiten der Ambo befindet. „Wenn die Feier der Liturgie als ein Handeln inmitten der Gemeinde verstanden wird, weil Jesus Christus im Geist Gottes eben inmitten der Versammlung zugegen ist, dann dürfte eigentlich nicht der Altar den Mittelpunkt des Raumes bilden, wie dies bislang als idealtypisch verstanden wird. Wünschenswert erscheint dann vielmehr ein Handlungsraum in der Mitte der Gemeinde. Diese Mitte ist dann weniger zum Kreis entfaltet, dessen Zentrum alle Aufmerksamkeit auf einen Punkt lenkt, auf den Altar, sondern eher zu einer Ellipse, die sowohl Brennpunkte als auch einen Schwerpunkt besitzt.“ Ein vergleichbarer Raum war der Chorraum mittelalterlicher Kathedralen, der Altar und Ambo auf beiden Enden der Mittelachse hatte, während die Teilnehmer sich gegenüber saßen. Der polyzentrische Raum mit mehreren Handlungsschwerpunkten entspricht einer Kirche, die eine innere Mitte kennt und Raum lässt zur Entfaltung von Vorgängen. Einer so verstandenen Kirche entspricht hingegen nicht die vollständige Zentrierung und Ausrichtung aller Plätze auf den Tisch des Altars. „Der Raumgedanke des Zusammenseins mit der Gegenwart des Herrn ist schlecht interpretiert in einer Baugestalt, die nur nach vorn oder darüber hinaus und nach oben führt.“ (Klemens Richter) Es bedarf wohl keiner weiteren Erläuterung, um zu verstehen, dass die von Susanne Tunn konzipierte Skulptur diesen Überlegungen den Raum geben kann. Die Grundordnung des einander Gegenübersitzens entspricht im übrigen auch dem evangelischen Zentralgedanken des Priestertums aller Gläubigen aufs Schönste. Der den Gottesdienst leitende Liturg wird sich im Regelfall einfach zwischen die Teilnehmer setzen und kann so sichtbar Teil der Gemeinschaft sein. Das Gegenüber der beiden Sitzbänke befördert die Möglichkeit etwa des Wechselgesangs oder des Wechselgebets der Psalmen. Partizipation ist zwanglos möglich. Zur Eröffnung, zu den Lesungen und zur Predigt kann man eine Position im zweiten Brennpunkt der Ellipse, dem Stein gegenüber an der Eingangsseite der Skulptur einnehmen. Dazu kann ein Lesepult aufgestellt werden, doch ist dies nicht zwingend erforderlich. Die Feier des Abendmahls wird vom Stein ausgehen, ebenso ist das Fürbittengebet und der Segen von dort aus gut möglich. Die liturgischen Handlungen finden demnach in Bezug auf die Mittelachse der Ellipse statt und lassen die Mitte des Raumes leer, so dass Offenheit für die Gegenwart Gottes signalisiert wird. Das können alle Teilnehmer am Gottesdienst wahrnehmen und zugleich im körperlichen Kontakt mit der Raumskulptur den gesamten Raum erfahren. Das hier Geschilderte ist inzwischen in vielen Gottesdiensten in diesem Raum praktisch erprobt und hat sich bewährt. Es ist eine Weise, Gottesdienst zu feiern, die die ästhetische Autonomie des Raumes vollständig respektiert, liturgischen Erfordernissen genügt und sogar durch die Liturgie religiöse Tiefendimensionen sinnfällig macht. Raum, Religion und religiöse Handlung bleiben unabhängig voneinander und aktualisieren gleichzeitig eine temporäre Entsprechung. |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/60/jm10.htm
|
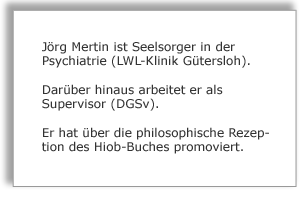 In der Krankenhauskapelle des neu erbauten Johannes Wesling Klinikums im ostwestfälischen Minden vollzieht sich seit der Eröffnung im März 2008 ein spannendes Experiment. Die autonome Raumskulptur der Bildhauerin Susanne Tunn ist zu einem Ort geworden, der vielfältige Weisen der Reaktion, der Nutzung und des Umgangs hervorruft. Ungeplante und unvorgedachte Möglichkeiten des Raumes selbst treten ebenso in Erscheinung wie normierende und genormte Erwartungen und Vorstellungen der Nutzer und Besucher. Man kann vom Glück erzählen, das manchen im Raum widerfährt, von Enttäuschungen, wenn der Raum sich inneren Bildern gegenüber sperrig zeigt, von unverständigen Versuchen, ihn gegen seinen Formsinn zu behandeln oder zu verändern, von unverstellter Neugier und Verblüffung, wenn man etwas sieht, was man so noch nie gesehen hat. Tatsächlich erweist sich der Raum im Umgang, mithin ex post, als in sich und gegenüber seiner Funktion autonom und bringt einen quer zu aller konzeptionellen Sorgfalt letztlich nicht konzipierbaren auratischen Ort hervor.
In der Krankenhauskapelle des neu erbauten Johannes Wesling Klinikums im ostwestfälischen Minden vollzieht sich seit der Eröffnung im März 2008 ein spannendes Experiment. Die autonome Raumskulptur der Bildhauerin Susanne Tunn ist zu einem Ort geworden, der vielfältige Weisen der Reaktion, der Nutzung und des Umgangs hervorruft. Ungeplante und unvorgedachte Möglichkeiten des Raumes selbst treten ebenso in Erscheinung wie normierende und genormte Erwartungen und Vorstellungen der Nutzer und Besucher. Man kann vom Glück erzählen, das manchen im Raum widerfährt, von Enttäuschungen, wenn der Raum sich inneren Bildern gegenüber sperrig zeigt, von unverständigen Versuchen, ihn gegen seinen Formsinn zu behandeln oder zu verändern, von unverstellter Neugier und Verblüffung, wenn man etwas sieht, was man so noch nie gesehen hat. Tatsächlich erweist sich der Raum im Umgang, mithin ex post, als in sich und gegenüber seiner Funktion autonom und bringt einen quer zu aller konzeptionellen Sorgfalt letztlich nicht konzipierbaren auratischen Ort hervor. Sie bestücken den Raum in aller Regel mit zusätzlichen Stühlen. Dies geschieht, obwohl die seitlichen Bänke bequem Platz für etwa 50 Menschen bieten, reichlich genug für Gottesdienste im Krankenhaus. Die zusätzlichen Stühle nun werden in unterschiedlichen Formationen aufgestellt, grundsätzlich aber so, dass eine andere Raumordnung aufgebaut wird, gegen die durch die elliptische Form vorgeschlagene. Zum Beispiel werden ca. 20 zusätzliche Stühle (siehe Abbildung) aufgebaut. Oder es wird ein Stuhlhalbkreis aus 6 bis zehn Stühlen vor den Stein gestellt. Manchmal findet man auch außerhalb der Gottesdienste ohne jede Dringlichkeit ein paar zusätzliche Stühle aufgestellt, in dreier oder vierer Gruppen, oder zwei neben einander. Alle diese Versuche einer Gegen-Raumordnung weisen bestimmte Merkmale auf: Die zusätzlichen Stühle etablieren eine auf den Stein und den Korpus ausgerichtete Sitzordnung. Als ob es den wunderbaren Bogen der Holzskulptur, der Sitzpositionen ermöglicht, von denen aus in alle Richtungen geblickt werden kann, sowohl zum Stein als auch zur gegenüberliegenden Seite, in der man also das Gesamte des skulpturalen Aufbaus erfassen kann und das Blickfeld weitet, nicht gäbe. Wichtig erscheint allein die Konzentration auf das vermeintliche religiöse Zentrum.
Sie bestücken den Raum in aller Regel mit zusätzlichen Stühlen. Dies geschieht, obwohl die seitlichen Bänke bequem Platz für etwa 50 Menschen bieten, reichlich genug für Gottesdienste im Krankenhaus. Die zusätzlichen Stühle nun werden in unterschiedlichen Formationen aufgestellt, grundsätzlich aber so, dass eine andere Raumordnung aufgebaut wird, gegen die durch die elliptische Form vorgeschlagene. Zum Beispiel werden ca. 20 zusätzliche Stühle (siehe Abbildung) aufgebaut. Oder es wird ein Stuhlhalbkreis aus 6 bis zehn Stühlen vor den Stein gestellt. Manchmal findet man auch außerhalb der Gottesdienste ohne jede Dringlichkeit ein paar zusätzliche Stühle aufgestellt, in dreier oder vierer Gruppen, oder zwei neben einander. Alle diese Versuche einer Gegen-Raumordnung weisen bestimmte Merkmale auf: Die zusätzlichen Stühle etablieren eine auf den Stein und den Korpus ausgerichtete Sitzordnung. Als ob es den wunderbaren Bogen der Holzskulptur, der Sitzpositionen ermöglicht, von denen aus in alle Richtungen geblickt werden kann, sowohl zum Stein als auch zur gegenüberliegenden Seite, in der man also das Gesamte des skulpturalen Aufbaus erfassen kann und das Blickfeld weitet, nicht gäbe. Wichtig erscheint allein die Konzentration auf das vermeintliche religiöse Zentrum.  Man findet also mehr oder weniger große Vasen mit mehr oder weniger schönen und kurzzeitig frischen Blumen aufgestellt, die alle schon auf den ersten Blick deplatziert und unglücklich wirken. Denn sie sind der nach Abzug von Tüchern und Kerzen verbleibende traurige Rest des Altarschmuckes, ein hilflos verzweifelter Versuch, den Stein als kirchlichen Altar erscheinen zu lassen. Isoliert betrachtet definiert das Aufstellen von Blumen das, worauf die Blumen stehen, als Unterlage. So wird die Steinarbeit der Künstlerin durch die Aufstellung eines Blumenarrangements unweigerlich zur bloßen Unterlage für Verschönerung. Im Grunde ist für jeden spürbar, dass da etwas nicht stimmt. Die Arbeit an sich ist kein Unterbau und bedarf keinerlei Verschönerung. Doch ohne Blumen ist der Eindruck „so nüchtern“, wie öfter vor allem von Theologen gesagt wird. In solchen Äußerungen bildet sich eine durch Konventionen stabilisierte und zugleich verzerrte Wahrnehmung ab, denn die Oberfläche des Steins ist ziemlich aufregend. Da man dies aber gar nicht realisiert oder versteht, sondern nur spürt, dass etwas Gewohntes fehlt, muss etwas hinzugefügt werden (auch stellvertretend für anderen Schmuck). Man macht sich dabei noch nicht einmal die gedankliche Mühe, besondere Blumen zu gebrauchen. Man könnte etwa jeweils eine einzelne Rose auf den Stein legen, als eine zarte Geste des Schönen und Vergänglichen, so dass die Oberfläche des Steins in ihrer Sicht- und Fühlbarkeit nicht zu sehr beeinträchtigt, sondern vielleicht auf hintergründige Weise unterstrichen wird. Das ist aber noch nie der Fall gewesen. Die Blumen, die auf der Skulptur abgestellt werden, sind in aller Regel im Wohnzimmersinn „geschmackvolle“ Blumenarrangements, wie sie auf jedem konventionellen Kirchenaltar stehen könnten, der nichts anderes ist als eine kunstgewerblicher Unterbau für Bibel, Kerzen, Kreuz und Abendmahlsgegenstände.
Man findet also mehr oder weniger große Vasen mit mehr oder weniger schönen und kurzzeitig frischen Blumen aufgestellt, die alle schon auf den ersten Blick deplatziert und unglücklich wirken. Denn sie sind der nach Abzug von Tüchern und Kerzen verbleibende traurige Rest des Altarschmuckes, ein hilflos verzweifelter Versuch, den Stein als kirchlichen Altar erscheinen zu lassen. Isoliert betrachtet definiert das Aufstellen von Blumen das, worauf die Blumen stehen, als Unterlage. So wird die Steinarbeit der Künstlerin durch die Aufstellung eines Blumenarrangements unweigerlich zur bloßen Unterlage für Verschönerung. Im Grunde ist für jeden spürbar, dass da etwas nicht stimmt. Die Arbeit an sich ist kein Unterbau und bedarf keinerlei Verschönerung. Doch ohne Blumen ist der Eindruck „so nüchtern“, wie öfter vor allem von Theologen gesagt wird. In solchen Äußerungen bildet sich eine durch Konventionen stabilisierte und zugleich verzerrte Wahrnehmung ab, denn die Oberfläche des Steins ist ziemlich aufregend. Da man dies aber gar nicht realisiert oder versteht, sondern nur spürt, dass etwas Gewohntes fehlt, muss etwas hinzugefügt werden (auch stellvertretend für anderen Schmuck). Man macht sich dabei noch nicht einmal die gedankliche Mühe, besondere Blumen zu gebrauchen. Man könnte etwa jeweils eine einzelne Rose auf den Stein legen, als eine zarte Geste des Schönen und Vergänglichen, so dass die Oberfläche des Steins in ihrer Sicht- und Fühlbarkeit nicht zu sehr beeinträchtigt, sondern vielleicht auf hintergründige Weise unterstrichen wird. Das ist aber noch nie der Fall gewesen. Die Blumen, die auf der Skulptur abgestellt werden, sind in aller Regel im Wohnzimmersinn „geschmackvolle“ Blumenarrangements, wie sie auf jedem konventionellen Kirchenaltar stehen könnten, der nichts anderes ist als eine kunstgewerblicher Unterbau für Bibel, Kerzen, Kreuz und Abendmahlsgegenstände. 