
Kirchenbau Regulativ |
Reformen und Regulative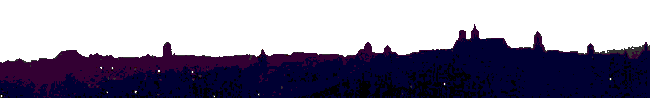
Die Botschaft der Kirchen nach dem Zweiten WeltkriegHorst Schwebel
1. Das Rummelsberger Programm 19511951 verabschiedete der Evangelische Kirchbautag auf der Tagung in Rummelsberg das „Rummelsberger Programm".[1] Der Kirchbautag ist eine Zusammensetzung von Kirchbauspezialisten innerhalb der Evangelischen Kirche, bei denen außer Theologen, Kirchenjuristen, Kirchbaudirektoren auch freie Architekten, Künstler, ein Denkmalpfleger und seit kurzem sogar ein Soziologe mitwirken. 1951 war Oskar Söhngen Vorsitzender der Kirchbautage, seit 1972 ist es Rainer Volp. Was wollte der Kirchbautag 1951 in Rummelsberg? „Er hat sich damit an eine Aufgabe gewagt, vor deren Inangriffnahme die Erfahrungen mit dem Eisenacher Regulativ von 1861 wie auch mit dem Wiesbadener Programm von 1891 und ähnlichen Versuchen warnen könnten. Nicht nur, dass etwa die Forderung des 3. Satzes des Eisenacher Regulativs, nach der sich der Kirchenbau an einen der geschichtlich entwickelten christlichen Baustile anzuschließen habe, die Verirrung der neugotischen Kirchbauten zur Folge gehabt hat, erhebt sich auch die grundsätzliche Frage, ob solche Regulative auf evangelischen Boden überhaupt möglich sind und was man gegebenenfalls von ihnen erwarten darf. (S. 286) Der Evangelische Kirchbautag ist eine Gruppe von Personen ohne offizielle kirchliche Beauftragung. Ihr Wirken, ihr Einfluss hängt heute wie damals an der Qualität ihrer Visionen und Argumente. Beim Eisenacher Regulativ 1861[2] handelte es sich um eine Stellungnahme der damaligen Deutschen Evangelischen Kirche. Die Zusammensetzung erlaubte, dass es zu einem „Regulativ" kommen konnte. In Rummelsberg war man vorsichtiger, weil man eine ähnliche Festlegung wie in Eisenach nicht wiederholen wollte. Man sah die Herausforderung, dass ein Bedarf bestand, neu zu bauen, weil unendlich viel zerstört war und weil zusätzlich die Flüchtlingsströme aus dem Osten kamen. Was und wie aber sollte man bauen? Um die Folie zu nennen, vor der man sich beim Rummelsberger Programm absetzen wollte, zitiere ich im Wortlaut den bereits erwähnten 3. Punkt des Eisenacher Regulativs. „Die Würde des christlichen Kirchenbaues fordert Anschluß an einen der geschichtlich entwickelten christlichen Baustile und empfiehlt in der Grundform des länglichen Vierecks neben der altchristlichen Basilika und der sogenannten romanischen (vorgothischen) Bauart vorzugsweise den sogenannten germanischen (gothischen) Styl." (S. 272) Hier wird also eine Präferenz für den gotischen Stil ausgesprochen, nach dem man sich in der Folge auch gerichtet hat. Demgegenüber lautet die Auskunft von Rummelsberg 1951: So etwas wie einen christlichen Baustil gibt es nicht. Das ist mehr als eine Ablehnung des Historismus. Vielmehr gilt, dass jede Zeit ihre eigenen Formen finden muss, in denen der christliche Gehalt zum Ausdruck gebracht werden soll. Diese Aussage ist keineswegs selbstverständlich. Eine byzantinische Kirche ist eine byzantinische Kirche, eine Moschee ist eine Moschee, ein buddhistischer Tempel ein buddhistischer Tempel. In anderen Religionen und auch in den morgenländischen Kirchen begegnen wir festen Stilen für Tempel und Gotteshäuser. In Rummelsberg hat man sich von einer festen stilistischen Eingrenzung gelöst. Dies gilt übrigens nicht nur für den evangelischen Bereich, sondern auch für den katholischen. Im Vaticanum heißt es (Konstitution über die Hl. Liturgie 22.11.1963, VII. De Arte Sacra): „123. Die Kirche hat niemals einen Stil als ihren eigenen betrachtet, sondern hat je nach Eigenart und Lebensbedingungen der Völker und nach den Erfordernissen der verschiedenen Riten die Sonderart eines jeden Zeitalters zugelassen und so im Laufe der Jahrhunderte einen Schatz zusammengetragen, der mit aller Sorge zu hüten ist.[3] Worin besteht denn nun die Orientierung, wenn es nicht der christliche Stil ist? Im Rummelsberger Programm heißt es: „Die gottesdienstliche Besinnung unserer Tage hat lang verschüttete Erkenntnisse über die Aufgabe und die Gestalt evangelischen Gottesdienstes wieder ans Licht gebracht. Dazu gehört auch die Einsicht, dass sich das Kirchengebäude und insbesondere der Kirchenraum vom Gottesdienst her bestimmen lassen müssen, der sich in ihnen vollzieht und dem sie gleichnishaft Gestalt geben sollen." (S. 286) Diese Formulierung „gleichnishaft Gestalt geben" kommt in diesem Programm öfter vor, bildet eine Art Leitmotiv. „Der gottesdienstliche Bau und Raum soll sich um seines Zweckes willen klar unterscheiden von Bauten und Räumen, die profanen Aufgaben dienen. Aber zugleich wächst er über jede rationale Zweckbestimmung hinaus, da er mit seiner Gestalt gleichnishaft Zeugnis von dem geben soll, was sich in und unter der gottesdienstlich versammelten Gemeinde begibt: nämlich die Begegnung mit dem gnadenhaft in Wort und Sakrament gegenwärtigen heiligen Gott." (ebd.) Das Sprechen von einer Raumgestalt, die „gleichnishaft Zeugnis geben soll", dient zur Abgrenzung gegenüber dem nur profanen Raum. Warum sagt man denn nicht gleich, der gottesdienstliche Raum soll kein profaner Raum sein, sondern vielmehr ein sakraler? Die Gegenüberstellung „sakral – profan" könnte man zwar vermuten, aber sie kommt im Rummelsberger Programm konkret nicht vor. Das Wort „sakral" wird nicht gebraucht. Der Hintergrund ist die protestantische Scheu, von einer dinglichen Sakralität zu reden, von einem Raum, der ausgegrenzt und von einer besonderen Heiligkeit wäre. Statt an dieser Stelle einen Dualismus zu installieren, spricht man davon, dass in Christus der Gegensatz von profan und sakral aufgehoben sei. Eine dingliche Sakralität würde die Welt zerspalten und das, was nicht als sakral einzustufen ist, als minderwertig hinstellen. Die Ablehnung der Vorstellung von einer „dinglichen Sakralität" macht es gleichwohl nicht überflüssig, das „Mehr" zum Ausdruck zu bringen, was den gottesdienstlichen Raum von einem anderen unterscheidet. Was unterscheidet den Kirchenraum von einem anderen Raum? Eben dies: dass er „gleichnishaft Zeugnis gibt."[4] In Rummelsberg wird also der Begriff „Sakralität" vermieden. Es geht um das Zeugnisgeben eines Geschehens, „nämlich die Begegnung mit dem gnadenhaft in Wort und Sakrament gegenwärtigen heiligen Gott" (ebd). Die Anknüpfung der Raumgestalt an den Gottesdienst ist eine gute Tradition. Man knüpft an Cornelius Gurlitt an, der 1906 auf dem 2. Kirchbaukongress in Dresden vom Kirchenbau als „gebauter Liturgie" sprach; ebenfalls an Otto Bartning, der forderte, dass die architektonische Spannung des Raumes der liturgischen Spannung entsprechen sollte.[5] Hier ist eine große Nähe zu einem vom Gottesdienst herkommenden Verständnis des Kirchenbaus, wie es in der ersten Hälfte des Jahrhunderts bereits vorbereitet war. Der Raum selbst, den Rummelsberg 1951 vorsah, ist ein gerichteter Raum mit einer Altarbühne, an deren Begrenzung zum Hauptraum als Ort der Predigt die Kanzel ihren Platz findet. Gottesdienst wird primär von der Wortverkündigung und dem Spenden der Sakramente her verstanden, wobei die Gläubigen - hintereinander gestaffelt sitzend und auf die Altarbühne ausgerichtet relativ unbeteiligt sind. Ihre Art, dem Gottesdienst beizuwohnen, entspricht der des Eisenacher Regulativs, wenn auch ohne Neugotik. Hier wurde die Chance, wirklich gottesdienstlich, also vom Vollzug her zu denken, vertan. Denn man knüpfte an einen Raum an, der nurmehr eine einzige Funktion hat, Wortverkündigung und das Spenden der Sakramente, wobei die vielfältigen Möglichkeiten, die versammelte Gemeinde gottesdienstlich oder architektonisch einzubeziehen, nicht thematisiert wurden. Man spricht auch noch nicht vom „Gemeindezentrum", sondern lediglich von der Kirche und deren „Anbauten". Eine weitere Besonderheit des Rummelsberger Programms ist die Unterscheidung von edlen und weniger edlen Materialien im Kirchenbau: „Die Verwendung von Kunststoff, wie z. B. Betonplatten, Eternit, Faserplatten oder Sperrholz, sind abzulehnen" (S. 81). Später fanden aber auch Beton, Plexiglas - für Altar, Kanzel, Taufstelle - und andere synthetische Materialien im Kirchenbau Eingang. In den 50er Jahren waren die Gottesdienste gut besucht. Es gab Gottesdienste mit 300 400, 500 Personen, denen heute 100, 40, 30, oder 20 Personen in den gleichen Räumen entgegenstehen. Dass man die Nachkriegskirchen aber so groß und nur auf eine Funktion hin gebaut hat, erweist sich heute als Problem. Zusammenfassend scheint mir am Rummelsberger Programm positiv zu sein, dass es erstens darauf verzichtet, einen christlichen Baustil zu fordern; dass es zweitens die Sakralraumprobleme andiskutiert, indem es auf den Begriff des Sakralen verzichtet und von einer gleichnishaften Raumgestalt spricht. Negativ finde ich die auf ein relativ fixiertes agendarisches Gottesdienstverhältnis hindeutende Monofunktionalität des Raumes, die Möglichkeiten des Begriffs Gottesdienst werden nicht voll ausgeschöpft. Unterscheidet man später lutherisch und reformiert, dann erscheinen die Konfessionen als Blöcke ohne Zwischenstufen. Womöglich wollte man den Gottesdienst als fixierte Größe verstanden wissen, um in bewegten Zeiten eine relativ konstante Orientierung für den Bau von Kirchen zu haben. 2. Kirchenbau nach dem 2. VaticanumDas zweite Vaticanum hatte innerhalb der katholischen Kirche eine große Wirkung, und zwar nicht allein der Text des Vaticanums, sondern auch die dazugehörigen Instruktionen (Durchführungsbestimmungen). Zur Konstitution Nr. 5 über die Heilige Liturgie aus dem Jahr 1963 kommen danach die Instruktionen zur ordnungsgemäßen Durchführung der Konstitution über die Heilige Liturgie. Sie wurde am 26. September 1964 von Kardinal Lercaro, dem Vorsitzenden der Ritenkongregation, vorgelegt und von Paul VI. abgesegnet. Im deutschen Bereich kommt es in der Frage der Raumgestaltung noch zu einem Erlass der Bischofskonferenz (vom 18.2.1964) und schließlich der Einführung in das Messbuch (Einsiedeln 1976). Auf die beiden letztgenannten Texte werde ich in diesem Zusammenhang nicht eingehen. Vielmehr richtet sich mein Interesse auf das Verhältnis der Vatikanischen Konstitution selbst zu dem, was die Instruktion daraus macht. Im Artikel Nr. 48 der Konstitution heißt es: „So richtet die Kirche ihre ganze Sorge darauf, dass die Christen diesem Geheimnis des Glaubens nicht wie Außenstehende und stumme Zuschauer beiwohnen; sie sollen vielmehr durch die Riten und Gebete dieses Mysterium wohl verstehen lernen und so die heilige Handlung bewußt, fromm und tätig mitfeiern, sich durch das Wort Gottes formen lassen, am Tisch des Herrenleibes Stärkung finden und Gott danksagen. Sie sollen die unbefleckte Opfergabe darbringen, nicht nur durch die Hände des Priesters, sondern auch gemeinsam mit ihm und dadurch sich selber darbringen lernen" (S. 53). Hier wird ein Grundsatz angesprochen, der der „tätigen Teilnahme". Die Gemeinde soll nicht Zuschauerin sein, sondern soll sich als Volk Gottes um den Tisch des Herrn bilden. Eine der diesbezüglichen Folgerungen aus der Konstitution lautet: „50. Der Mess-Ordo soll so überarbeitet werden, dass der eigentliche Sinn der einzelnen Teile und ihr wechselseitiger Zusammenhang deutlicher hervortrete und die fromme und tätige Teilnahme der Gläubigen erleichtert werde. Deshalb sollen die Riten unter treulicher Wahrung ihrer Substanz einfacher werden. Was im Lauf der Zeit verdoppelt oder weniger glücklich eingefügt wurde, soll wegfallen." (S. 54/55) Die Liturgie soll einfacher werden, Verdoppelungen sollen wegfallen. Im nächsten Artikel ist von der „Schatzkammer der Bibel" die Rede, „auf dass den Gläubigen der Tisch des Gottes Wortes reicher bereitet werde". (S. 55) Der Predigt, besser der Homilie, wird eine größere Bedeutung zugesprochen, die Muttersprache wird hervorgehoben - all dies geschieht aus dem Gedanken heraus, dass diejenigen, die hier teilhaben, auch mit dem Herzen dabei sind. Es geht um die eine Messe der Gläubigen, um die eine Opferfeier des Volkes Gottes, die das Geschehen und den Raum prägen soll, was unter anderem bedeutet, dass es nicht daneben noch andere Formen der Messe geben solle. Was geschieht, wenn man eine solche Vorstellung umsetzt? - In der Instruktion heißt es beim Thema „Die Raumordnung in der Kirche": „90. Werden Kirchen gebaut, erneuert und eingerichtet, so ist sorgfältig darauf zu achten, dass sie sich für eine wesengerechte Feier der heiligen Handlungen je nach deren Sinn und Anlage und für die Verwirklichung der tätigen Teilnahme der Gläubigen als geeignet erweisen".[6] In diesem Satz kommt es zu einer Konsequenz, die vorher noch nicht ausgesprochen war. Das Prinzip der „tätigen Teilnahme der Gläubigen" ist dann gültig, „wenn Kirchen gebaut, erneuert und eingerichtet werden". Das heißt, die Instruktion bezieht den Grundsatz der Konstitution nicht nur auf den Neubau, sondern auf jede Art von Erneuerung und Einrichtung einer Kirche. Ein weiterer Punkt lautet: „91. Der Hochaltar soll von der Rückwand getrennt sein, so dass man ihn ohne Schwierigkeiten umschreiten und an ihm zum Volk hin zelebrieren kann. Er soll so in den heiligen Raum hineingestellt sein, dass er wirklich die Mitte ist, der sich von selbst die Aufmerksamkeit der ganzen versammelten Gemeinde zuwendet." (S. 186) Der Altar, der als Tisch gedacht ist, soll „so in den heiligen Raum hineingestellt sein, dass er wirklich die Mitte ist". Damit wird die Abtrennung des Altartischs vom Hochaltar gefordert. Die Betonung der einen Opferfeier für die versammelte Gemeinde bedeutet dann folgerichtig: „93. Die Nebenaltäre sollen wenig zahlreich sein, ja soweit es die räumliche Anlage der Kirche gestattet, sollte man sie richtiger vom Hauptraum der Kirche getrennt in Seitenkapellen unterbringen." (S. 188) Man kann also den Grundsatz herauslesen: In jedem Raum nur ein Altar; und wenn es mehrere Altäre gibt, sollen sie in die Seitenkapellen gebracht werden.[7] Tritt der Altar in die Mitte des Raums, so fragt man sich, wo nun die Eucharistie aufbewahrt wird? „95. Die Heilige Eucharistie soll an einem festen und sicheren Tabernakel in der Mitte des Hochaltares oder eines besonders ausgezeichneten Nebenaltars aufbewahrt werden. Wenn rechtmäßige Gewohnheiten vorliegen, und in besonderen Fällen, die vom Ortsordinarius anerkannt werden müssen, ist die Aufbewahrung der Heiligen Eucharistie auch an einer anderen wirklich vornehmen und hergerichteten Stelle in der Kirche zulässig. Es ist erlaubt, die Messe zum Volk hin zu feiern, auch dann, wenn ein kleines, passendes Tabernakel auf dem Altar steht." (S. 190) Hier steht also die wichtige Formulierung: „Es ist erlaubt, die Messe zum Volk hin zu feiern" („Licet Missam versus populum celebrare"). Dies ist das erklärte Ziel, das auch in anderen Formulierungen genannt wird und das auch nicht durch ein Tabernakel auf dem Altar behindert werden soll. Mit der Versetzung des Tabernakels in eine Seitenkapelle bzw. an einen anderen würdigen Aufenthaltsort wird zusätzlich eine neue Aufgabe künstlerischer Gestaltung beschrieben, die in der Zukunft zu vielfältigen Formen von Tabernakeln geführt hat. Weiter ist vom Ambo die Rede, davon, dass man die Predigt gut hören sollte und die Plätze so ausgerichtet sein sollen, dass die Gläubigen mit Auge, Ohr und Herz an der heiligen Handlung teilnehmen können. Selbst Chor und Musik sollten im Angesicht der Gemeinde fungieren. Wenn wir nun die Grundsätze und Ausführungsbestimmungen zusammenfassen, haben wir tatsächlich einen Raum vor uns. Es ist ein Raum, zentriert auf Altar und Ambo. Hinter dem Altar zelebriert der Pfarrer als Vorsteher die Messe im Angesicht der Gemeinde. Der Vorsteher der Gemeindeversammlung (Priester) und die Gemeinde bilden eine Einheit. Verwirklicht ist ein Gedanke, den bereits 1922 Johannes van Acken in seinem Buch „Christozentrische Kirchenkunst" forderte, nämlich: Der Raum soll christozentrisch sein.[8] Aufgegriffen wird die „Circumstantes-Vorstellung" aus den Klöstern, wo die klösterliche Gemeinschaft den Altar „umsteht". Das sind Gedanken, die von den bedeutenden Kirchenbaumeistern des Katholizismus Dominikus Böhm, Rudolf Schwarz und später von Emil Stefan aufgegriffen wurden. In der Heilig-Geist-Kirche in Frankfurt hat Martin Weber bereits 1930 den Altar ins Zentrum gestellt und für die Gemeinde die „Circumstantes-Vorstellung" verwirklicht. Das Vatikanische Konzil und die Folgeinstruktionen haben 1963/1964 eine Praxis bestätigt, die von engagierten Theologen, Architekten und sonstigen Gläubigen bereits in den 20er und in den 30er Jahren beschritten wurde. 3. Gemeindezentrum und Mehrzweckraum-VorstellungAls das Rummelsberger Programm entstand, entsprach es bereits nicht mehr dem Standard damaliger Theologie. Die hier vertretene Gottesdienstvorstellung war in ihrer blockhaften Starre rückwärtsgewandt. Erst Mitte der 60er Jahre kam es zur Begegnung des evangelischen Kirchenbaus mit der Gegenwartstheologie. Es war die Zeit, in der man sich in Ansätzen um eine Reform des Gottesdienstes bemühte, ebenfalls die Zeit, in der die Diskussion um die Begriffe Entmythologisierung und Säkularisierung lief, die beide als positiv verstanden wurden (Bultmann, Gogarten). In der Folge führte dies zu einem veränderten Raumverständnis, das mit drei Fragestellungen verbunden ist: der Diskussion um den Sakralraum, dem Aufkommen des Agora-Gedankens und der theologischen Begründung des Mehrzweckraumgedankens. 3.1. Die Diskussion um den SakralraumWährend Oskar Söhngen in Anknüpfung an Otto Bartning mit der Mehrheit der Architekten den Begriff des „Sakralen" verteidigte, lehnten andere, eher liberalen oder reformierten Gedanken zugeneigte, Theologen und Architekten die Sakralität ab. Einer dieser Wortführer war Otto H. Senn,[9] ein bedeutender evangelischer Baumeister und Kirchbautheoretiker. Für Senn beginnt der „moderne Kirchenbau" bereits im 19. Jh. mit der von der Romantik vertretenen Idee, im Raum das spezifisch „Christliche" als das Sakrale aufzuzeigen. Nachdem man über den Historismus und Bestimmungen wie das Eisenacher Regulativ meinte, das „Christliche" in Formen historischer Architektur zur Darstellung bringen zu können, habe man im 20. Jahrhundert in einem zweiten Schritt das gleiche versucht, wenn auch auf anderem Wege: diesmal durch „Emanzipation von Historismus" (S. 19). Dieser zweite (emanzipatorische Teil des „modernen Kirchenbaus") sei aber - so Senn - noch immer an die falsche Vorstellung gekoppelt, dass man das „Christliche" in einer Baugestalt je fassen könne. Die durch Senn (Thomaskirche, Basel 1955) und in seinem Umkreis in der Nachfolge entstandenen Kirchen (Gemeindezentrum Steinhausen 1976/77 von Ernst Gisel u. a.) zeichnen sich durch vielfältige Grundrisslösungen und variable Sitzordnung aus, während sie im übrigen schmucklos und nüchtern sind und im Material und in der Durcharbeitung einen hohen Standard haben. Auch im katholischen Raum wurde der Begriff des Sakralen in Frage gestellt. Für den katholischen Theologen Günter Rombold kommt die „Errichtung ,sakraler' Bauten . . . dem Versuch gleich, dem modernen Menschen eine archaische Religiosität abzuzwingen".[10] Der Wiener Architekt Otto K. Uhl schreibt: „Im Christentum ist die Unterscheidung zwischen ,sakral’ und ,profan' grundsätzlich aufgehoben".[11] Das bedeutet für die Reformkatholiken keineswegs eine Preisgabe des Anspruchs an ein Kirchengebäude, denn der Verzicht auf die Vorstellung des Sakralen bedeutet keinen Verzicht auf die Vorstellung vom kirchlichen Handeln an der Welt. Für Herbert Muck, einen Vertreter der These von „Bauen als Prozess", ergibt sich die Baugestalt aus dem Zusammenwirken vielfacher kommunikativer Prozesse. Von diesem Ansatz her entwickelt Muck eine semiotische Kirchbautheorie.[12] 3.2. Agora-Gedanke und MehrzweckraumIn den sechziger Jahren bis Anfang der siebziger Jahre verlagerte sich der Schwerpunkt auf das kirchliche Gemeindezentrum. Stand bisher das Kirchengebäude im Mittelpunkt des Interesses, so wird beim Begriff „Gemeindezentrum" deutlich, dass kirchliches Handeln vielgestaltig ist und die sonntäglich-gottesdienstliche Funktion lediglich eine unter mehreren Formen kirchlicher Präsenz darstellt. Einen Gemeindesaal und Nebenräume für sonstige gemeindliche Veranstaltungen gab es auch schon vorher. Mit der Betonung auf „Gemeindezentrum" wurde auf die Dominanz des Kirchengebäudes zugunsten der Gesamtanlage mit ihren vielfältigen Funktionen bewußt verzichtet. Ein Grundgedanke war der, dass sich Kirche nicht allein im sonntäglichen Gottesdienst manifestiert, sondern dass hierzu eine Vielfalt an Dienstleistungen und sonstigen Angeboten gehört. Die Zeit der Errichtung von Gemeindezentren war die Zeit der neuen Rand- bzw. Satellitenstädte und die Zeit eines neuen gesellschaftlichen Aufbruchs, der mit Studentenbewegung und ihren Reformansätzen in allen Lebensbereichen verbunden war. Als „Kirche für andere" rückten soziale Verantwortung und Gesellschaftsdiakonie ins Zentrum des kirchlichen Handelns. Von den Niederlanden kam der Agora-Gedanke in die Bundesrepublik.[13] Die in den neuen Stadtgründungen des Flevoland-Polders geschaffenen überdachten Marktplätze" (die „Agoren" in Dronten und Lelystadt) gewannen symbolische Funktion. „Kirche als Agora" bedeutet, dass die Kirche in dem neu gebauten Stadtviertel einen Raum für zwischenmenschliche Kommunikation anbietet, ein Stück „Freiraum" in einer technokratisch verwalteten Welt. Mit diesem Programm weiterhin verbunden war der Abbau von „Schwellenangst", die Betonung des Foyers als Einladung an alle, die Bereitstellung vielfach zu nutzender Räume für mannigfache Kommunikation und damit der Verzicht auf eine betont kirchliche Präsentationsweise. Dem letztgenannten Grund sind als erstes - auch im katholischen Bereich - die Türme zum Opfer gefallen. Umstritten blieb, inwieweit der dem Gottesdienst vorbehaltene Raum - früher der eigentliche Kirchenraum - sich dem Stil des Gemeindezentrums anpassen oder ob er ein eigenes, im traditionellen Sinn „kirchliches Gepräge" beibehalten solle. Da der Begriff des Sakralen auch im Reformkatholizismus in Frage gestellt war, blieb die Auseinandersetzung nicht allein auf den evangelischen Bereich begrenzt.[14] Eine solche multifunktionale Nutzung des Gemeindezentrums bringt freilich auch Probleme mit sich. So ist es beispielsweise für eine Gemeindegruppe nicht mehr möglich, in ihrem Raum „Spuren" zu hinterlassen, weil der Raum anschließend von anderen gemeindlichen oder nichtgemeindlichen Gruppen auf andere Weise genutzt und mit anderen Räumen zusammengeschlossen wird. Das Institut für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart, ein EKD-Institut an der Marburger Universität, konnte in einer mehrjährigen Untersuchung von 17 Gemeindezentren mit Mehrzweckraum feststellen, dass es in allen Gemeindezentren die Tendenz gab, den zentralen Mehrzweckraum auf eine Funktion, nämlich den sonntäglichen Gottesdienst zu reduzieren und den Raum formal zu „resakralisieren" (durch ein Kruzifix oder sonstige Kunstobjekte, durch die Fixierung von Altar, Kanzel und Taufe, durch das Einbeziehen kostbarer Materialien und durch eine strenge Benutzungsordnung).[15] Der Verzicht auf Selbstdarstellung wurde theologisch mit dem „Kirche-Sein für andere" begründet, wobei für den Abbau der Schwellenangst die wertneutrale Erscheinungsform von Kirche und die Mobilität von Gestühl und Prinzipalstücken ethisch argumentiert wurde. Der Vorwurf, man habe sich seitens der Kirche einseitig dem Funktionsdenken verschrieben, verkennt die theologische Dimension der Argumentation. Auf der Kirchbautagung von Bad Boll (1965), die anlässlich des Kapellenbaus dieser Akademie durchgeführt wurde, ging es in einer ersten Argumentationsreihe um die Erweiterung des Gottesdienstbegriffs im Anschluss an Rom. 12,1.2 (ff) und 1. Petr. 2,8-3,9, wobei der Begriff „Gottesdienst" mit dem Begriff „Alltag" eng verbunden wurde. „Nichts ist im Neuen Testament heilig im Gegensatz zu einem profanen Bezirk bzw. besser gesagt, alles ist heilig, nichts ist mehr profan, weil Gott die Welt gehört und weil die Welt der Ort ist, an dem man Gott preisen und Gott Dank erweisen soll".[16] Die zweite Argumentationsreihe verläuft vom Auftrag als „Teilnahme an der Mission Gottes" als „dienende Präsenz (serving presence)" her. Das bedeutet, dass die Kirche von der Welt, vom „idiotes", dem Randsiedler, her zu denken sei (vgl. 1. Kor. 14,16-25). „Hier liegt die theologische Begründung der Forderung nach Flexibilität des gottesdienstlichen Lebens, und damit auch dem 'Provisorium' des kirchlichen Bauens als der architektonischen Ermöglichung der versammlungsmäßigen Stilverwandlung" (Werner Simpfendörfer, ebd.). Eberhard Weinbrenner, der spätere Erbauer der Kapelle der Akademie Bad Boll, griff den Gedanken des „baulichen Provisoriums" auf und entwickelte für den Gottesdienstraum folgende „bauliche Konsequenzen". „1. Ein mehrfach gerichteter Raum festlichen Charakters. Stützpunkt der Position von Bad Boll ist die Erweiterung des Gottesdienstbegriffes. Dabei wurde nicht danach gefragt, was Gottesdienst in seinen Erscheinungsformen, seiner Geschichte und seinem Wesen nach sei, sondern alles Gewicht lag darauf, in scharfer Abgrenzung gegen Kult und Sakralität die ethische bzw. sozialethische Dimension im Gottesdienstbegriff herauszuarbeiten: „Weltheiligung", „Sendung", „Dienst" usw. - Da wir in der glücklichen Lage sind, diese theologischen Positionen in ihren Folgen, ihrem baulichen Erscheinungsbild sozusagen, konkret vor Augen zu haben, ist es in diesem Fall leichter als andernorts, ihre Größe und Grenze zu überschauen. Der Ansatz ist ein ethischer bzw. sozialethischer; d.h. es wird gesagt, welche Forderung im Begriff „Gottesdienst" enthalten ist, nicht jedoch, was Gottesdienst als gnadenhaftes Geschehen bedeutet. Der Begriff „Gottesdienst" wird in Richtung auf Welt erweitert, ohne dass er in seiner Tiefendimension erschlossen würde. Er wird horizontalisiert, ohne vertikalisiert zu werden. Da vom Begriff Gottesdienst" nur die verpflichtende Seite gesehen wird, bleibt, wenn man ihn zur Bestimmung des kirchlichen Handelns heranzieht, in erster Linie die Verpflichtung zum allseitigen Dienst an den Menschen übrig. Das Warum und Wozu dieses Dienstes wird dann von den jeweiligen Bedürfnissen, Nöten und Erwartungshaltungen der Menschen abhängig. Funktionsfähige Räume zu bauen, um den vielfältigen konkreten Anforderungen zu genügen, war die Aufgabe. Die Forderung nach dem variablen Raum wurde auf dem Evangelischen Kirchbautag in Hannover (1966) von Lothar Kallmeyer in einem viel beachteten Vortrag auf moderate Weise in die Diskussion gebracht. Auf dem Kirchbautag in Darmstadt (1969), ein Jahr nach den Studentenunruhen, forderten bereits Theologiestudenten das „Ende des Kirchenbaus" zugunsten der Verwendung der finanziellen Mittel für Sozialleistungen und für die Dritte Welt. Im Kontext sozialer Nöte im eigenen Land und des Hungers und der Lage der 3. Welt erschienen der Kirchenbau und vollends die kirchliche Kunst als Ausdruck ethischer und theologischer Defizienz.[18] Die Herausforderung solcher Gedanken, deren ethischer Ernst nach wie vor unbestritten ist, wirkte sich auf das Schaffen von Räumen und das künstlerische Gestalten ausgesprochen negativ aus. Kreativität und künstlerische Gestaltung standen damals eo ipso unter dem Verdacht des Verrats an sozialer Verantwortung für das Ganze. Wenn überhaupt, ließ sich nur noch der nicht definierbare, neutrale, kunstlose, für vielfältige Zwecke nutzbare Raum als Gottesdienstraum verantworten: der „Raum als Instrument", nicht jedoch als „Symbol", „Gleichnis" oder gar als „Sakralraum". Der Mehrzweckraum-Gedanke scheiterte nicht an mangelnder theologischer Reflexion, sondern an einer falschen Einschätzung anthropologischer Gegebenheiten. Bei dem Gebäude, das als Kirche angesprochen werden soll, und bei dem Raum, in dem man Gottesdienst erlebt, besteht offensichtlich ein Bedürfnis nach Identifikation, das seitens des Mehrzweckraums nicht befriedigt werden kann. Während das Mehr an Freiheit als positiver Wert anzusprechen ist, ist gleichzeitig ein Verlust im Bereich der Sinn- und Wertsetzung und der emotionalen Identifikation zu verzeichnen.[19] 4. Die Wolfenbütteler Empfehlungen 1991Die bereits erwähnte EKD-Studie zur Raumnutzung hatte gezeigt, dass von Seiten der Gottesdienstbesucher die Mehrzweckräume in dieser Weise nicht angenommen wurden. Man wünschte offensichtlich Räumlichkeiten mit größerer Erkennbarkeit, Räumlichkeiten mit einer Identifikationsmöglichkeit. Zum einen kam es zu einer Abstimmung mit den Füßen, zum anderen in der Folgezeit zu einer Art Ästhetik, die das, was dem Raum zu fehlen schien, mit allen Mitteln neu einbringen wollte. Vergleicht man die Nicht-Akzeptanz der Mehrzweckräume mit den Theorien, die vorher genannt wurden, so ist ein Stück Tragik unverkennbar. Man wollte auf Repräsentation verzichten, die Schwellenangst verhindern[20] und dem Menschen ein größeres Maß an Freiheit gewähren. Aber die Betroffenen fragen nach der Unverkennbarkeit des Raums innerhalb der Stadt und offensichtlich auch nach dem „Mehr", das einen Kirchenbau von einem anderen Bau unterscheiden soll. Doch man verstehe dies nicht falsch: ein Zurück zu Rummelsberg war nicht gemeint. Die Gottesdienste sind vielfältiger geworden, bereichert durch Familiengottesdienste und Gottesdienste in neuer Gestalt, auch das Abendmahl wird auf vielfältige Weise gefeiert. Der neuen Herausforderung für die 90er Jahre versuchen sich die „Wolfenbütteler Empfehlungen an die Gemeinden", beschlossen vom Arbeitsausschuss des Evangelischen Kirchbautags am 12. April 1991, zu stellen.[21] Zu Recht stellte man fest, dass von Rummelsberg 1951 bis jetzt (1991) sich vieles ereignet habe, weshalb das Rummelsberger Programm überholungsbedürftig sei: „Die Rummelsberger Grundsätze für die Gestaltung des gottesdienstlichen Raumes der evangelischen Kirchen waren im Blick auf die Zeit der großen Kirchbautätigkeit nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs verfasst worden. Damals gab es einen außerordentlichen Bedarf an Ersatzbauten für zerstörte Kirchen. Aber auch durch die Umschichtung der Bevölkerung und das Anwachsen der Städte waren viele Kirchenneubauten notwendig geworden. Heute besteht nur in besonderen Fällen Bedarf nach einem Kirchenneubau. Die Aufgabe liegt vor allem darin, die vorhandenen Kirchenräume in der ihnen angemessenen Form für das sich wandelnde Gottesdienstverständnis der Gemeinde einzurichten. Dabei sind folgende Gesichtspunkte zu prüfen: Heutiger Gottesdienst kann sich, obwohl er seine Höhepunkte im Rahmen agendarischer Ordnung findet, auch in freieren Formen vollziehen: Familiengottesdienste, Dialoggottesdienste, Jugendgottesdienste, die von den Jugendlichen selbst gestaltet werden, Abendmahlsfeiern im großen Kreis oder an Tischen sowie in anderen liturgischen Formen und Festen. Diese erweiterten Möglichkeiten sollten in Gestaltung und Einrichtung des Kirchenraumes berücksichtigt werden" (S. 1). Danach wird auf die sechziger Jahre bzw. auf die im vorigen Kapitel beschriebene Entwicklung Bezug genommen: „Seit den sechziger Jahren wurden vor allem vielfältig nutzbare Gemeindezentren gebaut, um den unterschiedlichen von der Kirche übernommenen Aufgaben räumlich gerecht zu werden. Das entspricht einer Veränderung des kirchlichen Selbstverständnisses im Verhältnis von Kirche und Welt. Die Kirche hält auch weiterhin an ihrer Verantwortung für das Ganze der Gesellschaft - einschließlich der Randgruppen - fest, sucht aber nach neuen Formen. (ebd.) Mit der Öffnung zu Welt und Gesellschaft ist aufs engste die Annäherung der Konfessionen verbunden, die unter anderem "zur Errichtung von ökumenischen Gemeindezentren (evangelische und katholische unter einem Dach) führen kann" (S. 2). Man greift also den Gedanken der Öffnung positiv auf, akzeptiert auch die Vielfalt der Gottesdienste, trotzdem gibt es eine Gegengewichtung, insofern man der historisch überkommenen Baugestalt einen hohen Stellenwert beimisst: „Das Verhältnis der heutigen Menschen zur Geschichte kommt auch darin zum Ausdruck, dass Kirchen nicht nur als Orte des Gottesdienstes oder des stillen Gebetes aufgesucht werden. Als Stätten, an denen Bau-, Kunst- und Glaubensgeschichte aufs eindrucksvollste erfahren und als generationsübergreifende Kontinuität erlebt werden, ziehen die alten Kirchen auch kirchenferne Besucher an. Deshalb besteht über den Anspruch der feiernden Gottesdienstgemeinde und der Ortsgemeinde hinaus ein berechtigtes allgemeines Interesse an Erhaltung und Pflege." (ebd.) Trotz der Bejahung der Öffnung zur Welt legen die Wolfenbütteler Empfehlungen demnach großes Gewicht auf die Raumgestaltung und die Kunst. „Der gottesdienstliche Raum ist ein gestalteter Raum, der deutlich zu erkennen gibt, was in ihm geschieht. Er soll so beschaffen sein, dass in ihm durch Lesung, Predigt, Gebet, Musik und bildende Kunst das Wort Gottes verkündigt und gehört werden kann und die Sakramente gefeiert werden können. Durch seine gegenwärtige Gestaltung und Ausstattung soll die Begegnung der Gemeinde mit dem lebendigen Gott zum Ausdruck kommen.“ (ebd.) Es sind offensichtlich zwei Aspekte, die in Konkurrenz treten a) Verantwortung für die Welt muss wahrgenommen werden; darum ist Vielfalt geboten. b) Der Raum muss „ein gestalteter Raum sein, der deutlich zu erkennen gibt, was in ihm geschieht" (ebd). Dieses zweite Moment wird unterstützt durch beschwörende Formulierungen hinsichtlich der Gestaltungskraft früherer Generationen: „Auch die Gestaltungsformen, die frühere Generationen hierfür gefunden haben, sind unverzichtbar: Sie zeigen, dass Kirche eine Weggemeinschaft und die Gegenwart nur eine Station ist" (ebd.). Manchmal stoßen sich in der Konsequenz widersprechende Sätze hart aufeinander. Etwa wenn es heißt: „Der Raum soll die Gemeinde möglichst zu verschiedenen Gottesdienstformen anregen". Also Öffnung, Multifunktlonalität! Und unmittelbar danach: „Doch darf er durch unterschiedliche Nutzung keine gestalterischen Einbußen erleiden" (ebd.). Oder wenn von der Nutzung zu groß oder nutzlos gewordener Kirchen in Großstädten die Rede ist: „Anstatt neue Gebäude zu errichten, sollten vorhandene, besonders zu groß oder nutzungslos gewordene, Gottesdiensträume für die Gemeindearbeit eingerichtet werden, ohne ihren eigenen Wert zu verlieren." (S. 3) Hat man durch die Anfangsformulierung eine Umgestaltung der möglicherweise zu großen Kirche ins Auge gefasst, so wird dies doch wieder gewaltig eingeschränkt bis hin zur Formulierung „Bauliche Änderungen sollten deshalb möglichst reversibel sein." Dann heißt es: „Insbesondere für Innenstadtkirchen bieten sich oft noch viel zu wenig wahrgenommene übergemeindliche Aufgaben" (S. 3, also Öffnung!). Dann aber wieder: „Bauliche Veränderungen sind erst zu vertreten, wenn der Raum nach Größe, Beschaffenheit, Funktion oder Qualität dem kirchlichen Auftrag und den Erfordernissen nicht mehr genügt und wenn gottesdienstliche Belange dadurch beeinträchtigt werden." (ebd.) Oder im Sinne der Denkmalpflege noch konsequenter „Mitunter lassen sich Räume aus historischen, baulichen oder wirtschaftlichen Gründen nur wenig ändern. Gemeinden sollten in solchen Fällen raumgeeignete Nutzungen suchen, die im Respekt vor den überkommenen Zeugnissen die Zusammenhänge neu ordnen" (ebd.). Das Pendel zwischen zwei offensichtlich entgegen gesetzten Positionen, die der Meinung sind, zusammenkommen zu können, scheint mir für die Wolfenbütteler Empfehlungen charakteristisch. Erwähnenswert ist auch die Stellung der Empfehlungen zum Altar: „Der Altar sollte möglichst inmitten der Versammlung der Gemeinde stehen und kann transportabel sein. Die Feier des Abendmahls im Kreis um den Tisch soll möglich sein. Der Zugang für alte und behinderte Menschen zum Abendmahlstisch muss gewährleistet sein." (S. 4) Ziehen wir die aufgrund der Öffnungs-Vorstellung erforderliche Transportabilität des Altars ab, so ist eine gewisse Nähe zur „Circumstantes-Vorstellung" des 2. Vatikanischen Konzils bzw. zur Instructio unverkennbar. Auch hier regiert die Vorstellung, dass sich das Volk Gottes um den Abendmahlstisch schart und der Liturg (Vorsteher) versus populum zelebriert. - Auf den hohen Stellenwert, den die Wolfenbütteler Empfehlungen dem Thema Kunst in einem eigenen Kapitel beimessen, kann in diesem Zusammenhang nicht eingegangen werden. Da Zeitgenossenschaft in den Empfehlungen sehr ernst genommen wird und man hohe Anforderungen an die „künstlerische Qualität" stellt, ergeben sich für die Einbeziehung von Gegenwartskünstlern, die Beschaffenheit und die Entscheidungsbefugnisse der Gremien weit reichende Konsequenzen, auf die in diesem Zusammenhang nicht eingegangen werden kann. (S. 6/7) Den auf den Altarraum ausgestreckten, längsgerichteten Kirchenraum des Rummelsberger Programms mit seinen Bankblöcken kann man sich vorstellen. Auch der um den Altar kreisende Raum des 2. Vaticanums ist vorstellbar. Er wurde auch oft genug gebaut. Auch was ein Mehrzweckraum ist, ist in seiner grundsätzlichen Offenheit begreifbar, Der Raum will bloß Instrument sein für vielfältige Funktionen und verzichtet deshalb auf ein eindeutiges „sakrales" Gepräge. Wie aber sieht der Raum der „Wolfenbütteler Empfehlungen" aus? Versuchen wir zusammenzufassen: Der Wolfenbütteler Raum ist für vielfältige gottesdienstliche Funktionen offen und bezieht sich in seiner Gestalt auf das, was in ihm geschieht. Sofern es ein überkommener Raum ist, respektiert er die überkommene Gestalt. Gleichzeitig soll das historische Gebäude für vielfältige Formen des Gottesdienstes und der Gemeindearbeit und auch für übergemeindliche Funktionen genutzt werden können. Sollten jedoch Veränderungen vorgenommen werden, muss man sehr vorsichtig sein. Auf jeden Fall muss der Raum reversibel sein. Die Achtung vor der historisch gewordenen Substanz schließt aber nicht aus, dass gerade der zeitgenössischen Kunst eine besondere Rolle zufallen soll. Außerdem soll der Altar, auch als transportabler Altar, in die Mitte gestellt werden, damit man versus populum zelebrieren kann. - Ein solcher Raum ist offensichtlich unvorstellbar. Wie viele Codes müssten einem Architekten zu Gebote stehen, angesichts solcher disparaten Anforderungen zu einer überzeugenden Raumgestalt zu finden? Den zuletzt gemachten Bemerkungen liegt keine polemische Absicht zugrunde. Richtig daran ist, dass es den Kirchenraum der „Wolfenbütteler Empfehlungen" offenbar nicht gibt und womöglich auch nicht geben kann. Ein Movens der „Empfehlungen" besteht gerade darin, gegenüber der Engführung von Rummelsberg einen Freiheitsraum aufzutun, vielleicht sogar einen Horizont zu eröffnen, um die Vorstellung, was eine Kirche sei, aus einem engen Vorstellungsraster herauszuführen. Angesichts des von theologischer Seite angestrebten offenen Horizonts werden dann Markierungsstangen eingesetzt und wieder versetzt, auf die zu achten wäre. So beispielsweise die Frage der angemessenen Gestalt und Ausstattung des Bauwerks, der verantwortliche Umgang mit der historischen Bausubstanz usw. Mag also, wer ein Rezept erwartete, enttäuscht sein, so wird umgekehrt die kreative Gemeinde und der kreative Baumeister sich womöglich angeregt wissen, ihre Charismen zum Bau und zur Ausgestaltung der Räume einzubringen. Einen Freiraum zu benennen, in dem sich stehen, gehen und leben lässt, ist nämlich schwieriger, als ein Leitbild zu entwerfen. In diesem Sinn haben die „Wolfenbütteler Empfehlungen" womöglich das getan, was sich gegenwärtig noch verantworten lässt. Ihre Brüche und ihr Stottern teilen sie mit einer Kirche, der sich die Frage stellt, wie sie der Welt gegenüber glaubwürdig präsent sein und unter räumlichgestalterischen Bedingungen ihren Auftrag angemessen durchführen kann: Die Brüche und Widersprüche der „Wolfenbütteler Empfehlungen" sind ein Stück Glaubwürdigkeit. Akzeptiert man Wolfgang Welschs Definition von Postmoderne, dass die Pluralität vor der Einheit stehe, dass die Divergenz wichtiger sei als der Konsens und dass statt der Einsprachigkeit die Mehrfachcodierung geboten sei,[22] so sind die „Wolfenbütteler Empfehlungen" postmodern. Vielleicht fordern die postmodernen „Wolfenbütteler Empfehlungen" den postmodernen Architekten, der - wie Stirling in der Staatsgalerie in Stuttgart - ein mehrfach codierbares Bauwerk, in unserem Fall: die mehrfach codierbare Kirche bauen würde. Vielleicht gehört es zum Schicksal kirchlicher (bzw. öffentlicher) Stellungnahmen überhaupt, dass sie nur noch in Divergenzen und Brüchen wahr sein können, weil die einstige Einheit nur noch in in sich widersprüchlichen Partikularismen auffindbar ist: Die „Wolfenbütteler Empfehlungen" sind das erste postmoderne Kirchbauprogramm. 4. Neue AufgabenDrei Aufgabenbereiche scheinen mir hinsichtlich des Kirchenbaus für die Zukunft vordringlich: 1. Die Frage der Mitte, der sich dieser Kongress in besonderer Weise widmet, muss von Seiten der Kirchen - auch unter den Bedingungen der Postmoderne - neu angegangen werden. Auf eine Mitte im mittelalterlich-einheitlichen Sinn ist zu verzichten, nicht jedoch auf die Verantwortlichkeiten, die sich aufgrund einer geographischen Position in der Mitte im Stadt- oder Dorfzentrum real ergeben. Die Frage, welche Rolle der Kirche hierbei zufällt, wäre theologisch, soziologisch, städtebaulich und architektonisch-gestalterisch zu klären. Ohne freilich die einstige Zentralfunktion wieder zu beanspruchen, dürfte man den Öffentlichkeitsanspruch nicht zugunsten einer Überbetonung des Gemeinde- oder gar eines sektiererischen Gemeinschaftsverständnisses - aufgeben. Wir bedürfen der vorlaufenden Beschreibung, wie der Dienst- und der Verantwortungsbereich der Kirche in der City vorgestellt werden könnte Dieser Verantwortungsbereich kann nicht identisch mit dem einer Ortsgemeinde in ihrer parochialen Prägung sein. Kirche in der „Mitte" - nach fast 2000 Jahren Christentumsgeschichte - muss als Aufgabe gänzlich neu formuliert werden. 2. Angesichts der großen Zahl zu großer, zu wenig oder überhaupt nicht mehr genutzter Kirchen stellt sich die Aufgabe der Reaktivierung von Räumen durch bauliche und sonstige gestalterische Veränderungen. So, wie man von der kirchlichen Seite seitens der Denkmalpflege verlangen kann, dass sie sich dem baulichen Erbe verpflichtet weiß, sollte umgekehrt von der Denkmalpflege gefordert werden, dass sie die neuen Herausforderungen der Kirche in konstruktiver Weise mit trägt. Eine Denkmalpflege, die allein Anwaltfunktion für das geschichtliche Gewordene übernähme, kann hier nicht weiterhelfen, ebenso wenig wie eine Kirchengemeinde, die das historische Erbe ignorierte. 3. Im Zentrum der Großstadt wäre es wünschenswert, wenn seitens der Kirche nicht allein Kommunikationsräume, sondern auch Räume speziell zur Meditation angeboten würden. Der Bereich spirituelle Vertiefung sollte nicht den Sekten und den neuen Religionen vorbehalten bleiben. Da beide Großkirchen in der City kirchliche Räumlichkeiten in hinreichender Zahl zur Verfügung haben, wäre wünschenswert, dies zu nutzen, um in Zusammenarbeit mit Architekten und Künstlern entsprechende Meditationsräume zu schaffen. Die Mehrzweckraumdiskussion betonte die Verantwortungsräume für die Welt; sie betonte die Horizontale. Es wäre an der Zeit, ohne die sozial-kommunikative Dimension des christlichen Glaubens aufzugeben, sich verstärkt der Vertikalen zuzuwenden. Die spirituelle Dimension gegenwärtiger Kunstpraxis könnte die Forderung nach Räumen der Meditation als eine konkret zu verwirklichende Aufgabe erweisen. Anmerkungen[1] G. Langmaack, Evangelischer Kirchenbau im 19. und 20. Jahrhundert, Kassel 1971, S. 286-288. [2] G. Langmaack, a.a.O., S. 272-274. [3] Das 2. Vatikanische Konzil. Konstitutionen, Dekrete und Erklärungen. Lateinisch und deutsch. Kommentare, Teil l (LThK, 2. Auflage), Freiburg- Basel- Wien 1966, S. 103. [4] Oskar Söhngen hatte in seiner Schrift „Kirchlich bauen" eine andere Unterscheidung vorgeschlagen, die sich freilich - auch im evangelischen Bereich - nicht durchgesetzt hat Er sprach davon, dass es eine dingliche Sakralität zwar nicht geben könne, man aber stattdessen von einer „funktionalen Sakralität" sprechen solle. (O. Söhngen, Kirchlich Bauen, Gütersloh 1962). Aber auch auf diese Weise ließ sich der Begriff „Sakralität" für den evangelischen Bereich nicht retten. Siehe Vf. Artikel: Kirchenbau V, Moderner Kirchenbau, TRE XVH, S. 514-528; zit. S. 514-516. [5] Siehe Vf. Artikel: Kirchenbau V, Moderner Kirchenbau, TRE XVH, S. 514-528; zit S. 514-516. [6] Lebendiger Gottesdienst. Die Instruktion vom 26.9.1964 zur Liturgiekonstitution. Lateinisch-deutscher Text mit einem Kommentar von Heinrich Rennings, Münster; S. 183 [7] In der Einführung in das Meßbuch (Einsiedeln 1976) wird dies noch verstärkt. [8] J. van Acken, Christozentrische Kirchenkunst, Gladbeck 1922. [9] Otto H. Senn, Evangelischer Kirchbau im ökumenischen Kontext, Basel - Boston - Stuttgart 1983. [10] G. Rombold, Kirchen für die Zukunft bauen, Wien - Freiburg - Basel S 93 [11] Zit. n. Rombold, S. 133. [12] H. Muck, Der Raum, Wien 1986. [13] H. R. Blankesteijn, Kunst und Kirche 1969, S. 3-17. [14] Beispiel für eine solche konsequente Lösung ist das Gemeindezentrum der Evangelisch-lutherischen St. Paulus-Gemeinde in Burgdorf von Paul Posenenske (l973).'Es handelt sich um ein Gemeindezentrum unter einem Dach, in dessen Mittelpunkt ein zentraler, den übrigen Räumen gegenüber überhöhter Raum ist Für einen großen Gottesdienst lassen sich alle Räume zusammenschließen, während aufgrund eines Schiebewandsystems das das Ensemble in sechs bzw. sieben Räume aufgegliedert werden kann, die freilich auch zueinander in Beziehung zu setzen. Jeder Raum ist mit dem angrenzenden kombinierbar. Das trifft auch auf den zentralen, für den Gottesdienst vorgesehenen Raum zu, dessen Prinzipalstücke (Altar, Kanzel, Taufe) verschieden plaziert sind oder einfach weggenommen werden können. [15] M. Görbing, H. Graß, H. Schwebel, Planen-Bauen-Nutzen, Erfahrungen mit Gemeindezentren, Giessen 1981. [16] Eduard Schweizer, zit. nach Görbing, Graß, Schwebel, a.a.O. S. 132. [17] Görbing, Graß, Schwebel, a.a.O. S. 133. [18] Zu gleicher Zeit erschien Hans-Eckehard Bahrs Buch „Kirchen in nachsakraler Zeit" (Hamburg 1968), in welchem Walter M. Förderer u.a. forderte, auf den Kirchenbau vollends zu verzichten und an Stätten des Alltags (Busbahnhof, Fußgängerpassage, Fabrik) Kommunikationsräume zu errichten, nämlich „Stätten politischer Urbanität" (S. 114-131). [19] Der Vollständigkeit halber sei darauf verwiesen, dass es seit Mitte der sechziger Jahre in der Bundesrepublik Deutschland, in den Niederlanden und der Schweiz ökumenische Gemeindezentren gibt In den meisten Fällen behalten die beiden Konfessionen ihren eigenen Gottesdienstraum bei. Sofern Evangelische und Katholiken den gleichen Raum für ihren Gottesdienst verwenden (beispielsweise im „Trefkoel", Gronigen 1972, Architeken Grit und Gunnink Bylefeld), ist eine neue Weise ökumenischer Zusammenarbeit gegeben. Die Beobachtung, dass seit Mitte der siebziger Jahre die ökumenische Zusammenarbeit rückläufig ist, trifft wohl zu. Bedenkt man allerdings, dass es weltweit bereits etwa sechzig ökumenische Gemeindezentren gibt, so ist diese Zahl angesichts der Glaubenskriege zwischen den Konfessionen in früheren Jahrhunderten dennoch beachtlich. Der Grund zur räumlichen Nähe und Zusammenarbeit hat es nicht allein mit einer Annäherung der Konfessionen, sondern ebenfalls mit der strukturell gleichen Herausforderung durch die säkularisierte Welt zu tun. [20] So Förderer, a.a.O., S.118-120. [21] Der evangelische Kirchenraum (Wolfenbütteler Empfehlungen an die Gemeinden) Geschäftsstelle des Evangelischen Kirchentags, Berlin 1991. [22] W. Welsch, Unsere postmoderne Moderne, Weinheim 1987. |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/58/hs10.htm
|
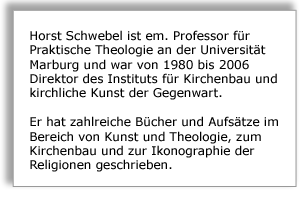 „Kirchen im Mittelpunkt", versehen mit einem Fragezeichen, richtet den Blick in die Zukunft. Meine Aufgabe, über „Reformen und Regulative im Kirchenbau: Die Botschaft der Kirchen nach dem Zweiten Weltkrieg" zu referieren, ist nach rückwärts gewandt. Gab es überhaupt eine Botschaft nach dem Zweiten Weltkrieg? Gibt es einiges, auf das man zurückgreifen könnte, an das anzuknüpfen wäre, oder stehen wir vor einem völligen Neubeginn? Was ich vorhabe, ist eine Art Lektüre, besser: eine Re-Lektüre von Programmen, die für den Kirchenbau seit 1945 wichtig wurden.
„Kirchen im Mittelpunkt", versehen mit einem Fragezeichen, richtet den Blick in die Zukunft. Meine Aufgabe, über „Reformen und Regulative im Kirchenbau: Die Botschaft der Kirchen nach dem Zweiten Weltkrieg" zu referieren, ist nach rückwärts gewandt. Gab es überhaupt eine Botschaft nach dem Zweiten Weltkrieg? Gibt es einiges, auf das man zurückgreifen könnte, an das anzuknüpfen wäre, oder stehen wir vor einem völligen Neubeginn? Was ich vorhabe, ist eine Art Lektüre, besser: eine Re-Lektüre von Programmen, die für den Kirchenbau seit 1945 wichtig wurden.