Freiheit oder Funktionalismus
Eine Glosse
Andreas Mertin
|
Denn nimmer, von nun an
Taugt zum Gebrauche das Heilge.
Hölderlin
|
Tief in Bayern …,
… das wissen wir nicht erst seit der gleichnamigen ethnologischen Studie von R.W.B. McCormack in der Anderen Bibliothek von Hans Magnus Enzensberger aus dem Jahr 1991, tief in Bayern funktioniert die Welt völlig anders als im Rest der Republik. Hier ist die Welt noch in Ordnung und hier haben Lehre und Obrigkeit noch Sinn und Bedeutung.
 McCormacks ethnologische Darstellung wird eröffnet mit einem Foto und dem folgenden Text: „Liberalitas Bavarica – Inschrift über dem Portal der Stiftskirche zu Polling bei Weilheim: eines der größten ungelösten Rätsel der Ethnographie. Der Wortsinn konnte nie befriedigend dechiffriert werden. Die Bedeutung bleibt wohl für immer im Dunkeln“. Wer die Worte im Internet eingibt, stößt auf folgende Erklärungsversuche: „Der Sinn ist unklar: bayerische Freiheit? liberale Gesinnung? Leben und leben lassen? Georg Lohmeier gibt als Erklärung: ‚Die Freiheit Bayerns – die bayerische Freigebigkeit – und als dritte die besondere liberale Gesinnung.’“ Die Freiheit ist den Bayern wichtig – oder etwa nicht? McCormacks ethnologische Darstellung wird eröffnet mit einem Foto und dem folgenden Text: „Liberalitas Bavarica – Inschrift über dem Portal der Stiftskirche zu Polling bei Weilheim: eines der größten ungelösten Rätsel der Ethnographie. Der Wortsinn konnte nie befriedigend dechiffriert werden. Die Bedeutung bleibt wohl für immer im Dunkeln“. Wer die Worte im Internet eingibt, stößt auf folgende Erklärungsversuche: „Der Sinn ist unklar: bayerische Freiheit? liberale Gesinnung? Leben und leben lassen? Georg Lohmeier gibt als Erklärung: ‚Die Freiheit Bayerns – die bayerische Freigebigkeit – und als dritte die besondere liberale Gesinnung.’“ Die Freiheit ist den Bayern wichtig – oder etwa nicht?
Die folgenden Ausführungen ergeben sich aus meiner Verärgerung über die Berichterstattung zu einer Kunst-Veranstaltung in einer kirchlichen Sonntagszeitung. Ich war eingeladen zu einem Kunst-Symposion der Evangelischen Kirche in Bayern und zwar explizit unter der Maßgabe, kritische Worte und Überlegungen zum aktuellen Stand von Kunst und Kirche vorzutragen. Dieser Einladung bin ich gefolgt. Und auf dem Symposion selbst war diese Sicht bei den anwesenden Künstlerinnen und Künstlern auch gar nicht umstritten. Im Nachhinein aber artikulierte sich in der kirchlichen Presse eine ganz andere, überaus einseitige Sicht der Dinge, die mit dem Ablauf der Veranstaltung wenig, mit kirchlicher Ideologie aber viel zu tun hat.
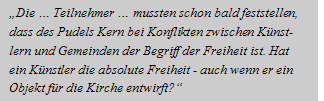 Der Bericht setzt ein mit einer zusammenfassenden Fokussierung: das Problem zwischen Künstlern und Gemeinden sei die absolute Freiheit, die die Kunst in Anspruch nehme. Nun ist die Formulierung „absolute Freiheit“ während der gesamten Veranstaltung überhaupt nicht gefallen, er ist eine wertende Überspitzung des Vorgetragenen. Gesprochen wurde von Freiheit im Sinne der Aufklärung, von Freiheit seitens des autonomen Subjekts usw. Von absoluter Freiheit in gesellschaftlichen Beziehungen zu sprechen, macht schon deshalb keinen Sinn, weil es den Begriff der Autarkie an jene Stelle setzt, wo nach vernünftiger Überlegung doch aufgeklärte Autonomie hingehört. Aber hier soll schon gleich am Beginn des Artikels eine bestimmte Assoziation hergestellt werden: wenn man sich auf Künstler einlässt, dann fordern sie gleich absolute Freiheit – gemeint ist, sie machen, was sie wollen. Das ist einfach Unsinn. Aber die unwillkürliche Assoziation des Begriffs Freiheit mit dem Teufel (der ja sprichwörtlich des Pudels Kern darstellt), das hat schon etwas. Der Bericht setzt ein mit einer zusammenfassenden Fokussierung: das Problem zwischen Künstlern und Gemeinden sei die absolute Freiheit, die die Kunst in Anspruch nehme. Nun ist die Formulierung „absolute Freiheit“ während der gesamten Veranstaltung überhaupt nicht gefallen, er ist eine wertende Überspitzung des Vorgetragenen. Gesprochen wurde von Freiheit im Sinne der Aufklärung, von Freiheit seitens des autonomen Subjekts usw. Von absoluter Freiheit in gesellschaftlichen Beziehungen zu sprechen, macht schon deshalb keinen Sinn, weil es den Begriff der Autarkie an jene Stelle setzt, wo nach vernünftiger Überlegung doch aufgeklärte Autonomie hingehört. Aber hier soll schon gleich am Beginn des Artikels eine bestimmte Assoziation hergestellt werden: wenn man sich auf Künstler einlässt, dann fordern sie gleich absolute Freiheit – gemeint ist, sie machen, was sie wollen. Das ist einfach Unsinn. Aber die unwillkürliche Assoziation des Begriffs Freiheit mit dem Teufel (der ja sprichwörtlich des Pudels Kern darstellt), das hat schon etwas.
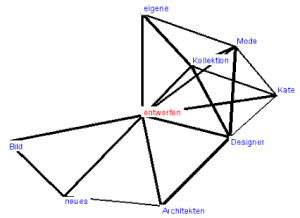 Und auch der nachfolgende Halbsatz ist bezeichnend: wenn ein Künstler ein Objekt für die Kirche entwirft – das ist ganz und gar die Sprache des Designs und der Architektur, also der angewandten Künste und nicht der freien Künste wie wir sie seit der Renaissance und der Reformation kennen. Künstler entwerfen keine Objekte – für wen auch immer. Mit dem Satz wird die Perspektive deutlich, unter der Künstler betrachtet werden sollen: als Objektgestalter, also als Handwerker und Designer. Aufgabe der Künstler sei es, Objekte für die Kirche zu entwerfen. Wer das Wort „entwerfen“ in den korpuslinguistischen Wortschatz der Uni Leipzig eingibt, bekommt als Assoziationengefüge konsequent „Kollektion, Mode, Designer, Architekten“. Das ist einer der zentralen Grundirrtümer, denen Künstler in der Kirche begegnen: dass sie bloß Gestalter kirchlich zu nutzender Objekte seien. Diese Form des verdinglichten Denkens, die Gegenstände nur noch in Gebrauchsfunktionen begreifen kann, ist erschreckend. Und auch der nachfolgende Halbsatz ist bezeichnend: wenn ein Künstler ein Objekt für die Kirche entwirft – das ist ganz und gar die Sprache des Designs und der Architektur, also der angewandten Künste und nicht der freien Künste wie wir sie seit der Renaissance und der Reformation kennen. Künstler entwerfen keine Objekte – für wen auch immer. Mit dem Satz wird die Perspektive deutlich, unter der Künstler betrachtet werden sollen: als Objektgestalter, also als Handwerker und Designer. Aufgabe der Künstler sei es, Objekte für die Kirche zu entwerfen. Wer das Wort „entwerfen“ in den korpuslinguistischen Wortschatz der Uni Leipzig eingibt, bekommt als Assoziationengefüge konsequent „Kollektion, Mode, Designer, Architekten“. Das ist einer der zentralen Grundirrtümer, denen Künstler in der Kirche begegnen: dass sie bloß Gestalter kirchlich zu nutzender Objekte seien. Diese Form des verdinglichten Denkens, die Gegenstände nur noch in Gebrauchsfunktionen begreifen kann, ist erschreckend.
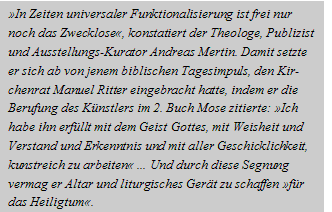 Auch der nächste Abschnitt ist von einer stupenden Unkenntnis abendländischer Kulturgeschichte. Künstler im heute gebrauchten Sinn des Wortes gab es zu biblischen Zeiten und auch in den darauf folgenden 1500 Jahren nicht. Die biblische Bezugsstelle spricht daher auch klar von Handwerkern, die beauftragt werden („ich habe ihm … handwerkliche Fähigkeit vermittelt“). Wenn man ein Beispiel für angewandte Kunst kennen lernen will, dann eignet sich Exodus 31, 1ff. bestens dafür. Hier geht es klar um Handwerk. Der Text sagt nichts anderes, als dass für bestimmte Aufgaben jeweils die besten Handwerker genommen werden sollen - weshalb Salomo zum Beispiel die heidnischen Phönizier mit dem Kunsthandwerk beauftragt, weil sie besser als die einheimischen Handwerker sind. Die Problemstellung des Kunstsymposiums, wie sich freie Kunst und Kirche heute begegnen, wird vom biblischen Text aber gar nicht erfasst und war auch vom Kirchenrat Ritter nicht intendiert. Es war keine funktionale Bibelauslegung. Vermutlich soll aber von Anfang an der Eindruck erweckt werden, dass nicht einmal im Entferntesten daran zu denken ist, dass freie Künstler in der Kirche arbeiten können - es sei denn sie verstehen sich als Designer. Kulturgeschichtlich nennt man das die Kunst als Ancilla Ecclesiae, also „als Dienerin der Kirche“. Es ist aber gerade die Reformation, die mit dieser Vorstellung aufgeräumt hat. Auch der nächste Abschnitt ist von einer stupenden Unkenntnis abendländischer Kulturgeschichte. Künstler im heute gebrauchten Sinn des Wortes gab es zu biblischen Zeiten und auch in den darauf folgenden 1500 Jahren nicht. Die biblische Bezugsstelle spricht daher auch klar von Handwerkern, die beauftragt werden („ich habe ihm … handwerkliche Fähigkeit vermittelt“). Wenn man ein Beispiel für angewandte Kunst kennen lernen will, dann eignet sich Exodus 31, 1ff. bestens dafür. Hier geht es klar um Handwerk. Der Text sagt nichts anderes, als dass für bestimmte Aufgaben jeweils die besten Handwerker genommen werden sollen - weshalb Salomo zum Beispiel die heidnischen Phönizier mit dem Kunsthandwerk beauftragt, weil sie besser als die einheimischen Handwerker sind. Die Problemstellung des Kunstsymposiums, wie sich freie Kunst und Kirche heute begegnen, wird vom biblischen Text aber gar nicht erfasst und war auch vom Kirchenrat Ritter nicht intendiert. Es war keine funktionale Bibelauslegung. Vermutlich soll aber von Anfang an der Eindruck erweckt werden, dass nicht einmal im Entferntesten daran zu denken ist, dass freie Künstler in der Kirche arbeiten können - es sei denn sie verstehen sich als Designer. Kulturgeschichtlich nennt man das die Kunst als Ancilla Ecclesiae, also „als Dienerin der Kirche“. Es ist aber gerade die Reformation, die mit dieser Vorstellung aufgeräumt hat.
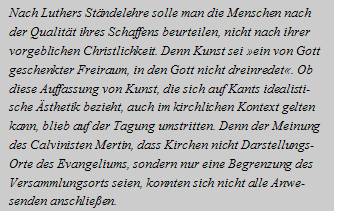 Im nächsten Abschnitt geht dann alles munter drunter und drüber. Dass wir Menschen nach der Qualität ihres Schaffens beurteilen sollen und dass Kunst ein uns von Gott geschenkter Freiraum ist, hat mit Kant oder der idealistischen Philosophie nun nichts zu tun, sondern ist genuine Lehre der Reformation. "Es ist hier angebracht, sich stets die Vorstellung zu vergegenwärtigen, dass das Sinnliche das Zeichen schlechthin der menschlichen Verfassung, der endlichen Erkenntnis darstellt. Es ist genau dies, durch welches sich der Mensch, der einen materiellen Körper und einen beschränkten Geist hat, von Gott, der reiner Geist und allwissend ist, unterscheidet.“ (Luc Ferry) Werner Hofmann hat dies vor einem viertel Jahrhundert in seiner berühmten Hamburger Ausstellung „Martin Luther und die Folgen für die Kunst“ dargestellt und von der Geburt der Moderne aus dem Geist der Religion gesprochen. Im nächsten Abschnitt geht dann alles munter drunter und drüber. Dass wir Menschen nach der Qualität ihres Schaffens beurteilen sollen und dass Kunst ein uns von Gott geschenkter Freiraum ist, hat mit Kant oder der idealistischen Philosophie nun nichts zu tun, sondern ist genuine Lehre der Reformation. "Es ist hier angebracht, sich stets die Vorstellung zu vergegenwärtigen, dass das Sinnliche das Zeichen schlechthin der menschlichen Verfassung, der endlichen Erkenntnis darstellt. Es ist genau dies, durch welches sich der Mensch, der einen materiellen Körper und einen beschränkten Geist hat, von Gott, der reiner Geist und allwissend ist, unterscheidet.“ (Luc Ferry) Werner Hofmann hat dies vor einem viertel Jahrhundert in seiner berühmten Hamburger Ausstellung „Martin Luther und die Folgen für die Kunst“ dargestellt und von der Geburt der Moderne aus dem Geist der Religion gesprochen.
Notabene: Die Etikettierung des Referenten als „Calvinist“ ist eine Verletzung der binnenkirchlichen Etikette. Noch bezeichnen wir in der innerevangelischen Ökumene calvinistische Theologen als reformierte Theologen, weil kirchenhistorisch der Begriff „kalvinistisch“ eine Denunziationsformel war und Anhänger der reformierten Lehre ja auch lange genug verfolgt und ausgeschlossen wurden. Aber im lutherischen Bayern ist man rauere Töne gewohnt und Rücksicht auf die reformierte Theologie hat man den Mitgliedern der VELKD noch nie nachsagen können.
Den Satz, dass Kirchengebäude mehr seien als „nur eine Begrenzung des Versammlungsortes“ der Gemeinde, nämlich „Darstellungsorte des Evangeliums“, vernehme ich mit Interesse. Er kann zunächst einmal Unterschiedliches bedeuten. Einmal, dass der Kirchenraum substantiell mehr ist als nur der Raum, in dem die Gemeinde sich versammelt. So muss man von einer eigenständigen „Predigt der Steine“ ausgehen. Diese These wird freilich seit dem 2. Vaticanum nicht einmal in der katholischen Kirche mehr vertreten. Ich zitiere einmal aus entsprechenden Ausführungen des katholischen Liturgiewissenschaftlers Klemens Richter:
„Schon das Neue Testament stellt klar, dass Gott nicht in Tempeln wohnt, die von Menschenhand gemacht sind, wie Paulus den Athenern unter Bezug auf ein Wort Salomos zur Einweihung des Jerusalemer Tempels (1 Kön 8,27) sagt (Apg 17,24). Er wohnt in seiner Gemeinde, die als lebendiger Bau durch den „Schlussstein“ Christus im Heiligen Geist zusammengehalten wird (Eph 2,20-22). So kann die Gemeinschaft der Christen als der eigentliche Tempel bezeichnet werden: „Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt?... Gottes Tempel ist heilig, und der seid ihr“ (1 Kor 3,16f; vgl. auch 6,19; 2 28 Kor 6,16). Und in 1 Petr 2,5 heißt es: „Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft...“ Die Gefahren, die eine räumliche Festlegung mit sich bringt, dürfen nicht übersehen werden. Zu leicht entsteht die Vorstellung, dass Gott am Kultort zur Verfügung stehe, dass er dort durch bestimmte Riten in den Griff zu bekommen sei. Wo Kirchenbau eine solche Vorstellung fördert, wird sich ein anderes Glaubensbewusstsein einstellen als dort, wo dieser Raum zunächst als Haus der Gemeinde verstanden wird, wo Gott nicht durch den Raum, sondern durch das gläubige Handeln dieser Gemeinde gegenwärtig wird, durch ihr Tun in Liturgie und Diakonie.“
Es könnte aber auch evtl. nur ganz trivial gemeint gewesen sein, dass im und nicht durch das Kirchengebäude der christliche Glaube zur Darstellung kommen kann. Nur ergibt sich daraus kein Gegensatz zu meinen Äußerungen. Selbstverständlich gibt es eine Beziehung zwischen ästhetischer Gestalt des Raumes und der in ihm geschehenden Verkündigung! Das war ja gerade der Topos meines Vortrages, dass der evangelischen Lehre auch ein entsprechendes kulturelles Verständnis beiseite gestellt werden müsse. Wenn also die Kunst ein uns von Gott geschenkter Freiraum ist, dann, so hatte ich gesagt, hängt die Beurteilung der christlichen Gemeinde auch davon ab, wie viel von diesem Freiraum in ihren Räumen möglich ist.
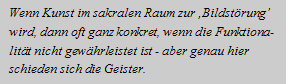 Der im kirchlichen Kontext gerne benutzte Begriff des sakralen Raumes ist ganz interessant. „Das neulateinische Kunstwort „sakral“ bezeichnet etwas unscharf alles, was auf das Heilige bezogen ist. Es ist erst seit dem Ende des 19. Jahrhunderts bekannt. Profan ist dagegen das, was vor der Sakralsphäre liegt, nämlich pro = vor, fanum = heiliger Bezirk.“ (Klemens Richter) Keinesfalls kann daher das Wort vom sakralen Raum zum Kernbestand evangelischer Überlieferung gehören, es kann geradezu als dessen Gegenteil begriffen werden: nämlich als Etablierung des Gegensatzes von profan und heilig. Christus ist aber der Herr der Welt und nicht nur des Tempels. Eine Kirche ist hoffentlich nie sakral und ihre Umgebung nie pro-fan! Der im kirchlichen Kontext gerne benutzte Begriff des sakralen Raumes ist ganz interessant. „Das neulateinische Kunstwort „sakral“ bezeichnet etwas unscharf alles, was auf das Heilige bezogen ist. Es ist erst seit dem Ende des 19. Jahrhunderts bekannt. Profan ist dagegen das, was vor der Sakralsphäre liegt, nämlich pro = vor, fanum = heiliger Bezirk.“ (Klemens Richter) Keinesfalls kann daher das Wort vom sakralen Raum zum Kernbestand evangelischer Überlieferung gehören, es kann geradezu als dessen Gegenteil begriffen werden: nämlich als Etablierung des Gegensatzes von profan und heilig. Christus ist aber der Herr der Welt und nicht nur des Tempels. Eine Kirche ist hoffentlich nie sakral und ihre Umgebung nie pro-fan!
Dass Kunst in der Kirche stört, wenn sie nicht funktional ist, ist eine nun wirklich erschütternde Einsicht. Das ist doch gerade der Einsatz von Kunst: Erfahrungen auszulösen. An solch einem Satz erweist sich Schleiermachers Angst vor der drohenden Kulturlosigkeit des Christentums als berechtigt: "Soll denn der Knoten der Geschichte so aufgehen, die Wissenschaft mit dem Unglauben und die Religion mit der Barbarei?" Muss man nicht ganz instinktiv den impliziten Gegensatz von „Kunst“ und „Funktionalität“ erspüren? Ist denn der Verblendungszusammenhang wirklich so universal geworden, dass niemand mehr diesen Widerstreit begreift? Es sind Sätze wie diese, die mich jedes Mal überlegen lassen, ob man als kulturell interessierter Mensch überhaupt noch in der evangelischen Kirche bleiben kann oder ob sich nicht Kultur und Kirche heutzutage ausschließen – und das nicht im Sinne der Kritik der Dialektischen Theologie, der ich selbstverständlich folge, sondern im Sinne der Unfähigkeit der kirchlich Versammelten, Grunddaten der Kultur auch nur nachzuvollziehen – Ausnahmen bestätigen die Regel.
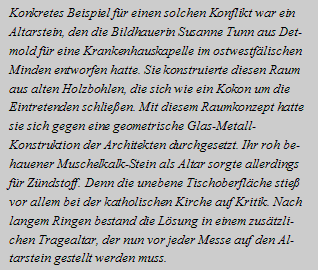 An dieser Beschreibung eines konkreten Beispiels stimmt nun so gut wie nichts – und gerade deshalb ist sie ein gutes Bespiel dafür, was der Kern des Problems ist: die binnenkirchliche Wahrnehmungsunfähigkeit, über die ich im größeren Teil meines Vortrages gesprochen habe. Weder stimmt es, dass die Künstlerin sich gegen die geometrische Glas-Metall-Konstruktion der Architekten durchgesetzt habe, vielmehr befindet sich ihr Raum-Objekt innerhalb der Stahl-Glas-Konstruktion, wie auf den während der Veranstaltung gezeigten Fotos auch deutlich zu erkennen war. Die elliptische Holzkonstruktion schließt sich auch nicht wie ein Kokon um den Besucher, sondern ist offen in alle Richtungen, so sehr, dass einige Menschen vor Ort meinten, sie sei zu offen für einen Meditations- und Andachtsraum. An dieser Beschreibung eines konkreten Beispiels stimmt nun so gut wie nichts – und gerade deshalb ist sie ein gutes Bespiel dafür, was der Kern des Problems ist: die binnenkirchliche Wahrnehmungsunfähigkeit, über die ich im größeren Teil meines Vortrages gesprochen habe. Weder stimmt es, dass die Künstlerin sich gegen die geometrische Glas-Metall-Konstruktion der Architekten durchgesetzt habe, vielmehr befindet sich ihr Raum-Objekt innerhalb der Stahl-Glas-Konstruktion, wie auf den während der Veranstaltung gezeigten Fotos auch deutlich zu erkennen war. Die elliptische Holzkonstruktion schließt sich auch nicht wie ein Kokon um den Besucher, sondern ist offen in alle Richtungen, so sehr, dass einige Menschen vor Ort meinten, sie sei zu offen für einen Meditations- und Andachtsraum.
 Die Verbindung von ‚roh behauener Altarstein’ und ‚unebene Tischoberfläche’ muss nun beim Leser den Eindruck erwecken, die Künstlerin habe den Stein oben nur leicht behauen und deshalb würde alles umkippen, was man auf das Kunstobjekt stellen würde. Nichts ist weniger wahr. Selbstverständlich ist die Tischplatte sorgfältig bearbeitet und das war auch auf den Fotos sichtbar. Nur ist die Platte nicht plan geschliffen, sondern enthält unterschiedliche Plateaus, die der Logik des Steins und der ihn bildenden Natur folgen. Und ganz selbstverständlich kann man Kelch und Oblatenkorb auf den Altar stellen. Letztlich wird hier der Künstlerin unterstellt, schlecht gearbeitet zu haben. Das ist nun ganz und gar nicht der Fall, es handelt sich vielmehr um eine herausragende Arbeit – und zwar ebenso in ästhetischer wie in religiöser Perspektive. Die Verbindung von ‚roh behauener Altarstein’ und ‚unebene Tischoberfläche’ muss nun beim Leser den Eindruck erwecken, die Künstlerin habe den Stein oben nur leicht behauen und deshalb würde alles umkippen, was man auf das Kunstobjekt stellen würde. Nichts ist weniger wahr. Selbstverständlich ist die Tischplatte sorgfältig bearbeitet und das war auch auf den Fotos sichtbar. Nur ist die Platte nicht plan geschliffen, sondern enthält unterschiedliche Plateaus, die der Logik des Steins und der ihn bildenden Natur folgen. Und ganz selbstverständlich kann man Kelch und Oblatenkorb auf den Altar stellen. Letztlich wird hier der Künstlerin unterstellt, schlecht gearbeitet zu haben. Das ist nun ganz und gar nicht der Fall, es handelt sich vielmehr um eine herausragende Arbeit – und zwar ebenso in ästhetischer wie in religiöser Perspektive.
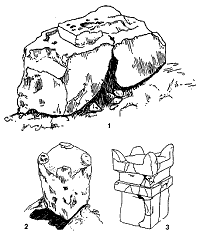 Was kontrovers war, war die Frage, ob ein Tisch vollständig plan geschliffen sein muss, um als Altartisch zu dienen. Und deshalb wurde im Rahmen der Veranstaltung auf zahlreiche Altäre verwiesen (u.a. Amish Kapoors Altar in der Dresdner Frauenkirche im evangelischen und Karl Prantls Altar im katholischen Bereich), die künstlerische Lösungen jenseits des planen Tisches darstellen und dennoch gewährleisten, dass man Kelch und Brot aufstellen kann. Und ganz abgesehen davon: der von der berichtenden Journalistin herausgestellte biblische Morgenimpuls nennt als kunsthandwerkliches Objekt den Brandopferaltar und dieser dürfte nun mit aller archäologischen Gewissheit keinesfalls plan geschliffen gewesen sein, sondern von einer derartigen Struktur, dass z.B. das Blut des Opfertieres problemlos abfließen konnte. M.a.W. der Altar hatte Rillen und Löcher. Was kontrovers war, war die Frage, ob ein Tisch vollständig plan geschliffen sein muss, um als Altartisch zu dienen. Und deshalb wurde im Rahmen der Veranstaltung auf zahlreiche Altäre verwiesen (u.a. Amish Kapoors Altar in der Dresdner Frauenkirche im evangelischen und Karl Prantls Altar im katholischen Bereich), die künstlerische Lösungen jenseits des planen Tisches darstellen und dennoch gewährleisten, dass man Kelch und Brot aufstellen kann. Und ganz abgesehen davon: der von der berichtenden Journalistin herausgestellte biblische Morgenimpuls nennt als kunsthandwerkliches Objekt den Brandopferaltar und dieser dürfte nun mit aller archäologischen Gewissheit keinesfalls plan geschliffen gewesen sein, sondern von einer derartigen Struktur, dass z.B. das Blut des Opfertieres problemlos abfließen konnte. M.a.W. der Altar hatte Rillen und Löcher.
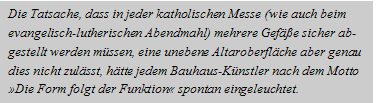 Der nächste Satz ist einfach nur Quatsch und ärgert mich maßlos. Wie schon dargestellt, ist es beim fraglichen Kunst-Objekt ohne jedes Problem möglich, Brot und Wein abzustellen. Nun aber kommt die Formulierung mit den Bauhaus-Künstlern und der Funktionsorientierung der Kunst. In einem Universitätsseminar würde ich einen solchen Satz als Ausdruck einer ungesunden Halbbildung scharf rügen. Der Satz „Form follows function“ wurde aufgestellt, als es das Bauhaus noch gar nicht gab, nämlich 1896 von dem Architekten Louis Henri Sullivan, dem wir einige der interessantesten Hochhäuser Amerikas verdanken. Er artikuliert ein Architektur- und Design-Verständnis, das spätestens mit der Post-Moderne hochgradig problematisiert wurde. Und was hat das mit dem Bauhaus zu tun? Auch das Bauhaus hat sich auf den Funktionalismus bezogen. Das Bauhaus war eben zunächst einmal eine Ausbildungsstätte für Designer und Architekten. Und für diesen Bereich gilt ja der Satz der Funktionsorientierung - zumindest für die Zeit der Moderne. Der nächste Satz ist einfach nur Quatsch und ärgert mich maßlos. Wie schon dargestellt, ist es beim fraglichen Kunst-Objekt ohne jedes Problem möglich, Brot und Wein abzustellen. Nun aber kommt die Formulierung mit den Bauhaus-Künstlern und der Funktionsorientierung der Kunst. In einem Universitätsseminar würde ich einen solchen Satz als Ausdruck einer ungesunden Halbbildung scharf rügen. Der Satz „Form follows function“ wurde aufgestellt, als es das Bauhaus noch gar nicht gab, nämlich 1896 von dem Architekten Louis Henri Sullivan, dem wir einige der interessantesten Hochhäuser Amerikas verdanken. Er artikuliert ein Architektur- und Design-Verständnis, das spätestens mit der Post-Moderne hochgradig problematisiert wurde. Und was hat das mit dem Bauhaus zu tun? Auch das Bauhaus hat sich auf den Funktionalismus bezogen. Das Bauhaus war eben zunächst einmal eine Ausbildungsstätte für Designer und Architekten. Und für diesen Bereich gilt ja der Satz der Funktionsorientierung - zumindest für die Zeit der Moderne.
 Die berichtende Journalistin meint aber ergänzen zu müssen, „jedem Bauhaus-Künstler“ hätte die notwendige Funktionalität seiner Kunst eingeleuchtet. Jedem Bauhaus-Künstler? Gehen wir die Bauhaus-Künstler doch schnell mal durch: Johannes Itten - Paul Klee - Wassily Kandinsky – Josef Albers - Oskar Schlemmer - Gerhard Marcks. Wer von denen ist verdächtig, der Form-follows-Function-These zu folgen? Es mögen konstruktive, expressive oder konkrete Werke sein, die diese Künstler gemacht haben, aber funktional sind sie nicht. Was bitte schön ist an den abstrakt-geometrischen Bildern von Josef Albers funktional? Was an den konstruktivistischen Arbeiten Wassily Kandinskys? Und ist ausgerechnet Paul Klees Kunst ein Beispiel für Funktionalismus? Und die Skulpturen von Gerhard Marcks – sind es funktionale Skulpturen? Es wird schwer sein, die Bildenden Künstler, die am Bauhaus gearbeitet haben, in die Linie des architektonischen Funktionalismus zu stellen. Was hier allerdings unreflektiert repetiert wird, ist die Meinung des Architekten Walter Gropius, der die Künstler wieder den Handwerkern angleichen wollte: „Das Endziel aller bildnerischen Tätigkeit ist der Bau! … Architekten, Bildhauer, Maler, wir alle müssen zum Handwerk zurück! ... Der Künstler ist eine Steigerung des Handwerkers.“ Diese Vorstellung ist nun allerdings grandios gescheitert und wird von der Kunst nahezu des gesamten 20. Jahrhunderts dementiert – was übrigens Hans Sedlmayr im „Verlust der Mitte“ bitter beklagt hat. Die berichtende Journalistin meint aber ergänzen zu müssen, „jedem Bauhaus-Künstler“ hätte die notwendige Funktionalität seiner Kunst eingeleuchtet. Jedem Bauhaus-Künstler? Gehen wir die Bauhaus-Künstler doch schnell mal durch: Johannes Itten - Paul Klee - Wassily Kandinsky – Josef Albers - Oskar Schlemmer - Gerhard Marcks. Wer von denen ist verdächtig, der Form-follows-Function-These zu folgen? Es mögen konstruktive, expressive oder konkrete Werke sein, die diese Künstler gemacht haben, aber funktional sind sie nicht. Was bitte schön ist an den abstrakt-geometrischen Bildern von Josef Albers funktional? Was an den konstruktivistischen Arbeiten Wassily Kandinskys? Und ist ausgerechnet Paul Klees Kunst ein Beispiel für Funktionalismus? Und die Skulpturen von Gerhard Marcks – sind es funktionale Skulpturen? Es wird schwer sein, die Bildenden Künstler, die am Bauhaus gearbeitet haben, in die Linie des architektonischen Funktionalismus zu stellen. Was hier allerdings unreflektiert repetiert wird, ist die Meinung des Architekten Walter Gropius, der die Künstler wieder den Handwerkern angleichen wollte: „Das Endziel aller bildnerischen Tätigkeit ist der Bau! … Architekten, Bildhauer, Maler, wir alle müssen zum Handwerk zurück! ... Der Künstler ist eine Steigerung des Handwerkers.“ Diese Vorstellung ist nun allerdings grandios gescheitert und wird von der Kunst nahezu des gesamten 20. Jahrhunderts dementiert – was übrigens Hans Sedlmayr im „Verlust der Mitte“ bitter beklagt hat.
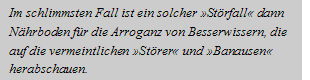 Dass kirchliche Berichterstattung dann auch noch polemisch und beleidigend werden kann, zeigt der folgende Satz. Das mit der „Arroganz von Besserwissern“ ist in aller Regel der Versuch, sich der Nötigung zum eigenen Argument zu entziehen. Ich kann’s nicht mehr hören. Dass, wer es besser weiß, schon gleich arrogant ist, nur weil er es sagt, kann nur in einer Gesellschaft artikuliert werden, die Intellektuelle so verachtet, wie die deutsche. Das Wort „Banause“ ist während der Veranstaltung nicht gefallen, auch wenn die Anführungsstriche darauf hindeuten könnten. Was aber, wenn wir das Wort einmal ernst nehmen, wenn wir die umgangssprachliche Stammtisch-Ebene verlassen und uns dem Wortsinn nähern? Banausen sind jene, die nicht zu den artes liberales (den freien Künsten) gehören, sondern zu den artes mechanicae, zum Handwerk. Man unterschied also schon in der Antike zwischen freier und funktionaler Arbeit und war der Ansicht, dass den Menschen die freie, zwecklose Arbeit aus den Niederungen des Alltags heraushob. Man schaute tatsächlich auf Banausen herab, aber nur, weil man mehr wollte als bloß Funktionieren. Dass kirchliche Berichterstattung dann auch noch polemisch und beleidigend werden kann, zeigt der folgende Satz. Das mit der „Arroganz von Besserwissern“ ist in aller Regel der Versuch, sich der Nötigung zum eigenen Argument zu entziehen. Ich kann’s nicht mehr hören. Dass, wer es besser weiß, schon gleich arrogant ist, nur weil er es sagt, kann nur in einer Gesellschaft artikuliert werden, die Intellektuelle so verachtet, wie die deutsche. Das Wort „Banause“ ist während der Veranstaltung nicht gefallen, auch wenn die Anführungsstriche darauf hindeuten könnten. Was aber, wenn wir das Wort einmal ernst nehmen, wenn wir die umgangssprachliche Stammtisch-Ebene verlassen und uns dem Wortsinn nähern? Banausen sind jene, die nicht zu den artes liberales (den freien Künsten) gehören, sondern zu den artes mechanicae, zum Handwerk. Man unterschied also schon in der Antike zwischen freier und funktionaler Arbeit und war der Ansicht, dass den Menschen die freie, zwecklose Arbeit aus den Niederungen des Alltags heraushob. Man schaute tatsächlich auf Banausen herab, aber nur, weil man mehr wollte als bloß Funktionieren.
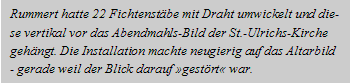 Abschließend meint die Berichterstatterin, dem eigentlichen Thema »Bildstörung« hätte sich vor allem der Künstler Bernd Rummert aus Schweinfurt genähert: Die Installation machte neugierig auf das Altarbild - gerade weil der Blick darauf ‚gestört’ war. Ja, da haben wir sie, die Funktion von zeitgenössischer Kunst in der Kirche. Was soll sie machen? Sie soll neugierig machen auf das Eigentliche, auf das Altarbild. Da wird mit einem Schlag der gesamte Prozess der Moderne verbal liquidiert. Es tut mir für Bernd Rummert leid, dass er im Nachhinein öffentlich so funktionalisiert wird. Vor Ort hatte er seine künstlerische Arbeitsweise erläutert, hatte die Stäbe durch das Publikum gereicht, damit man die konkreten Kunst-Objekte sinnlich erfahren konnte. Es ging in St. Ulrich ja schließlich um Kunst und nicht um eine Wahrnehmungsübung im Rahmen einer kirchenpädagogischen Veranstaltung. Wer das nicht versteht, hat vom Ganzen überhaupt nichts verstanden. Gerade Rummerts Kunst läuft jedem Funktionalismus zuwider, seine Arbeiten können geradezu als Aufschrei des Objekts gegen seine bloß scheinbare Funktion begriffen werden. Wenn Form, dann im Zustand ihrer Auflösung - wie Andreas Link einmal zu Rummerts Arbeiten sagte. Abschließend meint die Berichterstatterin, dem eigentlichen Thema »Bildstörung« hätte sich vor allem der Künstler Bernd Rummert aus Schweinfurt genähert: Die Installation machte neugierig auf das Altarbild - gerade weil der Blick darauf ‚gestört’ war. Ja, da haben wir sie, die Funktion von zeitgenössischer Kunst in der Kirche. Was soll sie machen? Sie soll neugierig machen auf das Eigentliche, auf das Altarbild. Da wird mit einem Schlag der gesamte Prozess der Moderne verbal liquidiert. Es tut mir für Bernd Rummert leid, dass er im Nachhinein öffentlich so funktionalisiert wird. Vor Ort hatte er seine künstlerische Arbeitsweise erläutert, hatte die Stäbe durch das Publikum gereicht, damit man die konkreten Kunst-Objekte sinnlich erfahren konnte. Es ging in St. Ulrich ja schließlich um Kunst und nicht um eine Wahrnehmungsübung im Rahmen einer kirchenpädagogischen Veranstaltung. Wer das nicht versteht, hat vom Ganzen überhaupt nichts verstanden. Gerade Rummerts Kunst läuft jedem Funktionalismus zuwider, seine Arbeiten können geradezu als Aufschrei des Objekts gegen seine bloß scheinbare Funktion begriffen werden. Wenn Form, dann im Zustand ihrer Auflösung - wie Andreas Link einmal zu Rummerts Arbeiten sagte.
 Und so wird aus der gesamten Veranstaltung zum Thema „Bildstörung“ unter der Hand in der Rezeption eine simple Illustration des Themas. Vielleicht ist in Bayern ja auch nichts anderes zu erwarten. Denn es sei noch einmal voller Empörung daran erinnert, was in Bayern mit „Form follows function“ konkret gemeint ist. Auf dem Kunstobjekt von Madeleine Dietz, das in München-Riem als Altar „dient“, hatten Nutzer der Kirche bequemer Weise ihre Frühstücksutensilien abgelegt und das auch noch im Internet weltweit verbreitet. Niemand hat sich dafür bei der Künstlerin entschuldigt. Warum auch? In Bayern müssen Kunstobjekte, die als Altäre dienen, eben funktional sein und zwar ganz konkret, um dort Servietten, Tupperdosen, Graubrot, Kartoffeln, Käse und Schinken für die Zwischenmahlzeit abzulegen. Dass muss doch jedem in Bayern für die evangelische Kirche arbeitenden Künstler spontan einleuchten, dass die Form hier der Funktion folgen muss. Und in Bayern triumphiert die Brotzeit über allem. Und so wird aus der gesamten Veranstaltung zum Thema „Bildstörung“ unter der Hand in der Rezeption eine simple Illustration des Themas. Vielleicht ist in Bayern ja auch nichts anderes zu erwarten. Denn es sei noch einmal voller Empörung daran erinnert, was in Bayern mit „Form follows function“ konkret gemeint ist. Auf dem Kunstobjekt von Madeleine Dietz, das in München-Riem als Altar „dient“, hatten Nutzer der Kirche bequemer Weise ihre Frühstücksutensilien abgelegt und das auch noch im Internet weltweit verbreitet. Niemand hat sich dafür bei der Künstlerin entschuldigt. Warum auch? In Bayern müssen Kunstobjekte, die als Altäre dienen, eben funktional sein und zwar ganz konkret, um dort Servietten, Tupperdosen, Graubrot, Kartoffeln, Käse und Schinken für die Zwischenmahlzeit abzulegen. Dass muss doch jedem in Bayern für die evangelische Kirche arbeitenden Künstler spontan einleuchten, dass die Form hier der Funktion folgen muss. Und in Bayern triumphiert die Brotzeit über allem.
Epilog
McCormacks ethnologische Reisebeschreibung durch Bayern enthält auch ein Kapitel über Bildende Kunst und Architektur. Dort heißt es: „Frömmigkeit (ist) ein Wesensmerkmal bayerischer Kunst. Von der Obrigkeit ist das religiöse Kunstschaffen logischerweise weiterhin gefördert worden. Der König persönlich hat dem begnadeten Künstler Heinrich Heß eine Euloge dargebracht: ‚Kirchenmaler bist du, ja! Gottbeseelt ist dein Pinsel.’ Als in unserer Zeit die Gruppe SPUR wegen ihrer urwüchsigen Formensprache in rechtliche Schwierigkeiten geriet, erkundigte sich einer der angeklagten Maler ausdrücklich, ob Gott als Zeuge geladen sei.“
Und – wen überrascht es – auch zum bayerischen Funktionalismus lässt sich bei McCormack etwas durch und durch Ironisches finden. Nach der unmittelbaren Nachkriegszeit „herrschte die Devise function follows form. Unter dieser Devise haben die Baumeister ihre verschönernde Hand erprobt. Es entstand die wuchtige Kaufhaus-Fassade an der Münchener Freiheit und die Kulturvollzugsanstalt am Gasteig. Mit der Kirche St. Matthäus gelang ein architektonisches Juwel, das Architekturstudenten aus aller Herren Länder anzieht. München leuchtet wieder mit Scheibenhochhäusern wie dem Arabellahaus oder dem Turm der Hypobank, ein Verwaltungssolitär von 114 Metern Höhe … eine Ehrensäule des Kapitalismus mit menschlichem Antlitz.“ Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
|


 McCormacks ethnologische Darstellung wird eröffnet mit einem Foto und dem folgenden Text: „Liberalitas Bavarica – Inschrift über dem Portal der Stiftskirche zu Polling bei Weilheim: eines der größten ungelösten Rätsel der Ethnographie. Der Wortsinn konnte nie befriedigend dechiffriert werden. Die Bedeutung bleibt wohl für immer im Dunkeln“. Wer die Worte im Internet eingibt, stößt auf folgende Erklärungsversuche: „Der Sinn ist unklar: bayerische Freiheit? liberale Gesinnung? Leben und leben lassen? Georg Lohmeier gibt als Erklärung: ‚Die Freiheit Bayerns – die bayerische Freigebigkeit – und als dritte die besondere liberale Gesinnung.’“ Die Freiheit ist den Bayern wichtig – oder etwa nicht?
McCormacks ethnologische Darstellung wird eröffnet mit einem Foto und dem folgenden Text: „Liberalitas Bavarica – Inschrift über dem Portal der Stiftskirche zu Polling bei Weilheim: eines der größten ungelösten Rätsel der Ethnographie. Der Wortsinn konnte nie befriedigend dechiffriert werden. Die Bedeutung bleibt wohl für immer im Dunkeln“. Wer die Worte im Internet eingibt, stößt auf folgende Erklärungsversuche: „Der Sinn ist unklar: bayerische Freiheit? liberale Gesinnung? Leben und leben lassen? Georg Lohmeier gibt als Erklärung: ‚Die Freiheit Bayerns – die bayerische Freigebigkeit – und als dritte die besondere liberale Gesinnung.’“ Die Freiheit ist den Bayern wichtig – oder etwa nicht? 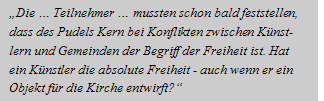 Der Bericht setzt ein mit einer zusammenfassenden Fokussierung: das Problem zwischen Künstlern und Gemeinden sei die absolute Freiheit, die die Kunst in Anspruch nehme. Nun ist die Formulierung „absolute Freiheit“ während der gesamten Veranstaltung überhaupt nicht gefallen, er ist eine wertende Überspitzung des Vorgetragenen. Gesprochen wurde von Freiheit im Sinne der Aufklärung, von Freiheit seitens des autonomen Subjekts usw. Von absoluter Freiheit in gesellschaftlichen Beziehungen zu sprechen, macht schon deshalb keinen Sinn, weil es den Begriff der Autarkie an jene Stelle setzt, wo nach vernünftiger Überlegung doch aufgeklärte Autonomie hingehört. Aber hier soll schon gleich am Beginn des Artikels eine bestimmte Assoziation hergestellt werden: wenn man sich auf Künstler einlässt, dann fordern sie gleich absolute Freiheit – gemeint ist, sie machen, was sie wollen. Das ist einfach Unsinn. Aber die unwillkürliche Assoziation des Begriffs Freiheit mit dem Teufel (der ja sprichwörtlich des Pudels Kern darstellt), das hat schon etwas.
Der Bericht setzt ein mit einer zusammenfassenden Fokussierung: das Problem zwischen Künstlern und Gemeinden sei die absolute Freiheit, die die Kunst in Anspruch nehme. Nun ist die Formulierung „absolute Freiheit“ während der gesamten Veranstaltung überhaupt nicht gefallen, er ist eine wertende Überspitzung des Vorgetragenen. Gesprochen wurde von Freiheit im Sinne der Aufklärung, von Freiheit seitens des autonomen Subjekts usw. Von absoluter Freiheit in gesellschaftlichen Beziehungen zu sprechen, macht schon deshalb keinen Sinn, weil es den Begriff der Autarkie an jene Stelle setzt, wo nach vernünftiger Überlegung doch aufgeklärte Autonomie hingehört. Aber hier soll schon gleich am Beginn des Artikels eine bestimmte Assoziation hergestellt werden: wenn man sich auf Künstler einlässt, dann fordern sie gleich absolute Freiheit – gemeint ist, sie machen, was sie wollen. Das ist einfach Unsinn. Aber die unwillkürliche Assoziation des Begriffs Freiheit mit dem Teufel (der ja sprichwörtlich des Pudels Kern darstellt), das hat schon etwas.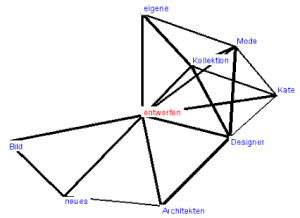 Und auch der nachfolgende Halbsatz ist bezeichnend: wenn ein Künstler ein Objekt für die Kirche entwirft – das ist ganz und gar die Sprache des Designs und der Architektur, also der angewandten Künste und nicht der freien Künste wie wir sie seit der Renaissance und der Reformation kennen. Künstler entwerfen keine Objekte – für wen auch immer. Mit dem Satz wird die Perspektive deutlich, unter der Künstler betrachtet werden sollen: als Objektgestalter, also als Handwerker und Designer. Aufgabe der Künstler sei es, Objekte für die Kirche zu entwerfen. Wer das Wort „entwerfen“ in den korpuslinguistischen Wortschatz der Uni Leipzig eingibt, bekommt als Assoziationengefüge konsequent „Kollektion, Mode, Designer, Architekten“. Das ist einer der zentralen Grundirrtümer, denen Künstler in der Kirche begegnen: dass sie bloß Gestalter kirchlich zu nutzender Objekte seien. Diese Form des verdinglichten Denkens, die Gegenstände nur noch in Gebrauchsfunktionen begreifen kann, ist erschreckend.
Und auch der nachfolgende Halbsatz ist bezeichnend: wenn ein Künstler ein Objekt für die Kirche entwirft – das ist ganz und gar die Sprache des Designs und der Architektur, also der angewandten Künste und nicht der freien Künste wie wir sie seit der Renaissance und der Reformation kennen. Künstler entwerfen keine Objekte – für wen auch immer. Mit dem Satz wird die Perspektive deutlich, unter der Künstler betrachtet werden sollen: als Objektgestalter, also als Handwerker und Designer. Aufgabe der Künstler sei es, Objekte für die Kirche zu entwerfen. Wer das Wort „entwerfen“ in den korpuslinguistischen Wortschatz der Uni Leipzig eingibt, bekommt als Assoziationengefüge konsequent „Kollektion, Mode, Designer, Architekten“. Das ist einer der zentralen Grundirrtümer, denen Künstler in der Kirche begegnen: dass sie bloß Gestalter kirchlich zu nutzender Objekte seien. Diese Form des verdinglichten Denkens, die Gegenstände nur noch in Gebrauchsfunktionen begreifen kann, ist erschreckend.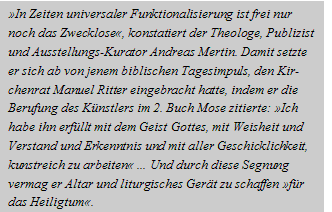 Auch der nächste Abschnitt ist von einer stupenden Unkenntnis abendländischer Kulturgeschichte. Künstler im heute gebrauchten Sinn des Wortes gab es zu biblischen Zeiten und auch in den darauf folgenden 1500 Jahren nicht. Die biblische Bezugsstelle spricht daher auch klar von Handwerkern, die beauftragt werden („ich habe ihm … handwerkliche Fähigkeit vermittelt“). Wenn man ein Beispiel für angewandte Kunst kennen lernen will, dann eignet sich Exodus 31, 1ff. bestens dafür. Hier geht es klar um Handwerk. Der Text sagt nichts anderes, als dass für bestimmte Aufgaben jeweils die besten Handwerker genommen werden sollen - weshalb Salomo zum Beispiel die heidnischen Phönizier mit dem Kunsthandwerk beauftragt, weil sie besser als die einheimischen Handwerker sind. Die Problemstellung des Kunstsymposiums, wie sich freie Kunst und Kirche heute begegnen, wird vom biblischen Text aber gar nicht erfasst und war auch vom Kirchenrat Ritter nicht intendiert. Es war keine funktionale Bibelauslegung. Vermutlich soll aber von Anfang an der Eindruck erweckt werden, dass nicht einmal im Entferntesten daran zu denken ist, dass freie Künstler in der Kirche arbeiten können - es sei denn sie verstehen sich als Designer. Kulturgeschichtlich nennt man das die Kunst als Ancilla Ecclesiae, also „als Dienerin der Kirche“. Es ist aber gerade die Reformation, die mit dieser Vorstellung aufgeräumt hat.
Auch der nächste Abschnitt ist von einer stupenden Unkenntnis abendländischer Kulturgeschichte. Künstler im heute gebrauchten Sinn des Wortes gab es zu biblischen Zeiten und auch in den darauf folgenden 1500 Jahren nicht. Die biblische Bezugsstelle spricht daher auch klar von Handwerkern, die beauftragt werden („ich habe ihm … handwerkliche Fähigkeit vermittelt“). Wenn man ein Beispiel für angewandte Kunst kennen lernen will, dann eignet sich Exodus 31, 1ff. bestens dafür. Hier geht es klar um Handwerk. Der Text sagt nichts anderes, als dass für bestimmte Aufgaben jeweils die besten Handwerker genommen werden sollen - weshalb Salomo zum Beispiel die heidnischen Phönizier mit dem Kunsthandwerk beauftragt, weil sie besser als die einheimischen Handwerker sind. Die Problemstellung des Kunstsymposiums, wie sich freie Kunst und Kirche heute begegnen, wird vom biblischen Text aber gar nicht erfasst und war auch vom Kirchenrat Ritter nicht intendiert. Es war keine funktionale Bibelauslegung. Vermutlich soll aber von Anfang an der Eindruck erweckt werden, dass nicht einmal im Entferntesten daran zu denken ist, dass freie Künstler in der Kirche arbeiten können - es sei denn sie verstehen sich als Designer. Kulturgeschichtlich nennt man das die Kunst als Ancilla Ecclesiae, also „als Dienerin der Kirche“. Es ist aber gerade die Reformation, die mit dieser Vorstellung aufgeräumt hat.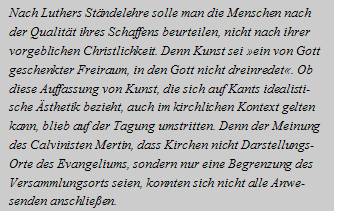 Im nächsten Abschnitt geht dann alles munter drunter und drüber. Dass wir Menschen nach der Qualität ihres Schaffens beurteilen sollen und dass Kunst ein uns von Gott geschenkter Freiraum ist, hat mit Kant oder der idealistischen Philosophie nun nichts zu tun, sondern ist genuine Lehre der Reformation. "Es ist hier angebracht, sich stets die Vorstellung zu vergegenwärtigen, dass das Sinnliche das Zeichen schlechthin der menschlichen Verfassung, der endlichen Erkenntnis darstellt. Es ist genau dies, durch welches sich der Mensch, der einen materiellen Körper und einen beschränkten Geist hat, von Gott, der reiner Geist und allwissend ist, unterscheidet.“ (Luc Ferry) Werner Hofmann hat dies vor einem viertel Jahrhundert in seiner berühmten Hamburger Ausstellung „Martin Luther und die Folgen für die Kunst“ dargestellt und von der Geburt der Moderne aus dem Geist der Religion gesprochen.
Im nächsten Abschnitt geht dann alles munter drunter und drüber. Dass wir Menschen nach der Qualität ihres Schaffens beurteilen sollen und dass Kunst ein uns von Gott geschenkter Freiraum ist, hat mit Kant oder der idealistischen Philosophie nun nichts zu tun, sondern ist genuine Lehre der Reformation. "Es ist hier angebracht, sich stets die Vorstellung zu vergegenwärtigen, dass das Sinnliche das Zeichen schlechthin der menschlichen Verfassung, der endlichen Erkenntnis darstellt. Es ist genau dies, durch welches sich der Mensch, der einen materiellen Körper und einen beschränkten Geist hat, von Gott, der reiner Geist und allwissend ist, unterscheidet.“ (Luc Ferry) Werner Hofmann hat dies vor einem viertel Jahrhundert in seiner berühmten Hamburger Ausstellung „Martin Luther und die Folgen für die Kunst“ dargestellt und von der Geburt der Moderne aus dem Geist der Religion gesprochen.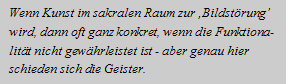 Der im kirchlichen Kontext gerne benutzte Begriff des sakralen Raumes ist ganz interessant. „Das neulateinische Kunstwort „sakral“ bezeichnet etwas unscharf alles, was auf das Heilige bezogen ist. Es ist erst seit dem Ende des 19. Jahrhunderts bekannt. Profan ist dagegen das, was vor der Sakralsphäre liegt, nämlich pro = vor, fanum = heiliger Bezirk.“ (Klemens Richter) Keinesfalls kann daher das Wort vom sakralen Raum zum Kernbestand evangelischer Überlieferung gehören, es kann geradezu als dessen Gegenteil begriffen werden: nämlich als Etablierung des Gegensatzes von profan und heilig. Christus ist aber der Herr der Welt und nicht nur des Tempels. Eine Kirche ist hoffentlich nie sakral und ihre Umgebung nie pro-fan!
Der im kirchlichen Kontext gerne benutzte Begriff des sakralen Raumes ist ganz interessant. „Das neulateinische Kunstwort „sakral“ bezeichnet etwas unscharf alles, was auf das Heilige bezogen ist. Es ist erst seit dem Ende des 19. Jahrhunderts bekannt. Profan ist dagegen das, was vor der Sakralsphäre liegt, nämlich pro = vor, fanum = heiliger Bezirk.“ (Klemens Richter) Keinesfalls kann daher das Wort vom sakralen Raum zum Kernbestand evangelischer Überlieferung gehören, es kann geradezu als dessen Gegenteil begriffen werden: nämlich als Etablierung des Gegensatzes von profan und heilig. Christus ist aber der Herr der Welt und nicht nur des Tempels. Eine Kirche ist hoffentlich nie sakral und ihre Umgebung nie pro-fan!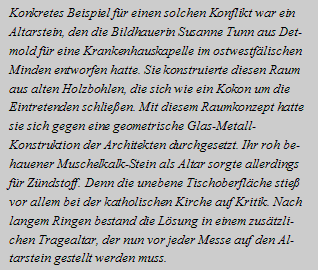 An dieser Beschreibung eines konkreten Beispiels stimmt nun so gut wie nichts – und gerade deshalb ist sie ein gutes Bespiel dafür, was der Kern des Problems ist: die binnenkirchliche Wahrnehmungsunfähigkeit, über die ich im größeren Teil meines Vortrages gesprochen habe. Weder stimmt es, dass die Künstlerin sich gegen die geometrische Glas-Metall-Konstruktion der Architekten durchgesetzt habe, vielmehr befindet sich ihr Raum-Objekt innerhalb der Stahl-Glas-Konstruktion, wie auf den während der Veranstaltung gezeigten Fotos auch deutlich zu erkennen war. Die elliptische Holzkonstruktion schließt sich auch nicht wie ein Kokon um den Besucher, sondern ist offen in alle Richtungen, so sehr, dass einige Menschen vor Ort meinten, sie sei zu offen für einen Meditations- und Andachtsraum.
An dieser Beschreibung eines konkreten Beispiels stimmt nun so gut wie nichts – und gerade deshalb ist sie ein gutes Bespiel dafür, was der Kern des Problems ist: die binnenkirchliche Wahrnehmungsunfähigkeit, über die ich im größeren Teil meines Vortrages gesprochen habe. Weder stimmt es, dass die Künstlerin sich gegen die geometrische Glas-Metall-Konstruktion der Architekten durchgesetzt habe, vielmehr befindet sich ihr Raum-Objekt innerhalb der Stahl-Glas-Konstruktion, wie auf den während der Veranstaltung gezeigten Fotos auch deutlich zu erkennen war. Die elliptische Holzkonstruktion schließt sich auch nicht wie ein Kokon um den Besucher, sondern ist offen in alle Richtungen, so sehr, dass einige Menschen vor Ort meinten, sie sei zu offen für einen Meditations- und Andachtsraum. Die Verbindung von ‚roh behauener Altarstein’ und ‚unebene Tischoberfläche’ muss nun beim Leser den Eindruck erwecken, die Künstlerin habe den Stein oben nur leicht behauen und deshalb würde alles umkippen, was man auf das Kunstobjekt stellen würde. Nichts ist weniger wahr. Selbstverständlich ist die Tischplatte sorgfältig bearbeitet und das war auch auf den Fotos sichtbar. Nur ist die Platte nicht plan geschliffen, sondern enthält unterschiedliche Plateaus, die der Logik des Steins und der ihn bildenden Natur folgen. Und ganz selbstverständlich kann man Kelch und Oblatenkorb auf den Altar stellen. Letztlich wird hier der Künstlerin unterstellt, schlecht gearbeitet zu haben. Das ist nun ganz und gar nicht der Fall, es handelt sich vielmehr um eine herausragende Arbeit – und zwar ebenso in ästhetischer wie in religiöser Perspektive.
Die Verbindung von ‚roh behauener Altarstein’ und ‚unebene Tischoberfläche’ muss nun beim Leser den Eindruck erwecken, die Künstlerin habe den Stein oben nur leicht behauen und deshalb würde alles umkippen, was man auf das Kunstobjekt stellen würde. Nichts ist weniger wahr. Selbstverständlich ist die Tischplatte sorgfältig bearbeitet und das war auch auf den Fotos sichtbar. Nur ist die Platte nicht plan geschliffen, sondern enthält unterschiedliche Plateaus, die der Logik des Steins und der ihn bildenden Natur folgen. Und ganz selbstverständlich kann man Kelch und Oblatenkorb auf den Altar stellen. Letztlich wird hier der Künstlerin unterstellt, schlecht gearbeitet zu haben. Das ist nun ganz und gar nicht der Fall, es handelt sich vielmehr um eine herausragende Arbeit – und zwar ebenso in ästhetischer wie in religiöser Perspektive. 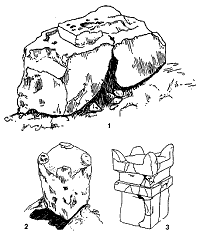 Was kontrovers war, war die Frage, ob ein Tisch vollständig plan geschliffen sein muss, um als Altartisch zu dienen. Und deshalb wurde im Rahmen der Veranstaltung auf zahlreiche Altäre verwiesen (u.a. Amish Kapoors Altar in der Dresdner Frauenkirche im evangelischen und Karl Prantls Altar im katholischen Bereich), die künstlerische Lösungen jenseits des planen Tisches darstellen und dennoch gewährleisten, dass man Kelch und Brot aufstellen kann. Und ganz abgesehen davon: der von der berichtenden Journalistin herausgestellte biblische Morgenimpuls nennt als kunsthandwerkliches Objekt den Brandopferaltar und dieser dürfte nun mit aller archäologischen Gewissheit keinesfalls plan geschliffen gewesen sein, sondern von einer derartigen Struktur, dass z.B. das Blut des Opfertieres problemlos abfließen konnte. M.a.W. der Altar hatte Rillen und Löcher.
Was kontrovers war, war die Frage, ob ein Tisch vollständig plan geschliffen sein muss, um als Altartisch zu dienen. Und deshalb wurde im Rahmen der Veranstaltung auf zahlreiche Altäre verwiesen (u.a. Amish Kapoors Altar in der Dresdner Frauenkirche im evangelischen und Karl Prantls Altar im katholischen Bereich), die künstlerische Lösungen jenseits des planen Tisches darstellen und dennoch gewährleisten, dass man Kelch und Brot aufstellen kann. Und ganz abgesehen davon: der von der berichtenden Journalistin herausgestellte biblische Morgenimpuls nennt als kunsthandwerkliches Objekt den Brandopferaltar und dieser dürfte nun mit aller archäologischen Gewissheit keinesfalls plan geschliffen gewesen sein, sondern von einer derartigen Struktur, dass z.B. das Blut des Opfertieres problemlos abfließen konnte. M.a.W. der Altar hatte Rillen und Löcher.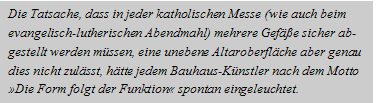 Der nächste Satz ist einfach nur Quatsch und ärgert mich maßlos. Wie schon dargestellt, ist es beim fraglichen Kunst-Objekt ohne jedes Problem möglich, Brot und Wein abzustellen. Nun aber kommt die Formulierung mit den Bauhaus-Künstlern und der Funktionsorientierung der Kunst. In einem Universitätsseminar würde ich einen solchen Satz als Ausdruck einer ungesunden Halbbildung scharf rügen. Der Satz „Form follows function“ wurde aufgestellt, als es das Bauhaus noch gar nicht gab, nämlich 1896 von dem Architekten Louis Henri Sullivan, dem wir einige der interessantesten Hochhäuser Amerikas verdanken. Er artikuliert ein Architektur- und Design-Verständnis, das spätestens mit der Post-Moderne hochgradig problematisiert wurde. Und was hat das mit dem Bauhaus zu tun? Auch das Bauhaus hat sich auf den Funktionalismus bezogen. Das Bauhaus war eben zunächst einmal eine Ausbildungsstätte für Designer und Architekten. Und für diesen Bereich gilt ja der Satz der Funktionsorientierung - zumindest für die Zeit der Moderne.
Der nächste Satz ist einfach nur Quatsch und ärgert mich maßlos. Wie schon dargestellt, ist es beim fraglichen Kunst-Objekt ohne jedes Problem möglich, Brot und Wein abzustellen. Nun aber kommt die Formulierung mit den Bauhaus-Künstlern und der Funktionsorientierung der Kunst. In einem Universitätsseminar würde ich einen solchen Satz als Ausdruck einer ungesunden Halbbildung scharf rügen. Der Satz „Form follows function“ wurde aufgestellt, als es das Bauhaus noch gar nicht gab, nämlich 1896 von dem Architekten Louis Henri Sullivan, dem wir einige der interessantesten Hochhäuser Amerikas verdanken. Er artikuliert ein Architektur- und Design-Verständnis, das spätestens mit der Post-Moderne hochgradig problematisiert wurde. Und was hat das mit dem Bauhaus zu tun? Auch das Bauhaus hat sich auf den Funktionalismus bezogen. Das Bauhaus war eben zunächst einmal eine Ausbildungsstätte für Designer und Architekten. Und für diesen Bereich gilt ja der Satz der Funktionsorientierung - zumindest für die Zeit der Moderne. Die berichtende Journalistin meint aber ergänzen zu müssen, „jedem Bauhaus-Künstler“ hätte die notwendige Funktionalität seiner Kunst eingeleuchtet. Jedem Bauhaus-Künstler? Gehen wir die Bauhaus-Künstler doch schnell mal durch: Johannes Itten - Paul Klee - Wassily Kandinsky – Josef Albers - Oskar Schlemmer - Gerhard Marcks. Wer von denen ist verdächtig, der Form-follows-Function-These zu folgen? Es mögen konstruktive, expressive oder konkrete Werke sein, die diese Künstler gemacht haben, aber funktional sind sie nicht. Was bitte schön ist an den abstrakt-geometrischen Bildern von Josef Albers funktional? Was an den konstruktivistischen Arbeiten Wassily Kandinskys? Und ist ausgerechnet Paul Klees Kunst ein Beispiel für Funktionalismus? Und die Skulpturen von Gerhard Marcks – sind es funktionale Skulpturen? Es wird schwer sein, die Bildenden Künstler, die am Bauhaus gearbeitet haben, in die Linie des architektonischen Funktionalismus zu stellen. Was hier allerdings unreflektiert repetiert wird, ist die Meinung des Architekten Walter Gropius, der die Künstler wieder den Handwerkern angleichen wollte: „Das Endziel aller bildnerischen Tätigkeit ist der Bau! … Architekten, Bildhauer, Maler, wir alle müssen zum Handwerk zurück! ... Der Künstler ist eine Steigerung des Handwerkers.“ Diese Vorstellung ist nun allerdings grandios gescheitert und wird von der Kunst nahezu des gesamten 20. Jahrhunderts dementiert – was übrigens Hans Sedlmayr im „Verlust der Mitte“ bitter beklagt hat.
Die berichtende Journalistin meint aber ergänzen zu müssen, „jedem Bauhaus-Künstler“ hätte die notwendige Funktionalität seiner Kunst eingeleuchtet. Jedem Bauhaus-Künstler? Gehen wir die Bauhaus-Künstler doch schnell mal durch: Johannes Itten - Paul Klee - Wassily Kandinsky – Josef Albers - Oskar Schlemmer - Gerhard Marcks. Wer von denen ist verdächtig, der Form-follows-Function-These zu folgen? Es mögen konstruktive, expressive oder konkrete Werke sein, die diese Künstler gemacht haben, aber funktional sind sie nicht. Was bitte schön ist an den abstrakt-geometrischen Bildern von Josef Albers funktional? Was an den konstruktivistischen Arbeiten Wassily Kandinskys? Und ist ausgerechnet Paul Klees Kunst ein Beispiel für Funktionalismus? Und die Skulpturen von Gerhard Marcks – sind es funktionale Skulpturen? Es wird schwer sein, die Bildenden Künstler, die am Bauhaus gearbeitet haben, in die Linie des architektonischen Funktionalismus zu stellen. Was hier allerdings unreflektiert repetiert wird, ist die Meinung des Architekten Walter Gropius, der die Künstler wieder den Handwerkern angleichen wollte: „Das Endziel aller bildnerischen Tätigkeit ist der Bau! … Architekten, Bildhauer, Maler, wir alle müssen zum Handwerk zurück! ... Der Künstler ist eine Steigerung des Handwerkers.“ Diese Vorstellung ist nun allerdings grandios gescheitert und wird von der Kunst nahezu des gesamten 20. Jahrhunderts dementiert – was übrigens Hans Sedlmayr im „Verlust der Mitte“ bitter beklagt hat.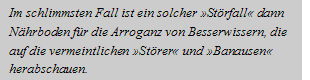 Dass kirchliche Berichterstattung dann auch noch polemisch und beleidigend werden kann, zeigt der folgende Satz. Das mit der „Arroganz von Besserwissern“ ist in aller Regel der Versuch, sich der Nötigung zum eigenen Argument zu entziehen. Ich kann’s nicht mehr hören. Dass, wer es besser weiß, schon gleich arrogant ist, nur weil er es sagt, kann nur in einer Gesellschaft artikuliert werden, die Intellektuelle so verachtet, wie die deutsche. Das Wort „Banause“ ist während der Veranstaltung nicht gefallen, auch wenn die Anführungsstriche darauf hindeuten könnten. Was aber, wenn wir das Wort einmal ernst nehmen, wenn wir die umgangssprachliche Stammtisch-Ebene verlassen und uns dem Wortsinn nähern? Banausen sind jene, die nicht zu den artes liberales (den freien Künsten) gehören, sondern zu den artes mechanicae, zum Handwerk. Man unterschied also schon in der Antike zwischen freier und funktionaler Arbeit und war der Ansicht, dass den Menschen die freie, zwecklose Arbeit aus den Niederungen des Alltags heraushob. Man schaute tatsächlich auf Banausen herab, aber nur, weil man mehr wollte als bloß Funktionieren.
Dass kirchliche Berichterstattung dann auch noch polemisch und beleidigend werden kann, zeigt der folgende Satz. Das mit der „Arroganz von Besserwissern“ ist in aller Regel der Versuch, sich der Nötigung zum eigenen Argument zu entziehen. Ich kann’s nicht mehr hören. Dass, wer es besser weiß, schon gleich arrogant ist, nur weil er es sagt, kann nur in einer Gesellschaft artikuliert werden, die Intellektuelle so verachtet, wie die deutsche. Das Wort „Banause“ ist während der Veranstaltung nicht gefallen, auch wenn die Anführungsstriche darauf hindeuten könnten. Was aber, wenn wir das Wort einmal ernst nehmen, wenn wir die umgangssprachliche Stammtisch-Ebene verlassen und uns dem Wortsinn nähern? Banausen sind jene, die nicht zu den artes liberales (den freien Künsten) gehören, sondern zu den artes mechanicae, zum Handwerk. Man unterschied also schon in der Antike zwischen freier und funktionaler Arbeit und war der Ansicht, dass den Menschen die freie, zwecklose Arbeit aus den Niederungen des Alltags heraushob. Man schaute tatsächlich auf Banausen herab, aber nur, weil man mehr wollte als bloß Funktionieren.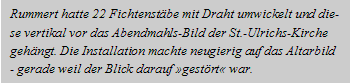 Abschließend meint die Berichterstatterin, dem eigentlichen Thema »Bildstörung« hätte sich vor allem der Künstler Bernd Rummert aus Schweinfurt genähert: Die Installation machte neugierig auf das Altarbild - gerade weil der Blick darauf ‚gestört’ war. Ja, da haben wir sie, die Funktion von zeitgenössischer Kunst in der Kirche. Was soll sie machen? Sie soll neugierig machen auf das Eigentliche, auf das Altarbild. Da wird mit einem Schlag der gesamte Prozess der Moderne verbal liquidiert. Es tut mir für Bernd Rummert leid, dass er im Nachhinein öffentlich so funktionalisiert wird. Vor Ort hatte er seine künstlerische Arbeitsweise erläutert, hatte die Stäbe durch das Publikum gereicht, damit man die konkreten Kunst-Objekte sinnlich erfahren konnte. Es ging in St. Ulrich ja schließlich um Kunst und nicht um eine Wahrnehmungsübung im Rahmen einer kirchenpädagogischen Veranstaltung. Wer das nicht versteht, hat vom Ganzen überhaupt nichts verstanden. Gerade Rummerts Kunst läuft jedem Funktionalismus zuwider, seine Arbeiten können geradezu als Aufschrei des Objekts gegen seine bloß scheinbare Funktion begriffen werden. Wenn Form, dann im Zustand ihrer Auflösung - wie Andreas Link einmal zu Rummerts Arbeiten sagte.
Abschließend meint die Berichterstatterin, dem eigentlichen Thema »Bildstörung« hätte sich vor allem der Künstler Bernd Rummert aus Schweinfurt genähert: Die Installation machte neugierig auf das Altarbild - gerade weil der Blick darauf ‚gestört’ war. Ja, da haben wir sie, die Funktion von zeitgenössischer Kunst in der Kirche. Was soll sie machen? Sie soll neugierig machen auf das Eigentliche, auf das Altarbild. Da wird mit einem Schlag der gesamte Prozess der Moderne verbal liquidiert. Es tut mir für Bernd Rummert leid, dass er im Nachhinein öffentlich so funktionalisiert wird. Vor Ort hatte er seine künstlerische Arbeitsweise erläutert, hatte die Stäbe durch das Publikum gereicht, damit man die konkreten Kunst-Objekte sinnlich erfahren konnte. Es ging in St. Ulrich ja schließlich um Kunst und nicht um eine Wahrnehmungsübung im Rahmen einer kirchenpädagogischen Veranstaltung. Wer das nicht versteht, hat vom Ganzen überhaupt nichts verstanden. Gerade Rummerts Kunst läuft jedem Funktionalismus zuwider, seine Arbeiten können geradezu als Aufschrei des Objekts gegen seine bloß scheinbare Funktion begriffen werden. Wenn Form, dann im Zustand ihrer Auflösung - wie Andreas Link einmal zu Rummerts Arbeiten sagte. Und so wird aus der gesamten Veranstaltung zum Thema „Bildstörung“ unter der Hand in der Rezeption eine simple Illustration des Themas. Vielleicht ist in Bayern ja auch nichts anderes zu erwarten. Denn es sei noch einmal voller Empörung daran erinnert, was in Bayern mit „Form follows function“ konkret gemeint ist. Auf dem Kunstobjekt von Madeleine Dietz, das in München-Riem als Altar „dient“, hatten Nutzer der Kirche bequemer Weise ihre Frühstücksutensilien abgelegt und das auch noch im Internet weltweit verbreitet. Niemand hat sich dafür bei der Künstlerin entschuldigt. Warum auch? In Bayern müssen Kunstobjekte, die als Altäre dienen, eben funktional sein und zwar ganz konkret, um dort Servietten, Tupperdosen, Graubrot, Kartoffeln, Käse und Schinken für die Zwischenmahlzeit abzulegen. Dass muss doch jedem in Bayern für die evangelische Kirche arbeitenden Künstler spontan einleuchten, dass die Form hier der Funktion folgen muss. Und in Bayern triumphiert die Brotzeit über allem.
Und so wird aus der gesamten Veranstaltung zum Thema „Bildstörung“ unter der Hand in der Rezeption eine simple Illustration des Themas. Vielleicht ist in Bayern ja auch nichts anderes zu erwarten. Denn es sei noch einmal voller Empörung daran erinnert, was in Bayern mit „Form follows function“ konkret gemeint ist. Auf dem Kunstobjekt von Madeleine Dietz, das in München-Riem als Altar „dient“, hatten Nutzer der Kirche bequemer Weise ihre Frühstücksutensilien abgelegt und das auch noch im Internet weltweit verbreitet. Niemand hat sich dafür bei der Künstlerin entschuldigt. Warum auch? In Bayern müssen Kunstobjekte, die als Altäre dienen, eben funktional sein und zwar ganz konkret, um dort Servietten, Tupperdosen, Graubrot, Kartoffeln, Käse und Schinken für die Zwischenmahlzeit abzulegen. Dass muss doch jedem in Bayern für die evangelische Kirche arbeitenden Künstler spontan einleuchten, dass die Form hier der Funktion folgen muss. Und in Bayern triumphiert die Brotzeit über allem.