
Intimität |
||||
Die intime Botschaft der Musik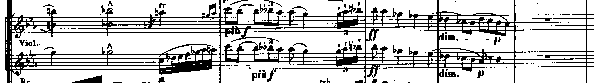
Nietzsches Musizieren in drei AktenManos Perrakis
Betrachtet man die Biographie Nietzsches, wird man schnell feststellen, dass Nietzsche, was die Musik betrifft, ein exemplarisches Individuum seiner Zeit ist. Seit seiner Kindheit musiziert er stundenlang am Klavier und beginnt frühzeitig seine eigenen Stücke zu komponieren. Er ist ein leidenschaftlicher Hörer, der immer wieder betont, wie stimulierend die Musik auf den Geist wirkt. Er schließt sogar seine Freundschaften nach musikalischen Kriterien und pflegt Kontakte zu bedeutenden Musikern seiner Epoche, als erwartete er eine neue Kultur aus dem Geist der Musik. Er versucht nicht nur, die ihn umgebende musikalische Atmosphäre in seine Schriften zu übertragen – und es gibt quasi keine Schrift von ihm, in der die Musik nicht auf die eine oder die andere Weise anwesend ist – das Musikalische ist bei Nietzsche so facettenreich, dass man es kaum in seiner Tragweite erkennen kann. In diesem Essay werden wir uns auf die Tätigkeit des Musizierens beschränken.[1]
Was bedeutet es, wenn ein Philosoph musiziert? Bedeutet es etwas anderes als das bloß private Moment des Gefallens an der schönen Form? Ist das Musizieren für einen Philosophen vielleicht von besonderer Bedeutung, weil es ein Moment der Entlastung vom Erkenntniszwang darstellt? Beispiele gibt es reichlich, die uns eher das Gegenteil lehren, denn der Erkenntniszwang umfasst auch den Bereich des Privaten. Dies gilt umso mehr bei jenen Denkern, die aus einem existentiellen Impuls heraus philosophieren und zu denen Nietzsche ohne Zweifel gehört. Das Bedürfnis nach Entlastung allerdings besteht tatsächlich, zumal Entlastung auch als Mittel der Stärkung wahrgenommen werden kann, als momentane Erholung von der Erkenntnis, um gestärkt zu ihr zurückkehren zu können. Dann aber kann diese Entlastung nicht klar vom Erkenntniszwang getrennt sein. Es muss eher um eine Spannung zwischen diesen beiden scheinbaren Polen gehen oder um ein Versteckspiel, um Pathos und Distanz. Intimität wäre dann ein anderes Wort für dieses Versteckspiel, und dieses Versteckspiel soll hier in drei Akten dargestellt werden. I. NaumburgOstern 1864. Nietzsche steht kurz vor dem Abitur, sitzt am Klavier und spielt die Consolations von Franz Liszt. Davon gibt er Bericht in einem kurzen Text, der die Überschrift „Über Stimmungen“ trägt. Nietzsche schreibt dort:
Hier wird sofort ersichtlich, dass die Musik als Mittel der Auseinandersetzung mit den eigenen Stimmungen fungiert. Die Musik wird nicht so sehr als Entlastung wahrgenommen, sondern als Stimulans zur Selbstreflexion. Was aber macht den Umgang mit Stimmungen so schwierig? Stimmungen sind schwebend und schwankend, sie lassen sich auch von ihrem Träger nur schwer fassen, geschweige denn anderen mitteilen, wie Nietzsche ein Paar Jahre später an Hans von Bülow gesteht: „Denken Sie, daß ich bis jetzt, seit meiner frühsten Jugend, somit in der tollsten Illusion gelebt und sehr viel Freude an meiner Musik gehabt habe! […] Ein Problem blieb es mir immer, woher diese Freude stamme? Sie hatte so etwas Irrationelles an sich, ich konnte in dieser Beziehung weder rechts noch links sehen, die Freude blieb.“[3] Stimmungen sind also abstrakte Bewegungen im Gemüt, fern von Anschauung und fern vom Begriff. Weil sie aus der Tiefe des Ich kommen, darf man sie als intim bezeichnen. Der klassische Topos der Musikästhetik lautet, die Musik sei die Sprache von Affekten, wobei man Affekte auch mit Stimmungen und Gefühlen unter dem Nenner der inneren Welt gleichsetzen könnte. Insofern nämlich, als die Musik die Sprache der Welt der Innerlichkeit ist, erscheint die Kategorie der Intimität zur Beschreibung der Musik angemessen. Diese Intimität wäre dann das Ergebnis der Begegnung zwischen der formalen Innerlichkeit des Werkes und der Innigkeit des Hörers. Diese Begegnung wäre aus der Perspektive des Hörers die Entschlüsselung einer intimen Botschaft. Intim wäre dann der gute Wille des Hörers, sich selbst der Innerlichkeit des Werkes zu überlassen, und durch und durch in Übereinstimmung mit Nietzsches markanter Definition der Kunst als „Freude sich mitzutheilen (und zu empfangen von einem Reicheren) – durch Gestalten die Seelen formen –“[4] Anders gesagt, der Reichere (z.B. ein Sänger, der am Ende eines Konzerts während des Applauses mit seinem Blick das Publikum durchstreift) gibt einen diskreten Wink als Erinnerung an eine alte Wahrheit: Tiefe Monologe entstehen immer mitten im Gespräch. II. BaselIn den gesellschaftlichen Kreisen, in denen der junge Professor Nietzsche immer gern gesehen war, galt vierhändiges Klavierspiel als Selbstverständlichkeit. Die Innigkeit dieses Spiels lässt sich leicht vorstellen. Die beiden Partner sitzen neben einander und legen zusammen die Finger auf die Tasten. Ein rascher Blick – einem tiefen Einatmen ähnlich – schafft die notwendige Stimmung und gibt das Anfangssignal. Die beiden Partner können sich wohl mit „Sie“ ansprechen, man erwartet aber ein verheißungsvolleres Spiel, wenn sie sich duzen. Franz Overbeck, ein Basler Kollege Nietzsches, Professor für Theologie, war einer der wenigen, mit denen sich Nietzsche duzte. Man darf annehmen, dass die beiden Kollegen und Hausgenossen, die eine sofortige Sympathie miteinander verband, das Musizieren als Feier empfanden. Was könnte aber das gemeinsame Musizieren für eine schon sehr feste und früh gefestigte Freundschaft bedeuten? Versteht man dieses Musizieren als eine Botschaft - im Sinne einer Mitteilung - steht man vor einer großen Schwierigkeit. Diese Schwierigkeit hängt mit einem anderen klassischen Topos der Musikästhetik zusammen, der eng mit dem romantischen Paradigma verbunden ist: dem Topos des Unsagbaren, das in der Romantik oft zu einem Begriff für die Transzendenz wurde. Lassen wir aber diese metaphysische Prägung beiseite und versuchen wir, den schwer klingenden Begriff des Unsagbaren einigermaßen zu entladen. Mit dem Unsagbaren verhält es sich mehr oder weniger wie mit dem Unbewussten. Eine solche Analogie muss erlaubt sein, denn was nicht bewusst ist, muss auch unsagbar sein, während das Bewusstsein immer auf Mitteilung angewiesen ist. Unbewusst ist für Nietzsche, was noch nicht oder nicht mehr bewusst ist.[5] Unbewusst kann also auch eine Erwartung oder ein Versprechen sein. Und was ist Freundschaft sonst als Erwartung und Verspechen? Freundschaft, so mag man einwenden, bedürfe keiner Bestätigung, doch gemeint ist eine Bestätigung im Sinn einer Verdoppelung des Vorhandenen, auch als Vergeudung, Verschwendung, Fülle oder Dankbarkeit zu denken. Das sind Worte, die häufig in Nietzsches Texten vorkommen. Sie sind als Attribute eines Steigerungsprinzips zu verstehen, das dem Leben inhärent ist. Diese Steigerung bedarf einer entsprechenden symbolischen Sprache. Der Ausdruck durch Worte erschiene hier unzureichend: „Im Verhältniß zur Musik ist alle Mittheilung durch Worte von schamloser Art; das Wort verdünnt und verdummt; das Wort entpersönlicht: das Wort macht das Ungemeine gemein“.[6] In dieser Aussage stellt das Wort eher das Gegenteil von einer Steigerung dar, es ist eher eine Entladung, denn es „verdünnt“. Was aber heißt es, dass das Wort „entpersönlicht“? Was ist das persönlichste Element eines Individuums, dasjenige Merkmal, das die Individualität eines Menschen ausmacht? Ein guter Kandidat wäre hier das Gefühl. Nietzsche meint mit Gefühl die begleitenden Vorstellungen, die wir über dieses Gefühl haben, plus einen begrifflich, d.h. wörtlich, unauflösbaren Rest[7]. Dieser Rest muss der wichtigste Teil des Gefühls sein, er ist auch der persönlichste, der eigenste oder der intimste. Durch Worte verletzen wir diesen unauflösbaren Teil, indem wir versuchen, ihn begrifflich festzulegen. Nach Nietzsche bedeutet diese begriffliche Festlegung immer eine Verallgemeinerung, also einen Schritt aus der individuellen Eigenartigkeit, während die Musik mittels der plastischen Kraft des Gefühls „individualisiert“[8]. Interessanterweise kämpft man aber genau um den Ausdruck dieses Teils, denn dieser Teil ist derjenige, der jeden Rausch hervorbringt und die zentrifugale Kraft des ästhetischen Zustandes ausmacht. Denn es ist jener Teil, der, um der Erkenntnis und der Kommunikation willen, mitgeteilt, aber auch in seiner Integrität bewahrt werden soll. Der Musik scheint dies besser zu gelingen als den anderen symbolischen Sprachen. Warum? Weil beides, Musik und Gefühl, begrifflich unauflösbar ist: Insofern Subjekt und Objekt in der Musik einander nicht – auch nicht in einem Verhältnis der Nachahmung - gegenüberstehen, kann sie als Ausdruck dieses begrifflich unauflösbaren Restes kodifiziert werden. In einem mimetischen Paradigma scheint eine solche Annahme willkürlich, sie sagt aber vieles über das tiefe Bedürfnis des Ausdrucks und hat den Vorteil, „ungemein“ zu sein, wobei sich hier dieser Vorteil leicht zum Nachteil wandeln kann, da jede denkbare Sinngebung möglich ist! So kann ein unauflösbarer Rest auf vielfältige Art und Weise interpretiert werden. Es kann sowohl der persönlichste Teil, als auch derjenige Teil gemeint sein, an dem alle teilhaben und der sich irgendwie jenseits des Individuellen befindet. Etwas als unauflösbar zu bezeichnen und jenseits der Individuation zu lokalisieren, heißt auch, es als Ursprung mystifizieren zu können. Genau dies tat die literarische Romantik, indem sie diesen Teil des Gefühls mit der Präsenz Gottes identifizierte und die Musik daher als Sprache einer göttlichen Offenbarung verehrte, eine Perspektive, die ihren philosophischen Ausdruck bei Schopenhauer, aber auch in Nietzsches Geburt der Tragödie findet. Lassen wir aber diesen kritischen Aspekt beiseite und wiederholen wir lediglich, was Nietzsche in einer späteren Selbstkritik über die Geburt der Tragödie, in der er eine metaphysische Hypothese über den Sinn der Musik aufstellt, gesagt hat: „Die Übertragung der Musik in’s Metaphysische war ein Akt der Verehrung und Dankbarkeit“[9]. Will man das Vornehme ins Wort bringen oder das Intime in seiner Eigenartigkeit bewahren, muss man mit dem Unsagbaren operieren - im Grunde genommen liegt das Geheimnis guter Dichtung darin.[10] Die Poesie bedient das Wort, allerdings auf ihre eigenartige Art und Weise und ohne die geringste Pflicht gegenüber Anschauung und Begrifflichkeit zu haben. Bei der Musik gibt es weder Anschauung noch Begriff, nur Innerlichkeit, die sich fühlt oder gefühlt wird. Deshalb kann die Musik als Medium einer intimen Mitteilung des Unsagbaren bezeichnet werden. Dies umso mehr, wenn man das Verhältnis des Menschen zu Gott als Vorbild aller intersubjektiven Beziehungen versteht. Wenn der Freund als „Fest der Erde“[11] gefeiert wird, wo sonst ist das Vorbild zu suchen, zumal wenn man den Menschen als Fest der Erde feiern darf? Auch die Intimität hätte dann dort ihren Ort. III. Nochmal NaumburgEnde August 1882. Im Frühjahr hat Nietzsche in Rom Lou Salomé kennengelernt. Er komponiert seinen Hymnus an das Leben. Es handelt sich um eine Vertonung des Gedichtes Gebet an das Leben von Lou Salomé, wobei Nietzsche den Text leicht variiert:
Bei diesem Gedicht geht es um eine lyrische Exposition dessen, was bei Nietzsche als amor fati bekannt ist und eine bedingungslose Bejahung des diesseitigen Leben bedeutet, wobei man das Leben auch in Gestalt eines Freundes personifiziert denken kann, zu dem man ein sehr intensives Verhältnis hat. Sieht man das Gedicht Salomés aus diesen Gründen als eine Zuwendung an Nietzsche, darf man seinen Hymnus als eine Geste der Erwiderung betrachten, zumal er den Text transkribiert und vertont. Stellt man beide Texte nebeneinander, nehmen sie den Charakter eines intimen Briefwechsels an.[13] Bei Menschen, die sich bekanntlich selbst nie verschont haben (Lou: „[…] wenn uns Jemand zugehört hätte, er würde geglaubt haben, zwei Teufel unterhielten sich“[14]), muss die Intensität, die eine lange Nähe unmöglich macht (Nietzsche nach Lou: „ich darf nicht lange in Ihrer Nähe leben“[15]), in etwas Drittes entladen werden: z.B. den existentiellen Imperativ des amor fati. Bleiben wir aber bei der Briefmetapher. Man denke an ein vertrautes Bild. Wir bekommen einen Brief, und wir lesen ihn uns vor oder inwendig. Dieses Vorlesen ist als eine Art Vergegenwärtigung zu denken. Beim Vorlesen stellt man sich die Stimme der Person vor, die den Brief gesendet hat. Durch das Vorlesen der fremden Wörter eignet man sich die Stimme der Person an, die fern ist und doch so nah in der Handschrift lebt. Die fremden Wörter mischen sich mit der eigenen Stimme in einem Spiel von An- und Abwesenheit. Im Film beispielsweise hören wir, wenn eine Person einen Brief liest, meist die Stimme des Absenders, in Romanen sind Briefe oft kursiv gedruckt. In früheren Zeiten war der Brief die naheste Kontaktform für Menschen war, die nicht beisammen sein konnten oder durften. Das ist der glückliche Fall. Es gibt aber auch den unglücklichen. Wenn man nicht mehr beisammen ist wegen Trennung im Leben oder durch Tod, ist die kompensatorische Leistung des Briefes nicht zu unterschätzen. Die Vergegenwärtigung nimmt dann andere Nuancen an, da die Person, zu der die Stimme, die Innerlichkeit des Briefes, gehört, nicht mehr da ist. Einen innigen Brief liest man mehr als einmal. Je wichtiger ein Brief, desto intensiver seine Wirkung jedes Mal, wenn man ihn zur Hand nimmt. Wie der Blick in die Handschrift gleitet, erinnert an einen Dialog. In dieser Hinsicht ähnelt das inwendige Vorlesen dem performativen Charakter eines musikalischen Werkes. Das Vorlesen, das einem inneren Hören gleicht, ist mit dem Spielen oder Hören eines musikalischen Stückes zu vergleichen. Man gibt der Versuchung der Wiederholung nach, entdeckt dabei immer neue Dimensionen und entlädt seine Affekte durch die abstrakten des musikalischen Gebildes, damit man von schweren Bildern erlöst wird. Die Handschrift ist etwas Lebendiges, mit dem man in Berührung kommt; beim Klavierspielen verhält es sich ähnlich, denn es ist immer eine Individualität, die abstrakte Noten einer Partitur belebt[16]. Das Musizieren gleicht einem intimen Briefkontakt. Es kann wie das enthusiastische Spielen einer eigenen Komposition oder wie das inwendige Lesen eines alten Briefs sein. Pathos braucht Distanz, um sich seiner selbst zu bemächtigen. Intimität ist ein anderes Wort dafür. Anmerkungen[1] Dazu siehe u.a. Janz, Curt Paul: Die Kompositionen Friedrich Nietzsches, in: Nietzsche-Studien 1 (1972) S. 173-184, Ders.: Die Musik im Leben Friedrich Nietzsches, in: Nietzsche-Studien 26 (1997), S. 72-86; Bloch, Peter André: Nietzsche als Gesellschaftsmusiker zwischen Parodie und Pathos, in: Nietzscheforschung 13 (2006), S. 93-114. [2] Nachgelassene Aufzeichnungen Herbst 1862 – Sommer 1864 17 [5] in: Nietzsche. Werke. Kritische Gesamtausgabe (KGW), begründet von G. Colli und M. Montinari, weitergeführt von W. Müller-Lauter und K. Pestalozzi, Berlin und New York 1967 ff., W. de Gruyter, Bd. I 3, S. 371-372. [3] Brief vom 29. Oktober 1872 an Hans von Bülow, in: Friedrich Nietzsche. Sämtliche Briefe. Kritische Studienausgabe (KSB), hrsg. von G. Colli und M. Montinari, W. de Gruyter, Berlin/ New York 1986, Bd. 4, S. 79. [4] Nachgelassene Fragmente Sommer – Herbst 1884 26 [40] in: Nietzsche. Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe (KSA), hrsg. von G. Colli und M. Montinari, Berlin/New York 1980, Bd. 11, S. 158. [5] Vgl. Schlimgen, Erwin: Nietzsches Theorie des Bewußtseins, W. de Gruyter, Berlin/New York, 1999, S. 187 ff. [6] Nachgelassene Fragmente Herbst 1887 10 [60] (188), KSA 12, S. 493. [7] Vgl. Nachgelassene Schriften 1870 – 1873, Die Dionysische Weltanschauung, KSA 1, S. 572. [8] Vgl. Unzeitgemäße Betrachtungen IV, Richard Wagner in Bayreuth, KSA 1, S. 456 ff. [9] Nachgelassene Fragmente Herbst 1885 – Herbst 1886 2 [113] KSA 12, S. 118. [10] Dazu der Aphorismus 105 von Menschliches, Allzumenschliches II mit der Überschrift „Sprache und Gefühl“: „Dass die Sprache uns nicht zur Mittheilung des Gefühls gegeben ist, sieht man daraus, dass alle einfachen Menschen sich schämen, Worte für ihre tieferen Erregungen zu suchen: die Mittheilung derselben äussert sich nur in Handlungen, und selbst hier giebt es ein Erröthen darüber, wenn der Andere ihre Motive zu errathen scheint. Unter den Dichtern, welchen im Allgemeinen die Gottheit diese Scham versagte, sind doch die edleren in der Sprache des Gefühls einsilbiger, und lassen einen Zwang merken: während die eigentlichen Gefühls-Dichter im praktischen Leben meistens unverschämt sind.“ (KSA 2, S. 421 - 422). [11] Also sprach Zarathustra I, Die Reden Zarathustra’s, Von der Nächstenliebe, KSA 4, S. 78. [12] zit. nach Walther, Helmut: Nietzsche als Komponist. Vortrag beim Seminar der Gesellschaft für kritische Philosophie in Kottenheide zu Nietzsches 100. Geburtstag vom 15-17 Oktober 2000, im Internet unter http//www.virtusens.de/walther/n_komp.htm. [13] Für Curt Paul Janz haben die Kompositionen Nietzsches den Charakter eines intimen Briefes. Vgl. Janz, Curt Paul: Die Kompositionen Friedrich Nietzsches, in: Nietzsche- Studien 1 (1972) S. 183. [14] zit. nach Chronik zu Nietzsches Leben, KSA 15, S. 125. [15] Ebd. [16] Vgl. dazu den Aphorismus 172 von Menschliches, Allzumenschliches I: „Den Meister vergessen machen. – Der Clavierspieler, der das Werk eines Meisters zum Vortrag bringt, wird am besten gespielt haben, wenn er den Meister vergessen liess und wenn es so erschien, als ob er eine Geschichte seines [Hervorhebung von M.P.] Lebens erzähle oder jetzt eben Etwas erlebe. Freilich: wenn er nichts Bedeutendes i s t, wird Jedermann seine Geschwätzigkeit verwünschen, mit der uns aus seinem [Hervorhebung von M.P.] Leben erzählt. Also muss er verstehen, die Phantasie des Zuhörers für sich einzunehmen. Daraus wiederum erklären sich alle Schwächen und Narrheiten des ‚Virtuosentums‘.“ (KSA 2, S. 159). |
||||
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/53/mp1.htm
|
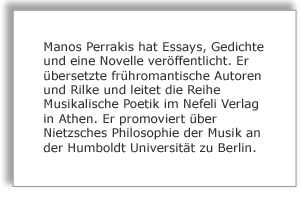 Kaum ein anderer Philosoph scheint ein so intensives Verhältnis zur Musik zu haben wie Friedrich Nietzsche. Das hängt zum großen Teil damit zusammen, dass er das Glück – in gewisser Hinsicht auch das Unglück – hatte, in einem Zeitalter zu leben, das von der Musik dominiert war. Denn im 19. Jahrhundert erfährt die Musik ihre höchste Würdigung als Kunst und belegt den ersten Platz in der Hierarchie der Künste.
Kaum ein anderer Philosoph scheint ein so intensives Verhältnis zur Musik zu haben wie Friedrich Nietzsche. Das hängt zum großen Teil damit zusammen, dass er das Glück – in gewisser Hinsicht auch das Unglück – hatte, in einem Zeitalter zu leben, das von der Musik dominiert war. Denn im 19. Jahrhundert erfährt die Musik ihre höchste Würdigung als Kunst und belegt den ersten Platz in der Hierarchie der Künste.