
Film-Lektüren |
Locked-In
Schmetterling und TaucherglockeHans J. Wulff Le Scaphandre et le Papillon / The Diving Bell and the Butterfly (Schmetterling und Taucherglocke). - USA/Frankreich 2007. Regie: Julian Schnabel. Buch: Ronald Harwood. Nach dem Buch von Jean-Dominique Bauby. Darsteller: Jean-Dominique [„Jean-Do“] Bauby (Mathieu Amalric), Céline Desmoulins (Emmanuelle Seigner), Henriette Durand, Logopädin (Marie-Josée Croze), Papinou, Baubys Vater (Max von Sydow), Père Lucien (Jean-Pierre Cassel), Claude, Lektorin (Anne Consigny), Marie Lopez , Physiotherapeutin (Olatz Lopez Garmendia). Kamera: Janusz Kaminski. Schnitt: Juliette Welfing. Produktion: Kathleen Kennedy. Verleih: Prokino. 112 Min. FSK-Freigabe: ab 12. Auszeichnungen: Golden Globe; Großer Preis in Cannes (beide für die beste Regie).
Bauby leide unter dem „Locked-In-Syndrom“, fasst einer der Ärzte zusammen. Locked-In, gefangen in einem Körper, der sich mit der Außenwelt kaum noch austauschen kann. Schon Dalton Trumbos Johnny Got His Gun (Johnny zieht in den Krieg, 1971) hatte diesen Alptraum inszeniert. Doch während in diesem Film das eingesperrte Bewusstsein den Kontakt zur Realität immer mehr verliert und sich immer mehr surrealistische Elemente in die inneren Bildvorstellungen des Patienten einmischen, kehrt der Bauby in Schnabels Film immer mehr zur Realität zurück - am Ende imaginiert er die Szene, die im Krankenhaus endet: Er hat mit seinem neuen Auto seinen Sohn abgeholt, als ihm auf der Fahrt schlecht wird und er in Ohnmacht fällt. In Trumbos Film kulminiert die Handlung am Ende in dem unbedingten und vehement vorgetragenen Wunsch, sterben zu wollen. Baubys Geschichte dagegen endet mit einer Läuterung der Person und einer Einsicht in die wirklich wichtigen Wertstellungen des Lebens: „Als ich gesund war, war ich gar nicht lebendig. Ich war nicht da. Es war recht oberflächlich. Aber als ich zurückkam, mit dem Blickwinkel des Schmetterlings, wurde mein wahres Ich wiedergeboren.“ Selbstmordgedanken spielen gleich zu Beginn eine Rolle; eine der Schwestern weist Bauby empört zurück, und in einem Traum begleitet er sie sogar in eine Messe, in der er das Abendmahl bekommt. Gefangen-Sein ist für Bauby schon früher ein Thema gewesen - er hatte vor, eine Neufassung des „Grafen von Monte Christo“ mit einer weiblichen Heldin zu schreiben; doch diese Geschichte endet mit einer Kaskade von Rache-Aktionen, nach jahrzehntelanger Gefangenschaft der Rächerin. In Baubys eigener Geschichte verdrehen sich dagegen die Akzente ins Gegenteil - hier geht es um das Bekenntnis zum Ich, die Abwehr des Todeswunsches, das Einwilligen in die vollständige Hilflosigkeit. Das ist keine Rückkehr zum Leben, bei der die Realität sich immer mehr einstellt und das Individuum immer mehr Handlungsmacht wiedergewinnt (wie in Georges Simenons Les Annaux de Bicêtre / Die Glocken von Bicêtre, 1963). Bauby muss sich mit der Unwiedererreichbarkeit seiner vorherigen Lebensumstände abfinden. Er sei zu Gemüse geworden, erheischt er einmal einen Gesprächsfetzen (und das Bild des Pflanze-Werdens als Übergang zum Tod ist spätestens seit Takeshi Kitanos Hana-Bi, 1997, auch bei uns verständlich). Was bleibt, sind Erinnerungen, sind Phantasien, sind Begegnungen mit Personen. Und es sind die Zuwendungen der schönen Schwestern, die sich dem Kranken mit unendlich erscheinender Geduld widmen, eine Langsamkeit akzeptierend, die dem vorherigen Leben als Chefredakteur strikt entgegensteht. So sehr der Körper sich als Gefängnis darstellt, so sehr ist Baubys Phantasie ungezügelt. Der Titel benennt den Widerspruch, in dem sich Bauby befindet; das Bild einer Taucherfigur in ungetümem Taucheranzug wird immer wieder in Baubys Träumen auftreten. Mag diese säkular-rhetorische Figur der Freiheit der Gedanken (trotz der Gefangenheit des Körpers) ebenso naiv und schlicht erscheinen wie die treuherzig-religiöse Vorstellung, erst schwerste Krankheit gebe Gelegenheit zur inneren Läuterung, und mag auch die ungebrochene Liebenswürdigkeit und Milde der Pflegenden wie eine kindliche Phantasie einer klösterlich anmutenden Idylle erscheinen, so ist Schmetterling und Taucherglocke keine moralische Parabel. Sein Wert liegt in anderem. Im grandiosen Spiel Mathieu Amalrics, der mit dem Minimum an Ausdrucksmitteln, das ihm zur Verfügung steht, immer wieder eine erstaunliche Genauigkeit des Ausdrucks erreicht - es ist sein Blick und es ist die Stellung des Auges, die dem grotesk bewegungsunfähigen Körper entgegenstehen und zeigen, dass hier ein lebendiges Bewusstsein auf das reagiert, was geschieht. Im Einsatz der Musik, die von Beginn an den Tonfall der Leichtigkeit und der Melancholie anschlägt; Charles Trenets „La Mer“ eröffnet den Film, Stücke von U2 und Tom Waits sind langen Traum- und Erinnerungsstücken unterlegt; und ein Stück von Bach begleitet eine lange Sequenz, die das Abbrechen von Eis von einem Gletscher und seinen Fall in das heftig aufspritzende Meer zeigt (dass diese Aufnahmen, die wie eine Allegorie des Werdens und Vergehens wirken, im Rückwärtslauf dem Abspann-Ende unterlegt sind, mag wie eine Spielerei wirken, auch wenn Schnabel in einem Interview sagte, „das wäre ein schöner Weg zu zeigen, wie seine [Baudys] Welt sich wieder zusammensetzt, wenn er mit dem Buch fertig ist“). Sehen machen: Der eigentliche Clou in Schnabels Film ist die Idee, große Teile der Geschichte radikal aus der Perspektive des Patienten zu erzählen. Aus seinem Blick und dessen Deformationen und Beschränkungen. Seine Stimme begleitet den Zuschauer als Voice-Over von Beginn an, manchmal bitter, manchmal ironisch, manchmal resigniert. Und die ersten zwanzig Minuten des Films, die konsequent aus dem Blick Baubys gefilmt sind, machen auch visuell die Eingesperrtheit des Erzählten deutlich. Erst nach dieser radikal subjektiven Eröffnung zeigt der Film auch objektive Szenen, so wie es das Kino immer tut; nun sieht man den grotesken Körper Jean-Dos, nach langer Vorbereitung, so, wie man im klassischen Horrorfilm das monströse Ansehen des Monsters erst dann gewährt bekam, wenn man es so sympathisch fand, dass man hinter dem Körperlichen die Integrität der Figur ahnen konnte.
|
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/52/hjw8.htm |
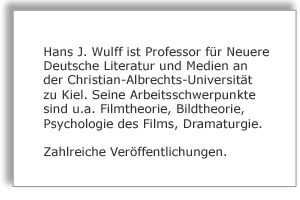 Wer im Kino erzählt, muss den Zuschauer sehen machen. Schmetterling und Taucherglocke beginnt mit Nichtsichtbarem, die Leinwand ist schwarz. Was wir noch nicht wissen, ist die Tatsache, dass der Protagonist des Films aus dem Koma erwacht, das Sehen selbst erst wieder lernen muss. Farbe, das Auge öffnet sich, nichts ist zu erkennen. Erst allmählich schälen sich Figuren und Gesichter aus den Unschärfen heraus. Sie wenden sich dem Kamera-Auge zu, suchen den Schärfepunkt, so, wie man bei ganz jungen Babies unwillkürlich in die Distanz hineinschlüpft, in der das Kind-Auge Schärfenwahrnehmung hat. Ein Arzt stellt die Diagnose - nach einem Hirnschlag ist der Patient in ein dreiwöchiges Koma gefallen, ist vollständig gelähmt, nur noch der Blick funktioniert. Nur auf einem Auge, erfährt man später, als das defekte Auge zugenäht wird, in einem Bild, das die zuklappenden Augenlider aus dem Inneren des Auges zeigt, als würde das Sichtbare mit einem Vorhang verschlossen werden. Erst danach beginnt die eigentliche Geschichte des Films.
Wer im Kino erzählt, muss den Zuschauer sehen machen. Schmetterling und Taucherglocke beginnt mit Nichtsichtbarem, die Leinwand ist schwarz. Was wir noch nicht wissen, ist die Tatsache, dass der Protagonist des Films aus dem Koma erwacht, das Sehen selbst erst wieder lernen muss. Farbe, das Auge öffnet sich, nichts ist zu erkennen. Erst allmählich schälen sich Figuren und Gesichter aus den Unschärfen heraus. Sie wenden sich dem Kamera-Auge zu, suchen den Schärfepunkt, so, wie man bei ganz jungen Babies unwillkürlich in die Distanz hineinschlüpft, in der das Kind-Auge Schärfenwahrnehmung hat. Ein Arzt stellt die Diagnose - nach einem Hirnschlag ist der Patient in ein dreiwöchiges Koma gefallen, ist vollständig gelähmt, nur noch der Blick funktioniert. Nur auf einem Auge, erfährt man später, als das defekte Auge zugenäht wird, in einem Bild, das die zuklappenden Augenlider aus dem Inneren des Auges zeigt, als würde das Sichtbare mit einem Vorhang verschlossen werden. Erst danach beginnt die eigentliche Geschichte des Films. Sie erzählt von Jean-Dominique Bauby, dem ehemaligen Chefredakteur der französischen Frauenzeitschrift „Elle“, einem Lebemann, der das Leben auf dem Jet Set genießt und auskostet. Er hat seine Frau und die drei Kinder verlassen, als er im Alter von 42 Jahren aus heiterem Himmel einem Schlaganfall zum Opfer fällt. Der Gehörsinn ist weitestgehend intakt geblieben. Aber er kann nur noch sein linkes Auge bewegen. Eine Schwester entdeckt, dass sie mit dem Patienten kommunizieren kann, wenn sie ihm das Alphabet in der Reihenfolge der Häufigkeit, mit der die Buchstaben im Französischen vorkommen, vorliest und er bei dem Buchstaben, den er meint, einmal blinzelt. Auch ist es möglich, ihm Fragen zu stellen, auf die er mit Ja oder Nein antworten kann. Dieses Alphabet wird den Kranken von nun an begleiten, von den Schwestern, die ihn pflegen, wie eine Litanei immer wieder neu angestimmt. Aus dem formlos erscheinenden Singsang der Buchstaben kristallisieren sich Worte heraus, Sätze - und am Ende, nach 14monatigem Diktat, ein ganzes Buch. Der reale Bauby, auf dessen Aufzeichnungen der Film zurückgeht, starb wenige Tage nach der Premiere des Buchs (1997), das sofort ein Bestseller wurde und in allen Weltsprachen zahlreiche Auflagen erlebte. Person und Geschichte sind nicht erfunden, das mag das immense Interesse des Publikums befördert haben (und auch in die Wahrnehmung des Films hineinspielen). Gleichwohl lohnt es, die Strategien genauer zu betrachten, mit denen Schnabel die Vorlage umsetzt.
Sie erzählt von Jean-Dominique Bauby, dem ehemaligen Chefredakteur der französischen Frauenzeitschrift „Elle“, einem Lebemann, der das Leben auf dem Jet Set genießt und auskostet. Er hat seine Frau und die drei Kinder verlassen, als er im Alter von 42 Jahren aus heiterem Himmel einem Schlaganfall zum Opfer fällt. Der Gehörsinn ist weitestgehend intakt geblieben. Aber er kann nur noch sein linkes Auge bewegen. Eine Schwester entdeckt, dass sie mit dem Patienten kommunizieren kann, wenn sie ihm das Alphabet in der Reihenfolge der Häufigkeit, mit der die Buchstaben im Französischen vorkommen, vorliest und er bei dem Buchstaben, den er meint, einmal blinzelt. Auch ist es möglich, ihm Fragen zu stellen, auf die er mit Ja oder Nein antworten kann. Dieses Alphabet wird den Kranken von nun an begleiten, von den Schwestern, die ihn pflegen, wie eine Litanei immer wieder neu angestimmt. Aus dem formlos erscheinenden Singsang der Buchstaben kristallisieren sich Worte heraus, Sätze - und am Ende, nach 14monatigem Diktat, ein ganzes Buch. Der reale Bauby, auf dessen Aufzeichnungen der Film zurückgeht, starb wenige Tage nach der Premiere des Buchs (1997), das sofort ein Bestseller wurde und in allen Weltsprachen zahlreiche Auflagen erlebte. Person und Geschichte sind nicht erfunden, das mag das immense Interesse des Publikums befördert haben (und auch in die Wahrnehmung des Films hineinspielen). Gleichwohl lohnt es, die Strategien genauer zu betrachten, mit denen Schnabel die Vorlage umsetzt. Doch immer bleibt gewiss, dass die Bilder des Films einen höchst eingeschränkten Blick wiedergeben. Selbst dann, wenn man den Eindruck hat, es ginge um Erklärungen, schmuggelt sich Subjektives ein. Einmal beschreibt die Stimme des Mannes die Trostlosigkeit des Bahnhofs, von dem seine Frau jetzt zurückfährt; man sieht die Frau auf dem Bahnsteig; die Stimme erinnert sich an einen Ausflug, den der Erzähler einmal mit seinem Vater an diesen Ort gemacht hat - und man sieht ihn als kleinen Jungen auf dem anderen Bahnsteig, gegenüber der Frau. Immer ist das Bildmaterial unsicher, immer können Elemente anderer Erinnerungsepisoden einwandern. Und manchmal scheint die Stimme zu protestieren, wenn der Film oder die Phantasiearbeit des Erzählers anderes zeigt als er es will - so in einer burlesken Phantasie, in der Bauby sich als Marlon Brando und andere Wunschgestalten seiner Kindheit imaginiert. Auch das vielleicht beeindruckendste Bild des Films changiert zwischen Subjektivität und Objektivität: Wir sehen Jean-Do in seinem Rollstuhl auf einem Holzsteg mitten in der Brandung; er hat den Rücken zur Kamera und zum Zuschauer gedreht, blickt in die Ferne auf das Meer hinaus. Ein Emblem der Verlorenheit des Helden, ein Symbol der Gefühle, die ihn bestürmen, und ein Gleichnis der Figur im Angesicht der Ewigkeit, auf die auch der Zuschauer hin orientiert wird.
Doch immer bleibt gewiss, dass die Bilder des Films einen höchst eingeschränkten Blick wiedergeben. Selbst dann, wenn man den Eindruck hat, es ginge um Erklärungen, schmuggelt sich Subjektives ein. Einmal beschreibt die Stimme des Mannes die Trostlosigkeit des Bahnhofs, von dem seine Frau jetzt zurückfährt; man sieht die Frau auf dem Bahnsteig; die Stimme erinnert sich an einen Ausflug, den der Erzähler einmal mit seinem Vater an diesen Ort gemacht hat - und man sieht ihn als kleinen Jungen auf dem anderen Bahnsteig, gegenüber der Frau. Immer ist das Bildmaterial unsicher, immer können Elemente anderer Erinnerungsepisoden einwandern. Und manchmal scheint die Stimme zu protestieren, wenn der Film oder die Phantasiearbeit des Erzählers anderes zeigt als er es will - so in einer burlesken Phantasie, in der Bauby sich als Marlon Brando und andere Wunschgestalten seiner Kindheit imaginiert. Auch das vielleicht beeindruckendste Bild des Films changiert zwischen Subjektivität und Objektivität: Wir sehen Jean-Do in seinem Rollstuhl auf einem Holzsteg mitten in der Brandung; er hat den Rücken zur Kamera und zum Zuschauer gedreht, blickt in die Ferne auf das Meer hinaus. Ein Emblem der Verlorenheit des Helden, ein Symbol der Gefühle, die ihn bestürmen, und ein Gleichnis der Figur im Angesicht der Ewigkeit, auf die auch der Zuschauer hin orientiert wird.