
Film-Lektüren |
Die Verseifenoperung des Fernsehkrimis
Von der Verschiebung einer politischen zu einer privaten EthikHans J. Wulff
Wir kennen die fatale Nähe der Angehörigen der Kommissare zu den Fällen, in denen sie ermitteln, zur Genüge. Private Bindungen, die sich aus der Ermittlung ergaben, hat es immer gegeben. Dass sich ein Ermittler in eine Verdächtige verliebt (oder andersherum) - das hat mit der Faszination des Verbrechens, des fremden Charakters, der anderen Lebenswelt zu tun. Aber dass die möglichen Täter zu einer gewaltbereiten Gruppe gehören, in der auch die Kommissarin einmal mitprotestiert hat, oder dass das ermordete Mädchen die Tochter einer Jugendfreundin aus dem Dorf ist, in dem der Kommissar aufwuchs, zeigt eine Welt, in der alle mit allen zusammenhängen. Eine Welt, wie sie in Seifenopern in Serie hergestellt wird. Es gehörte zur Stärke des Krimis, dass der Kommissar oft genug ein Ethnologe wurde, der die eigene Gesellschaft wie ein Fremder sehen lernen musste, wollte er sich der inneren Logik des Verbrechens annähern. Er muss verstehen lernen. Darum auch ist das Vertrauensverhältnis, das manchen Kommissar mit den älteren unter den Kriminellen verbunden hat, das Ergebnis des Versuchs, das Verhalten des anderen von innen her zu verstehen. Verstehen wollen ist Beziehungsarbeit, das schafft Intimität. Der Sohn des Kommissars sitzt also als Geisel im Flugzeug. Die Mutter, die den Kommissar und den Sohn vor 15 Jahren verließ, erfährt davon. Sie fährt zum Flugplatz, trifft den Kommissar. Alte Wunden werden berührt, alter Streit mit neuer Leidenschaft geführt. Für den Fall, den die Geschichte erzählt, bringt das alles nichts. (Es wird um die kalte Logik einer Flugzeugentführung gehen, um den Einsatz der mobilen Truppen, um die Erschießung der Geiselnehmer. Eine Geschichte nach dem 11. September, da geht es nicht mehr ums Verhandeln.) Wem bringt‘s also was? Dem Zuschauer, der sich in einer rundherum erkundeten Welt wähnen darf, in die das Verbrechen wie ein Fremdkörper eindringt? Und der sich bei der Besichtigung von Figuren wähnen darf, die ihre privaten Geschichten immer mit in ihre beruflichen Aufgaben hineinschleppen? Im älteren Krimi galt die Aufmerksamkeit dem Verbrechen. Es galt, die Unausweichlichkeit zu begreifen, wie aus Verletzungen Vernarbungen wurden, aus Narben Wut, aus Wut die Tat. Der Kommissar war dort ein Stellvertreter des Zuschauers (oder Lesers), der half, in Provinzen des Alltags einzudringen, zu denen man normalerweise niemals Zutritt fand. Er war der Träger einer Verstehensbemühung, die auch den Zuschauer verstrickte. Der neue Krimi dreht das Verhältnis um. Er bleibt in der Welt, die dem Zuschauer vertraut ist. Privatgeschichten helfen ihm, den Kommissar besser zu verstehen. Sie familiarisieren seine Beziehung zum fest angestellten Personal des Krimis. Die Verbrecher und die Fälle wechseln, der Kommissar bleibt. Ihm kommt das Geheimnis zu, das es eigentlich zu lösen gilt. In der Drehbuchliteratur ist oft von der private line die Rede - eine Privatgeschichte, die - wenn überhaupt - im Hintergrund der eigentlichen Geschichte erzählt wird. Bei Krimi-Serien konnte es Dutzende von Folgen dauern, bis oft sparsamste Andeutungen so etwas wie ein privates Profil und eine Lebensgeschichte des Kommissar-Helden skizziert hatten. Privatgeschichten lenken von der Hauptgeschichte ab. Wenn sie zum Zentrum werden, dann verkehrt sich das Interesse, das der Krimi an seiner erzählten Welt hat. Dann wird der Krimi zur Seifenoper, in der alles Private das Wichtige ist. Damit löst sich auch der grundlegend realistische Impuls, der viele Spielarten des Krimis einigte, unter der Hand auf. Der Krimi spielt nicht mehr in einer komplexen Gesellschaft, aus deren Widersprüchen und Konflikten das Verbrechen entsteht, sondern in einer vereinfachten Welt, in der die Guten unter ihren Privatproblemen schon reichlich zu leiden haben. Verbrecher sind dort Wesen aus einer anderen Welt. Eigentlich sind sie sogar nur Katalysatoren, die dem Kommissar dazu verhelfen, seine eigene Geschichte weiterzuspinnen. So wird denn auch das politische und moralische Problem, das Flugzeug-Entführungen aufwerfen, kaum noch ein Thema. Alles vor dem 11. September wurde in Tatort: Der Passagier (2002, Thomas Bohn) - dem das Beispiel entstammt - im Nebensatz als „weiche Phase“ des Umgangs mit Kidnappern gekennzeichnet; seit 2001 aber werde „nicht mehr lange gefackelt“, und sogar die prophylaktische Zerstörung eines vollbesetzten Flugzeugs sei besser, als das Flugzeug über besetztem Gebiet explodieren zu lassen. Die neue Zeit hat angebrochen, das belegt sogar dieser Film. Aber die Privatisierung der Mühe, die sich der Kommissar um die Rettung der Entführten machen muss, führt zu einer fatalen Verflachung des eigentlich ethischen Problems, das er mit einer solchen Situation haben müsste - unabhängig davon, ob die Geiseln zu seiner Familie gehören oder nicht. |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/52/hjw6.htm |
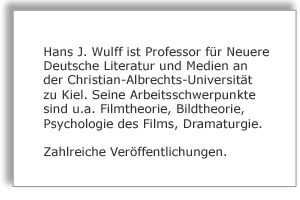 Ein Flugzeug wird entführt - und eine der Geiseln ist der Sohn des Kommissars.
Ein Flugzeug wird entführt - und eine der Geiseln ist der Sohn des Kommissars.