
CONTAINER |
VISION | AUDITION
Ein RückblickAndreas Mertin
Die Ausstellung in Kassel zeigt aber auch die Grenzen der Begegnung von Kunst und Kirche auf. Gelungen ist das Experiment nämlich nur beim ersten Blick auf die positiven Resonanzen. Schaut man aber genauer hin, dann muss man konstatieren, dass der Entfremdungsprozess der Betriebssysteme Kunst und Kirche weiter voranschreitet. Anders als in den kirchlichen Zeitschriften verlautbart, kann von einer Begegnung von Kunst und Religion keine Rede sein. Tatsächlich wurden zwar kirchliche Räume für die Kunst geöffnet, aber die erwünschte Begegnung erwies sich eher als eine Parallelität der Präsenzen. So ließen sich die Künstler auf den rahmenden Raum ein, konnten mit dem darin stattfindenden religiösen Ritus aber wenig anfangen. Eine Künstlerin fragte etwa, ob man die Glocken nicht einfach während ihrer Performance abstellen könne. Und im Gegenzug bestaunte die Gemeinde zwar den fremden Gast Kunst, schaltete ihn aber während der Gottesdienste und Amtshandlungen aber ab. Kunst ja - solange sie nicht stört / Religion ja – solange sie der eigenen Präsentation dient: so könnte man die Bilanz/Brisanz dieses Experiments nennen. Die Begeisterung der Besucher bezog sich daher in der Regel auf die einzelnen Artefakte und nicht auf deren Wahrnehmung im Kontext. Dass die evangelische Kirche mutig sei mit dieser Ausstellung, wird man daher nur vertreten können, wenn "mutig sein" heißt, sich der modernen Kunst überhaupt zu stellen. Mutig wäre es aber in Wirklichkeit, wenn man sich auf die moderne Kunst einlassen würde und nach der Installation der Arbeiten mit dem Dialog begänne. Es reicht eben ganz und gar nicht, nur "Fan" zeitgenössischer Kunst zu sein, wie es Bischof Huber in völliger Verkennung der Begrifflichkeiten ausgedrückt hat. Vielmehr muss die Bildende Kunst auch zur Erkenntnis und hier: zur religiösen Erkenntnis beitragen. Davon, dass die kirchlichen Veranstalter und ihre Klientel religiöse Erfahrungen mit ästhetischen Erfahrungen gemacht hätten, spricht aber wenig – zumindest wurde davon wenig in ihrer Praxis deutlich.
In der Karlskirche wurde etwa aus einer einzigartigen Raumintervention des Schweizer Künstlers Yves Netzhammer durch Bestuhlung und Re-Inszenierung eine bloße Theaterbühne gemacht. Der Veranstalter hatte nach wenigen Tagen vor dem Kunstwerk Stühle aufgestellt, auf die sich die Besucher niederließen, um sich dann für knapp 40 Minuten von der Kunst unterhalten zu lassen. Dass das Kunstwerk aber die Begehung durch den Betrachter erforderte, um überhaupt auch nur ansatzweise verstehbar zu werden, wurde so systematisch durch die Re-Inszenierungspragmatik unterlaufen. Auch die weitere Bestuhlung des Kirchenraumes führte dazu, dass das Kunstwerk von Yves Netzhammer als Solitär und eben nicht als integrativer Raumbestandteil begriffen wurde. Man konnte dabei das Gefühl haben, es sei eben ‚nur’ ein Kunstwerk in den Raum gestellt worden. Helmut Kremers, Chefredakteur der evangelischen Zeitschrift "zeitzeichen" konnte daher nach seinem Besuch der Ausstellung schreiben: "Das Kunstwerk ist ganz offensichtlich nicht auf diesen Kirchenraum hin erschaffen worden – und passt sich doch wunderbar ein. Das nüchtern abgedunkelte Kirchenschiff birgt die Bühne wie selbstverständlich, nichts da von Entweihung, nicht einmal eine kontradiktatorische Spannung will aufkommen, es ist, als wahrten die beiden Räume – der der Kirche und der der Kunst-Bühne – ihre je eigene Würde und erhöhten sie gegenseitig noch." Nichts ist weniger wahr. In Wirklichkeit hat der Künstler das Werk über ein Jahr lang explizit für den Raum entwickelt, hatte dessen Architektur sorgfältig reflektiert und aufgenommen. Die Verdunkelung des Raumes gehörte konstitutiv zum Werk hinzu und eine Kunst-Bühne war das Ganze nur durch die unglückliche Platzierung der Stühle vor dem Kunstwerk.
„Platon beschreibt einige Menschen, die in einer unterirdischen Höhle von Kindheit an so festgebunden sind, dass sie weder ihre Köpfe noch ihre Körper bewegen und deshalb immer nur auf die ihnen gegenüber liegende Höhlenwand blicken können. Licht haben sie von einem Feuer, das hinter ihnen brennt. Zwischen dem Feuer und ihren Rücken werden Bilder und Gegenstände vorbei getragen, die Schatten an die Wand werfen. Die „Gefangenen“ können nur diese Schatten der Gegenstände sowie ihre eigenen Schatten und die ihrer Mitgefangenen wahrnehmen. Wenn die Träger der Gegenstände sprechen, hallt es von der Wand so zurück, als ob die Schatten selber sprächen. Da sich die Welt der Gefangenen ausschließlich um diese Schatten dreht, deuten und benennen sie diese, als handelte es sich bei ihnen um die wahre Welt. Platon (bzw. Sokrates) fragt nun, was passieren würde, wenn man einen Gefangenen entfesselte und ihn dann zwänge, sich umzudrehen. Zunächst würden seine Augen wohl schmerzlich vom Feuer geblendet werden, und die Figuren würden zunächst weniger real erscheinen als zuvor die Schatten an der Wand. Der Gefangene würde wieder zurück an seinen angestammten Platz wollen, an dem er deutlicher sehen kann. Weiter fragt Platon, was passieren würde, wenn man den Befreiten nun mit Gewalt, die man jetzt wohl anwenden müsste, an das Sonnenlicht brächte. Er würde auch hier zuerst von der Sonne geblendet werden und könnte im ersten Moment nichts erkennen. Während sich seine Augen aber langsam an das Sonnenlicht gewöhnten, würden zuerst dunkle Formen wie Schatten und nach und nach auch hellere Objekte bis hin zur Sonne selbst erkennbar werden. Der Mensch würde letztendlich auch erkennen, dass Schatten durch die Sonne geworfen werden. Erleuchtet würde er zu den anderen zurückkehren wollen, um über seine Erkenntnis zu berichten. Da sich seine Augen nun umgekehrt erst wieder an die Dunkelheit gewöhnen müssten, könnte er (zumindest anfangs) die Schattenbilder nicht erkennen und gemeinsam mit den anderen deuten. Aber nachdem er die Wahrheit erkannt habe, würde er das auch nicht mehr wollen. Seine Mitgefangenen würden ihn als Geblendeten wahrnehmen und ihm keinen Glauben schenken: Man würde ihn auslachen und „von ihm sagen, er sei mit verdorbenen Augen von oben zurückgekommen“. Damit ihnen nicht dasselbe Schicksal zukäme, würden sie von nun an jeden umbringen, der sie „lösen und hinaufbringen“ wollte. (wikipedia) Man muss sehen, wie präzis Netzhammer mit dem Höhlengleichnis in der Karlskirche spielt. Wer also angesichts von Netzhammers Arbeit nur "sitzt und schaut und lauscht", begreift nicht dessen Gehalt, er bleibt im Status der gebannten Höhlenbewohner. Und wer der Verortung des Kunstwerks im Raum nicht nachspürt, wer den Riss, den es in die religiöse Raumkonvention einbringt, nicht spürt, der muss das Ganze als Kunstausstellung / Kunstbühne missverstehen. Aber selbst wenn man in der Bühnenmetapher bleibt (die das Werk ja auch ohne Zweifel mit sich bringt), ist es wichtig, einzusehen, dass wir trotzdem - theologisch betrachtet - die Bühne betreten müssen, weil sie unser Handlungsraum ist: „Kein anderes Modell unterstreicht die Moralität menschlichen Handeln so nachdrücklich wie das des Theatrum Mundi: ‚Gott kann Autor, Spielleiter und Zuschauer sein, und doch bleibt dem Menschen die Aufgabe gestellt, seine Rolle so gut und überzeugend als möglich zu spielen.’ … Der Topos des Theatrum Mundi eröffnet damit einen Weg, menschliches Handeln sowohl anthropologisch-erfahrungstheoretisch als auch in der theologischen Dimension zu bedenken, ohne einen der beiden Pole beschneiden oder hierarchisch über- oder unterordnen zu müssen. Es ist gerade »die Vielfalt der möglichen Perspektiven und Sinngebungen«, die die Interpretation des in der Welt handelnden Menschen nach dem Modell des Theatrum Mundi eröffnet“ (Albrecht Grözinger). In der Karlskirche hätte somit deutlich werden müssen, dass das dort wahrzunehmende Kunstwerk zentral etwas über die Befindlichkeit des Subjekts in der Welt aussagt und es hätte daher konstitutiv in die Gottesdienste einbezogen werden müssen. Für 99 Tage konnte jeder, der es wollte, sich nicht nur von poetischen und autopoietischen Bilderzählungen verzaubern lassen, sondern er konnte etwas über seine Wahrnehmung und Situierung in der Welt erfahren. Solange die Veranstalter aber nur stolz und zufrieden sind, gute Kunst von berühmten Künstlern auszustellen, kann von einer wahren Begegnung von Kunst und Religion keine Rede sein. Die kontemplative ästhetische Aneignung, die die nachträgliche Neu-Inszenierung des Kunstwerks in den Vordergrund stellte, ist aber mit der kontemplativen Aneignung, die die christliche Religion am Beginn des 21. Jahrhunderts in ihrer institutionalisierten Gestalt auszeichnet, durchaus verwandt. Ruhe, Gestalt und Kontemplation wie bei einer Bach’schen Kantate erwartet man in einer Kirche, Abkehr von der Hektik des Alltags, Befriedung und nicht Verstörung der Sinne. Insofern passte das Re-Design der Ausstellung durch den Veranstalter die Kunstwerke an dessen Erwartungshaltung an. Nun ist die erwartete Ruhe und Kontemplation aber dann ein Problem, wenn sie nur noch der religiösen/ästhetischen/künstlerischen Selbstbestätigung dient, wenn ihr Zweck gerade der Ausschluss von Verstörungen und damit von Erfahrungen ist. Denn dann besteht die Gefahr, dass jene elementare Erfahrungen, die konstitutiv zu Religion und Kunst gehören, gleich mit ausgeschlossen werden. Das wurde am zweiten Ausstellungsort, der Martinskirche, gleich mehrfach deutlich. Gleich am Anfang der Ausstellung war eine Videoarbeit zu sehen, die entgegen dem kuratorischen Konzept und am Kurator vorbei durch eine nachträglich eingebaute weiße Holzwand in einem White Cube, in einem separierten weißen Raum gezeigt wurde. Man zog sich vom Kircheneingang aus quasi in ein Kunstkabinett zurück und befand sich urplötzlich gefühlsmäßig gar nicht mehr im Narthex der Kirche, der historisch zugleich Exklusion und Inklusion bedeutet. Jene elementare, ja geradezu physische Erfahrung des mittelalterlichen Menschen, dass es einen Zwischenraum des Übergangs vom Alltag zum Sonntag gibt, wurde durch diesen Umbau zur Galerie unterminiert. [Man kann dies auch berechtigter Weise als künstlerische Kapitulation vor dem religiösen Raum deuten.] „Die verschiedenen Begriffe Atrium/Narthex/Vorhalle/Paradies sind in der Literatur nicht sauber voneinander getrennt … Welche Aufgabe erfüllte der Narthex? Mit Sicherheit eine liturgische Aufgabe…: zum Beispiel nächtliches Refugium zu Zeiten großer Pilgerströme zu sein, oder eine Kirche der Katechumenen, der Taufbewerber, oder eine Kirche der Büßer, die zeitweilig von der Feier der Sakramente ausgeschlossen waren. Gewiss feierte man in diesem Vorraum Exorzismen, Wiederversöhnung der Büßer und Zeremonien, die der Taufe vorausginge… Die Dokumente des 12. Jahrhunderts nennen den Narthex, der an die eigentliche Mönchskirche angrenzt Galiläa; um dieses Wort zu verstehen, muss man die Liturgie der damaligen Zeit kennen. Eine große Prozession ging den damaligen Gottesdiensten voraus, sie vollzog symbolisch den Weg der Apostel nach, die sich nach Galiläa begaben, wo sie den Auferstandenen sehen sollten. Die Station vor dem eigentlichen Gottesdienst umfasste auch einen Reinigungsritus; er wurde in der Galiläa gefeiert. „Ich werde euch nach Galiläa vorausgehen“, dieses Wort Christi an Maria Magdalena wird so gedeutet, dass Galiläa eine Stätte des Durchgangs ist; denn der Erlöser hat den Durchgang vom Leiden zur Auferstehung, vom Tod zum Leben vollzogen.“ [wikipedia] Indem der Veranstalter es entgegen dem Rat des Kurators zuließ, dass die eigene kirchliche Bausprache und Religionsgeschichte unterlaufen wurde, machte er zugleich die spezifische kontextuelle Wahrnehmung des Werks unmöglich. Die potentielle Dichte und Deutbarkeit der Arbeit, auf Grund deren das Werk ausgewählt wurde, wurde zugunsten einer puristisch musealen beschnitten. Und das war vor Ort geradezu physisch erfahrbar, denn ein gut Teil dessen, was die Brisanz des Werkes hätte ausmachen können, wurde ausgeblendet. Etwas anders war das mit dem Kunstwerk von Jay Schwartz, das den zentralen Kirchenraum mit Klang erfüllte. Das war eben nicht nur ein autopoietisches Werk, das im Raum platziert wurde, sondern es ver/störte notwendigerweise den Zuhörer. Dieser Sound war kein lieblicher, sondern einer im Sinne des mysterium tremendum und des mysterium fascinans. „The Sound of God“ schrieb ein Ost-Asiate in das Besucherjournal. Er fegte alle Beschaulichkeit beiseite und führte zum Kern der Sache. Biblisch kennen wir die „Stimme Gottes aus dem Feuer“(5. Mose 4, 33 + 5, 26) , seine tödliche Stimme (5. Mose 5,25), die wie das Rauschen der Flügel der Cherubim klingt (Hesekiel 10,5), eine große Stimme (Offb. 16, 1) und wohl oftz auch laut (2. Mose 19,19). Und wir kennen jene faszinierende Geschichte des Elia am Horeb, dem versprochen wird, Gott zu begegnen (1. Kön 19, 11ff): „Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den HERRN! Und siehe, der HERR wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem HERRN her; der HERR aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben; aber der HERR war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer; aber der HERR war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach: Was hast du hier zu tun, Elia?“ Dieser Text schildert eine elementare religiöse Erfahrung mit Laut und Klang: Dass nicht notwendig die lautesten Töne die sprechendsten sind. Aber er setzt zugleich voraus, dass wir zunächst erwarten, dass Gott im Wind, im Erdbeben, im Feuer ist – also mit den Elementargewalten zu uns spricht. Das Erhabene artikuliert sich so. Die Faszination des biblischen Textes ist der Verweis auf das Dazwischen, dass der kabod eben auch im sanften Sausen sein kann. Der Mensch freilich antwortet auf diese religiöse Erfahrung durchaus nicht leise, sondern „mit Psaltern, mit Pauken, mit Zimbeln und mit Trompeten“ und zwar möglichst laut. Kontemplativ geht es in der religiösen Erfahrung nicht zu. Das Kunstwerk von Jay Schwartz stieß vor Ort auf Probleme, gerade weil es sich in einem elementaren Sinn artikulierte. Es fegte die bürgerliche Ruhedecke beiseite und fragte nach dem Elementaren und dem Dazwischen. Wo erklingt im Raum die Stimme des Herrn? Und wer nimmt sie wahr? Und da galt nun: Wie man in ein Kunstwerk hinhört, so schallt es heraus. Wer sich der Zumutung nicht aussetzen wollte, den lauten Ton nur als Geräusch empfand, der hörte auch nur dies: ein Geräusch. Wer sich aber dem elementaren Geschehen aussetzte, wer in den Phasen des Entzugs, die auch konstitutiver Bestandteil des Werkes waren, dem Dazwischen nachspürte, der konnte auch dem Klang etwas abgewinnen, konnte ästhetische wie religiöse Erfahrungen machen. Das war das Material, mit dem man in der Kirche hätte arbeiten müssen. Es ging ja nicht nur darum, ein Klangkunstwerk im Raum zu platzieren, sondern darum, mit den durch es ausgelösten Erfahrungen produktiv (und meinetwegen bibliodramatisch) zu arbeiten. Den Klang nicht nur als formales Element zur Einleitung des Gottesdienstes, sondern auch zur Formung des Gottesdienstes einzusetzen. Was ist, wenn der Klang einen zum Schweigen bringt und die Stimme im Sturm der Töne verstummt? Gedacht war ja daran, im Rahmen der Ausstellung nach der Bedeutung und dem Verhältnis von Wort, Bild und Klang zu fragen. Statt dessen wurde nur Klang präsentiert und Wort und Klang eben nicht konfrontiert. FazitWelcher Schluss ist aus der problematischen Uminszenierung der Ausstellung durch den Veranstalter zu ziehen? Ich will nicht von einem Scheitern der Ausstellung und ihrer Konzeption sprechen, dafür war die Kunstsprache zu eindringlich und zumindest die Möglichkeit religiöser Erfahrung mit der ästhetischen Erfahrung trotz der Re-Inszenierung zu offensichtlich (wenn auch nicht für alle). Trotzdem war es eben keine wirkliche Begegnung von Kunst und Religion, sondern nur eine Ausstellung von Klang- und Medienkunst im religiösen Raum, bei der der religiöse Ritus abgeschaltet wurde, wenn die Kunst im Vordergrund stand, und die Kunstwerke ausgeblendet wurden, wenn der religiöse Ritus praktiziert wurde. Faktisch war es eine zeitlich gesteuerte Aufteilung der Kirchen in einen Gottesdienstraum und einen Ausstellungsraum (mit minimalen zeitlichen Überschneidungen). Das aber ist Normalität im kulturellen Engagement der christlichen Kirchen, dass nämlich ihre Kirchenräume auch als Konzert- und damit Kulturräume genutzt werden. Man kann sich damit zufrieden geben und offenkundig ist die evangelische Kirche in der aktuellen Verfasstheit damit auch zufrieden. Trotzdem bleibt es unbefriedigend, denn das Verhältnis reduziert sich auf zwei bloß nebeneinander existierende kulturelle Sphären. Dabei nutzt man nicht einmal ansatzweise die Möglichkeiten, die religiös wie ästhetisch in diesen Begegnungen von Kunst und Religion stecken. Oftmals ist es nur fehlende religiöse wie ästhetische Fantasie, die einem produktiveren Geschehen im Wege steht. Wenn Dichte nicht nur eine Eigenschaft des Kunstwerks ist, sondern ein komplexes Geschehen, das sich aus der Interaktion von Werk und Betrachter/Nutzer ergibt, dann geht es also künftig darum, diese Verdichtungen von Erfahrung auch möglich zu machen. Dabei liegt die Bringeschuld einseitig auf Seiten der Veranstalter. Sie müssen durch einen neuartigen (und ganz und gar nicht konventionellen) Umgang mit der Kunst deren Dichte ausloten. Ulrich Schötker, Leiter der Kunstvermittlung auf der documenta 12, hat im Rahmen seines Vortrages auf einer Tagung der Ev. Akademie Hofgeismar darauf hingewiesen, dass neben den Kunstwerken und den Kuratoren künftig verstärkt eine neue Art der Vermittlung konstitutiv in die Konzeption einbezogen werden muss. Vermittlung nicht im traditionellen museumspädagogischen Sinn, dass also die Werke den Besuchern vermittelt werden müssten, sondern eher im explorativen Sinn der Erkundung der Werke durch Re-Kontextualisierungen und durch Begegnungen mit Zielgruppen, die neue Lesarten generieren können. Veranstalter und gerade auch kirchliche Veranstalter müssten so ein Programm auflegen, dass eine Vielzahl von Besuchern für das je Spezifische der Situation wahrnehmungsfähig macht. Nicht die Vorstellung des Kunstwerks als Solitär steht dabei im Vordergrund, nicht die Erläuterung des kuratorischen Konzepts, sondern die Erfahrung des Werkes im jeweils neu generierten Kontext von Raum und Betrachter. Im religiösen Raum teilt sich die Erfahrung dann in eine ästhetische und eine religiöse Erfahrung (deren Möglichkeit zwar beide simultan in uns liegen, aber unterschiedlich aktualisiert werden). Deren produktives Spannungsverhältnis wäre dann in der Performance geltend zu machen. Das ist die Herausforderung für die Zukunft. |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/49/am223.htm |
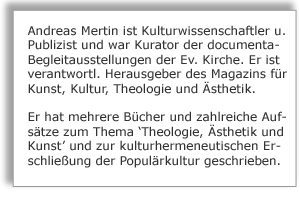

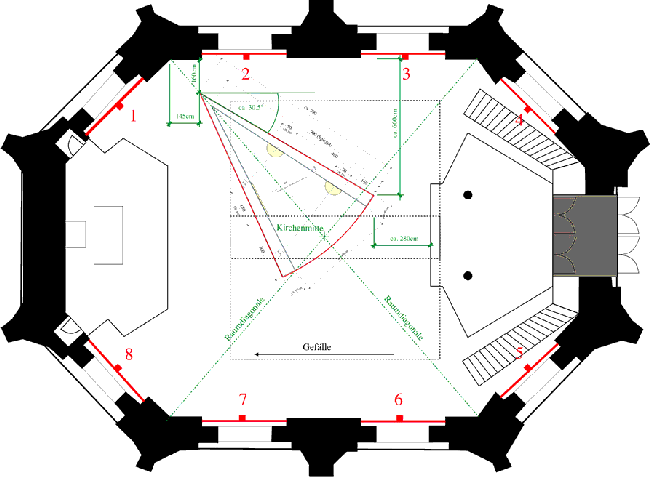
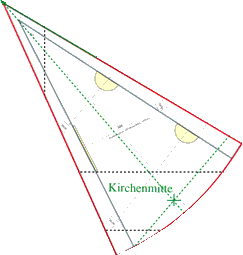 Dass der Besucher, der den Schritt in das Kunstwerk hinein macht, dann exakt im Zentrum des kirchlichen Baukörpers steht und sich zugleich als Zentrum einer platonischen Spiegel-Höhle erblickt, die die Illusion des geschlossenen Raumes aufnimmt, ist für das Gelingen der Wahrnehmung des Werkes und seines Kontextes elementar. Wer dagegen nur "sitzt und schaut und lauscht" kann nicht erfahren, dass die Räume sich wortwörtlich reflektieren, dass also das Werk von Netzhammer mit der Anspielung auf das platonische Höhlengleichnis eben auch die Frage nach dem Wahrheitswert des Kontextes stellt.
Dass der Besucher, der den Schritt in das Kunstwerk hinein macht, dann exakt im Zentrum des kirchlichen Baukörpers steht und sich zugleich als Zentrum einer platonischen Spiegel-Höhle erblickt, die die Illusion des geschlossenen Raumes aufnimmt, ist für das Gelingen der Wahrnehmung des Werkes und seines Kontextes elementar. Wer dagegen nur "sitzt und schaut und lauscht" kann nicht erfahren, dass die Räume sich wortwörtlich reflektieren, dass also das Werk von Netzhammer mit der Anspielung auf das platonische Höhlengleichnis eben auch die Frage nach dem Wahrheitswert des Kontextes stellt.