
Photographie und Bildwelten
|
Wie eine Fotografie?Über das Fotografische in einem Roman und an einem Beispiel aus der Bildenden KunstKarin Wendt
Der fotografische Blick oder: die Suche nach WahrheitIm zweiten Kapitel erzählt Petrowskaja von dem Lehrer Simon Heller, mit Rufnamen Schimon, der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, zunächst in Wien, eine jüdische Schule für gehörlose Kinder gründete. „Von Wien aus zog die Schule durch die polnische Provinz, durch Galizien, wie ein Wanderzirkus, sie blieben jeweils kurz in einer Stadt, einem Städtchen, einem Schtetl, dann zog Simon weiter, mit seiner Familie, den Waisenkindern und jenen Kindern, die von ihren Eltern geschickt wurden.“[2] Den Abschnitt über Schimon beschließt dann eine längere Passage mit der Zwischenüberschrift „Der Flug". Beim Lesen entsteht der Eindruck, dass sich in der dort imaginierten Szene zugleich die Malerei des Künstlers Marc Chagall abbildet: die Stadtübersichten und Figuren der sogenannten Schtetl-Bilder wie „Der Geiger“ (1913) oder „Über Witebsk" (o.J.), aber auch das Motiv des Fliegens bzw. Schwebens wie in „Über der Stadt" (1918), das wiederkehrende figürliche Vokabular und der kubo- bzw. mehrperspektivische Bildraum. Sie sei hier in Gänze zitiert:
Petrowskaja folgt mit ihrer Chagall-Rezeption einerseits Schriftstellern des 20. Jahrhunderts wie Scholom Alejchem, Isaak Babel oder Joseph Roth, die in „Schtetl-Bildern“ festhielten, „was die kleine ostjüdische Stadt von allen anderen unterschied – … [und] dabei, gemeinsam mit Chagall das Schtetl als europäischen Sehnsuchtsort [erschufen]. … Seit Chagall gehören Figuren wie der Geiger auf dem Dach zum imaginären Inventar dieser versunkenen und vernichteten Welt.“[4] Die Art und Weise, wie Petrowskaja den Blick auf Chagalls Bildwelt und durch sie auf die Figur Schimon und deren Lebenswelt heftet, ist jedoch eine andere als die der Schriftsteller vor ihr. So schaut die Erzählerin in meiner Wahrnehmung durch Chagalls Kunst wie durch einen fotografischen Filter, um uns, den Leser*innen, den Lehrer Schimon auf seinem nächtlichen Nachhauseweg durch sein Schtetl, die Stadt Lemberg, literarisch zu vergegenwärtigen. Sie blickt, so meine These, wie durch das Objektiv einer Kamera. Ihre „Jagd“ nach Schimon ist eine Jagd nach Bildern von ihm, nach Wörtern, die zu Bildern von ihm werden. Die Erzählerin wird angetrieben von einer Sehnsucht nach einem fremden, nicht mehr existierenden Land, von dem sie nur noch vermittels der Sprache Kenntnis hat: „Polen“, „Polonia“ (lat. polnische Diaspora), „Polania“, „Polin“ (die jiddischen Begriffe bzw. hebräischen Silbenlaute). Statt „Polin“ schreibt Petrowskaja jedoch „Polyń“ (russ. „полынь полынь“), was in ihrer Muttersprache Russisch „Wermut“ oder „Absinth“ heißt und biblisch ein Bild für Bitterkeit und Strafe ist. Sie webt damit in ihre Suche nach dem Land, in dem ihre Verwandten lebten und ermordet wurden, auch eine memoriale Spur des Schmerzes ein. Aber wie sieht dieses Land aus? Was heißt es, dort gelebt zu haben? Auf ihrer „Jagd" nach dem sich entfernenden Schimon, den sie „nicht aus den Augen" lässt, bewegt sie sich als Zeugin mit ihm durch das Städtchen, das Schtetl, zunächst durch die engen Gassen und Seitengassen eilig gehend, dann laufend, und plötzlich „hinter der nächsten Ecke" löst sie sich wie er vom Boden und beginnt zu fliegen, Richtung Himmel. Mit dem Schwenk der Kamera nach oben gerät die vorher beschriebene Stadt aus den Fugen. Der bis dahin perspektivische Raum verliert seinen Flucht- und Zielpunkt, der Blick folgt nun „parallel zu Raum und Zeit" „der eigenen Flugbahn". Aus Sicht der Sterne, dem Sinnbild der unendlichen Erzählgemeinschaft, wird der Spaziergang durch die Stadt zum Gang durch die Architektur des Talmud (die sechshundertdreizehn in der Tora enthaltenen Mitzwot), ein mehrperspektivischer Erzählraum, in den alles hineingezogen wird: Menschen und Dinge, Namen und Gebote, Farben und Geschmack; alles gerät auf eine Bild- bzw. Vorstellungsebene und transponiert so die in Büchern verborgene Welt in die ästhetische Erfahrung naiv-abstrakter Malerei. Auf dem nur mehr in fast ununterscheidbaren Farben nuancierten Tableau (die grün schimmernden Wege der Stadt, die schwarzen Taschen seines Lapserdakes, die schwärzer sind als die Nacht) heben sich die Erscheinungen und Zeichen der gegenständlichen Welt wie einzelne Lichtpunkte ab (bunte Glaskügelchen, Bonbons, Stift, Kirche, Krug, Kerzenständer, Windsbraut, kupferne Zwiebeltürme, goldenes Kreuz, Geige, blaue Blume). Wie eine Fotografin leuchtet die Erzählerin alles aus, so dass der Betrachter manches aus anderen Zusammenhängen wiedererkennt (die „blaue Blume" aus der Romantik, die „Windsbraut“ aus dem gleichnamigen Gemälde von Oskar Kokoschka, das wie Chagalls Bilder Teil der Ausstellung „Entartete Kunst“ war); anderes wird mit Eigennamen neu fokussiert bzw. scharf gestellt (łapserdak = abgelumpter Kerl; kościół = Kirche). Petrowskajas inszeniert das Schtetl, indem sie sich Chagalls Malerei film-fotografisch vergegenwärtigt, um sich durch sie hindurch die Lebenswirklichkeit ihrer Vorfahren auszumalen. Auf der Suche nach Wahrheit verspricht das Fotografische einen unverstellten, fokussierten Blick. So reichert sich die subjektive Perspektive der Erzählerin mit dem objektiven Anschein einer Fotografie einerseits und der imaginären Realität einer Malerei andererseits an und öffnet den Raum der Gegenwart für die Erfahrungen des Anderen – gleichwohl nur im Ästhetischen. In Wahrheit bleibt die geschilderte Welt, der Blick in das „gelobte Land“, unendlich von der eigenen Lebenserfahrung entfernt. Um das Fotografische aus einer weiteren Perspektive zu beleuchten, möchte ich nachfolgend ein Beispiel aus der bildenden Kunst der Gegenwart befragen, das seinerseits den fotografischen Blick erkundet. Anders als bei Petrowskaja dient dort die konkrete Fotografie als Vorlage oder Folie. Wie bei Petrowskaja geht es darum, den fotografischen Blick ästhetisch auszulegen. Am Anfang war das Foto oder: die Schönheit der Fotografie
Ich erinnere mich, dass mich als Jugendliche die Direktheit und Ausstrahlung des Bildes „Irène und Luciano“ (1977) im Sprengelmuseum Hannover, nicht zuletzt aufgrund seiner Größe, schier umgehauen hat. Konkret erinnere ich mich an besonders delikate Farben und an eine geschickte Regie der Blicke. Um sie besser zu begreifen, ist es hilfreich zunächst zu verstehen, wie sie entstanden sind. Als Vorlagen dienten Gertsch seine eigenen Fotografien von Motiven aus seinem Umfeld, das waren in den 70er Jahren vor allem Bekannte aus der Szene um den Luzerner Künstler und Travestie-Star Luciano Castelli, prominente Freund*innen wie Irene Staub oder persönliche Begegnungen mit damaligen Popgrößen wie der Sängerin Patti Smith. Aus zahlreichen Aufnahmen wählte er jene aus, die er als Ganzes und im Detail für die vergrößernde Übertragung in Malerei für besonders geeignet hielt. Das Farbfoto projizierte er dann als Dia an die Wand und malte es Zentimeter für Zentimeter ab, etwa zwanzig Quadratzentimeter am Tag. So entstanden zentrale Werke wie „Medici" (1972), fünf Bandmitglieder, darunter Castelli, vor dem Kunstmuseum Luzern hinter einem Absperrgitter posierend, das Harald Szeemann auf der Documenta 5 ausstellte und Gertsch damit international bekannt machte, „Luciano schminkt Marina"[5] oder die Porträtserien „Irène“ und „Patti Smith“.[6] 2010 äußerte sich Gertsch im Gespräch mit Res Strehle zur Auswahl seiner Modelle. Ein entscheidendes, sehr persönliches Kriterium ist für ihn danach die darin aufscheinende jugendliche Sinnlichkeit: „ein altes Gesicht, das vom Leben gezeichnet ist, ist zwar auch eindrücklich, aber ich hätte keine Lust, es zu malen. … Wenn einer mit der Krawatte an einem Tisch sitzt, dieses Bild wäre für meine Malerei nicht verfügbar.“[7] Die gemalten Fotos sind im Wortsinn attraktiv, sie ziehen die Sinne auf sich. Gertsch interessiert die jugendliche Aura von Unverwundbarkeit und Verletzlichkeit, das transitorische Moment zwischen Rebellion gegen das Überkommene und Offenheit für das Unbekannte. Ihn reizt die androgyne oder glamourös schillernde Ausstrahlung einer Person. Was genau macht aber die Faszination aus, worin besteht der Sog dieser illusionistischen und zugleich so offenbar zeitgenössischen Bilder? Einer der ersten, der über seine Begegnung mit diesen Bildern geschrieben hat, war der Psychologe und Autor Timothy Leary. Er war 1970 ins Schweizer Exil geflüchtet und besuchte im Jahr darauf, gemeinsam mit dem Volkskundler und Publizist Sergius Golowin, Gertsch in dessen Atelier. Danach notierte er in sein Tagebuch:
Leary reflektiert bereits wesentliche Aspekte von Gertschs Kunst. Wir sehen „lebende, atmende, sich unterhaltende, rauchende“ Menschen. Leary wählt die englische Verlaufsform, um den präsentischen Eindruck zu vermitteln. Der Eindruck des Situativen entsteht, weil die Kamera Augen-Blicke festhält: ein neugieriges Aufblicken, ein kurzes Hinunterblicken, ein Abschweifen, die Wendung des Blicks nach innen – all das fängt die Kamera ein. Im Fall des oben erwähnten Bildes „Irène und Luciano" geht der Blick des Betrachters zunächst zu den Augen von Irene, die aktiv zu Luciano hinschaut. Dieser nimmt ihren Blick nicht oder nur indirekt wahr. Sein Blick ist nicht fokussiert, sondern ziellos nach innen gerichtet. So geht der Blick des Betrachters erneut zu Irene. In diesem nicht abschließbaren Nachvollzug der Blicke gewinnt die dargestellte Szene einen Ereignischarakter. Die Szenen, die wir sehen, auch das schreibt Leary als erster, scheinen wir in einem Spiegel zu sehen. Das liegt zum einen an der fotografischen Realistik, der Klarheit, wie Leary sagt, zum anderen an der Art der malerischen Übersetzung, der Aneignung durch das Malen. Die leuchtenden Farben und der spezifische Glanz der Oberfläche ergeben einen besonderen Look, den lebendigen „glow“ von warmer oder geschminkter Haut, und eine scheinbar durch die Personen leuchtende Situation. So entsteht der Eindruck einer lebendigen, einer menschlichen Aura. Leary schreibt mit sehr nachvollziehbarer Emphase „yes, that‘s what it is, they are so human“. Die visuelle Spannung umschreibt Leary dann mit dem Adjektiv „magisch“ und knüpft daran einen Gedanken der islamischen Mystik: „Baraka“ beschreibt das Aufgeladensein von Personen, Dingen oder Orten mit einer besonderen (Segens)Kraft. Dass sich die Szenen lebendig aufladen, liegt auch daran, dass Gertsch das Motiv scharf stellt, während der Hintergrund eher weich und verschwommen bleibt. So entsteht eine Art von Ortlosigkeit oder Offenheit, vor der das präzis gezeigte Modell präsentisch nahe rückt. Je näher man den Personen dann kommt, umso malerischer werden sie, bis sich der illusionistische Eindruck ganz in konkrete Malerei verwandelt. Man sieht nun, wie die weich verlaufenden Farben in die unbehandelten Leinwandfasern eingedrungen sind. An diesem Punkt versteht man, warum das Sehen der Verlaufsbilder von Morris Louis für seine Herangehensweise wichtig war, wie Gertsch im Gespräch mit Tobia Bezzola[9] erläutert. Und auch wenn die Blow-ups in dieser Phase seiner Kunst sie in die Nähe zur Popart rücken, steht sie doch einer anderen Tradition näher: dem Abstrakten Expressionismus und der amerikanischen Farbfeldmalerei. Das übergroße Format, die dezentrale Position des Motivs und die durch beides erzielte Maßstabslosigkeit evozieren für den Betrachter eine Ästhetik des Erhabenen, ähnlich der Erfahrung, wie sie Jean-Francois Lyotard an den akompositionellen Bildern von Barnett Newman herausgearbeitet hat.[10] Dieter Roelstraete stellt in diesem Zusammenhang die Frage, ob sich diese fotorealistischen Bilder wirklich auf der Höhe der Kunst ihrer Zeit bewegen. „Did painting scenes of people applying paint to themselves and/or other‘s faces signal the height of pictorial auto-reflexivity and self-relativism in an era remembered primarily for its unrelenting hostility to painting? … Is a realistically rendered painting of makeup really an abstract painting about the state of painting itself?"[11] Roelstraete kommt hier zunächst auf die Beobachtung von Leary zurück, dass die Gesichter in den Luciano-Bildern und den Frauenporträts wie Spiegelbilder schimmern, und damit auch in der langen, bis in die Gegenwartskunst reichenden Geschichte der Spiegel-Bilder stehen. Letztlich, so Roelstraete, funktionieren Gertschs Bilder aber jenseits dieser Metapher und ihrer Konzeptualisierungen: „Franz Gertsch remained committed to the art of painting; defiantly so, above all, in his choice of the subject matter – in the disarmingly basic facts, seemingly free of the weight of reflection, of painting pictures of people.“[12] Gertschs künstlerisches Engagement zielt einzig auf die Kunst der Malerei.
Anmerkungen[1] Katja Petrowskaja: Vielleicht Esther. Geschichten, Suhrkamp Verlag: Berlin 2014, S. 67-68. Nachfolgend zitiert: Vielleicht Esther 2014. [2] Vielleicht Esther 2014, S. 66. [3] Vielleicht Esther 2014, S. 68-69. [4] Brigitte van Kann: „Der Geiger auf dem Dach – Literarische Erkundungen zu Marc Chagalls Schtetl-Bildern“. Vortrag mit Lesung von Heinz Spagl, Stadtbibliothek Freiburg, 29. November 2019. Programmhinweis von Silvia Schmieder, in: freiburger schreibkiste, 6.11.2019. [5] Niklaus Oberholzer: Franz Gertsch in den Siebzigern, in: Journal21, 9.6.2020. [6] Francis Richard: Franz Gertsch, in: Artforum, Mai 2004. [7] Res Strehle: „Das ist fast ein Selbstbildnis, was ich hier mache“, in: Tages-Anzeiger, zuletzt aktualisiert 16.4.2010. Nachfolgend zitiert: Strehle 2010. [8] Timothy Leary: About Franz Gertsch, zuerst in: Ausst.Kat Franz Gertsch, Kunstmuseum Luzern, 1972. Zitiert nach Wiederabdruck in: Franz Gertsch. Polyfocal Allover, Swiss Institute New York 2020 (nachfolgend zitiert: Gertsch, Swiss Institute 2020), S. 106-109, hier: S.107. [9] Franz Gertsch in Conversation with Tobia Bezzola, in: Gertsch, Swiss Institute 2020, S. 173 -177, hier S. 174 [10] Jean-Francois Lyotard: Der Augenblick, Newman (Ausst. Kat. Barnett Newman, Grand Palais, Paris 1972), übersetzt abgedruckt in: Aisthesis. Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderen Ästhetik, Reclam: Leipzig 1991, S. 358-369. [11] Dieter Roelstraete: The Joys of Glam. Notes & Footnotes on Franz Gertsch, in: Gertsch, Swiss Institute 2020, S. 9-15, hier: S. 11. [12] Ders., a.a.O., S. 12. [13] Susan Sontag: Über Fotografie, Carl Hanser Verlag: München/Wien 1978, S. 9-28, hier: S. 4. [14] Strehle 2010. [15] Susan Sontag, a.a.O., S. 19. [16] Strehle 2010. |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/131/kw92.htm |
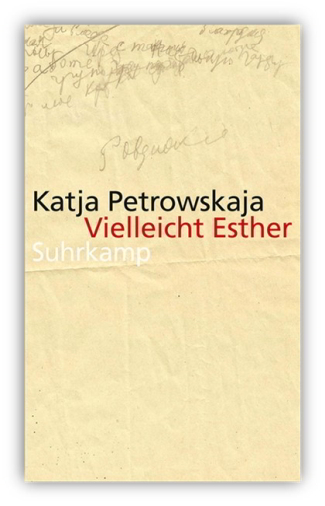 In ihrem Roman „Vielleicht Esther"
In ihrem Roman „Vielleicht Esther" Die in den 70er Jahren entstandenen großformatigen Gemälde des Schweizer Künstlers
Die in den 70er Jahren entstandenen großformatigen Gemälde des Schweizer Künstlers 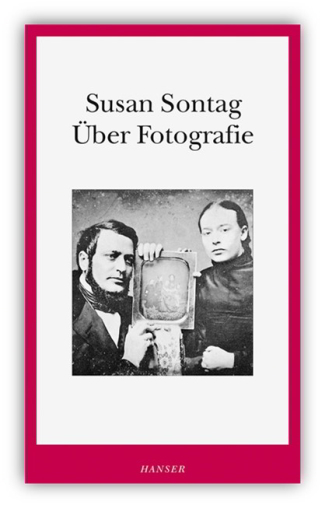 In ihrem Buch „Über Fotografie“ schreibt Susan Sontag: „Auch wenn es in gewisser Hinsicht zutrifft, dass die Kamera die Realität einfängt und nicht nur interpretiert, sind Fotos doch genauso eine Interpretation der Welt wie Gemälde oder Zeichnungen.“
In ihrem Buch „Über Fotografie“ schreibt Susan Sontag: „Auch wenn es in gewisser Hinsicht zutrifft, dass die Kamera die Realität einfängt und nicht nur interpretiert, sind Fotos doch genauso eine Interpretation der Welt wie Gemälde oder Zeichnungen.“