
Weltbegebenheiten |
Die entzogene WeltTransformationen des Kosmopolitischen zwischen Phänomenologie und DekonstruktionTill Heller Die Welt ist fort, ich muß dich tragen. Auftakt: Die Bühne der Welt
Der Vater jener Wuppertaler Tradition, in der die Welt ins Zentrum des Philosophierens rückt, spielt hier auf das Grundmotto der Phänomenologie an, dem sie – all ihrer Umgestaltungen zum Trotz – seit ihrer Stiftung bis heute treu geblieben ist: »zu den Sachen selbst!« Damit verbunden ist bekanntlich die zwingende methodische Forderung, sich bei der sachgemäßen Untersuchung der uns auf der »Bühne der Welt« (Kant) erscheinenden Phänomene nicht in leeren Spekulationen und theoretischen Gedankenkonstrukten zu verlieren. Stattdessen gilt es, Husserls »Prinzip aller Prinzipien« gemäß, „alles, was sich uns in der ,Intuition‘ originär, (sozusagen in seiner leibhaften Wirklichkeit) darbietet, einfach hinzunehmen (...), als was es sich gibt, aber auch nur in den Schranken, in denen es sich da gibt.“[5] Eine philosophische Untersuchung der Welt, die dieser Grundanforderung sachgemäß Rechnung zu tragen versucht, muss es sich zur Aufgabe machen, die Sache der Welt selbst als das der »natürlichen« und »phänomenologischen Einstellung« gemeinsame, aber von sich aus nur unthematisch gegebene Korrelat zu thematisieren, ohne sie dabei im Stile eines reduktiven Naturalismus oder der positiven Einzelwissenschaften zu verobjektivieren. Alles kommt hier darauf an, dass die ursprüngliche Verborgenheit und Unthematizität der unscheinbaren Welt bei ihrer phänomenologischen Thematisierung als Bühne der Phänomene berücksichtigt wird.[6] Die Welt ist deshalb dieser unhintergehbare Bezugspunkt, weil jede Gegebenheit von Erfahrenem die Vor-Gegebenheit ihres Sinnhorizontes voraussetzt, in dessen Grenzen uns das innerweltlich Seiende erscheinen kann. Das »Aufleuchten« (Heidegger) der unscheinbaren Welt in ihrem Offenbarwerden geht dem Erscheinenden dergestalt voraus, dass es dieses in seinem Erscheinen allererst ermöglicht, ohne dabei aber selbst als ein Seiendes in Erscheinung zu treten: Welt gibt sich, indem sie sich entzieht. Im Zentrum einer phänomenologischen Untersuchung der Lebenswelt steht daher stets auch ihr konstitutiver Entzug, der sie der fixierenden und objektivierenden Thematisierung entreißt. Daran wird bereits deutlich: Die Grundfrage nach der unausdrücklich erfahrenen und immer wieder neu zum Ausdruck zu bringenden Sache der Welt stellt sich im Anschluss an Husserl und Heidegger weniger im metaphysischen Sinne (»Warum ist überhaupt Welt und nicht vielmehr nichts?«), sondern vielmehr im genuin phänomenologischen Sinne (»Insofern es Welt gibt, wie gibt es sie?«). Ziel dieses Beitrags ist es demnach nicht, eine eindeutige Antwort auf die zuletzt viel-diskutierte Frage »ob es die Welt gibt«[7] zu gewinnen. Anliegen ist es vielmehr, sie als Frage zu erörtern, um von diesem Ort aus neue Perspektiven auf eine ausgezeichnete Weise des In-der-Welt-seins aufzuzeigen, die keine bloße (religiöse, ideologische usw.) Weltanschauung ist, sondern mit einer dezidiert philosophischen Haltung zum Weltganzen in Verbindung gebracht werden kann: der in der Neuzeit vornehmlich von Kant aufgegriffene und neu fundierte Kosmopolitismus. Um diese Perspektiven zu erschließen, gilt es in einem ersten Schritt, Kants Grundlegung des Kosmopolitismus zu rekonstruieren. Im zweiten Schritt soll die Kantische Konzeption des Kosmopolitismus sodann einer sowohl an Husserl, als auch an Heidegger orientierten phänomenologischen Destruktion unterzogen werden, um sie auf eine ihr verdeckt zu Grunde liegende Welterfahrung abzubauen. Der zweite Teil zielt darauf ab, eine ursprüngliche Weltlichkeit freizulegen, um sie im Rahmen einer dezidiert »welt-bürgerlichen Phänomenologie« (Held) geltend zu machen, die – ausgehend von der Differenz zwischen Heim- und Fremdwelt im Universalhorizont der einen Welt – um die Möglichkeitsbedingungen interkultureller Veständigungsprozesse überhaupt kreist. Der dritte, die Grenzen der klassischen Phänomenologie von Innen heraus transzendierende Schritt stellt schließlich den Versuch dar, die Spur des diesem Beitrag vorangestellten Verses von Celan im Rückgang auf Derridas dekonstruierende Texte zur sogenannten »unmöglichen Trauer« aufzunehmen, um sie als eine ethisch verpflichtende Apostrophe des Anderen lesbar zu machen, die sich nicht mehr im geschlossenen Welthorizont einer transzendentalen Subjektivität einschließen lässt. Statt erst nachträglich auf ein selbstpräsentes und selbsttransparentes Ich-Subjekt einzuwirken, bricht die jeder Präsenz immer schon zuvorkommende Spur des Anderen in der »vor-ursprünglichen« Trauerarbeit gleichsam hinter der Bühne der Welt und dem Rücken des Bewusstseins auf, um ein gastliches Selbst heimzusuchen und in Anspruch zu nehmen, das sich in dieser befremdlichen Inanspruchnahme allererst konstituiert, indem es sich je schon »zerspaltet« und »verandert«. Insofern sie den gastlichen Empfang des Anderen im Selben – in einer bereits untergegangenen oder noch nicht angekommenen, im Kommen begriffenen, „weltlosen Welt“[8] – markiert, eröffnet sich in der unmöglichen Trauer nach Derrida auch die Möglichkeit eines dezidiert gastfreundlichen Gemeinschaftsdenkens jenseits des kosmopolitischen Totalitätsdenkens, das am Ende des Beitrags zumindest kurz in Aussicht gestellt werden soll. 1. Kants Grundlegung des Kosmopolitismus
In der Antike aufkommend, setzt der Begriff des Kosmopolitismus sich aus dem wohlgeordneten Ganzen (κόσμος) und seinem in der Polis (πόλις) organisierten Bewohner, dem Bürger (πολίτης) zusammen. Wie jeder weiß, war es Kant, der die kosmopolitische Idee in der Neuzeit entscheidend aufgreifen und in Richtung einer universalen Rechts- und Moralphilosophie entfalten konnte, in deren Zentrum der aufgeklärte Weltbürger steht. Da Kants Refundierung des Kosmopolitismus, die mit seiner Abhandlung Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht (1784) einsetzt, einen entscheidenden Einschnitt im Weltbürgerdenken markiert, soll sie im Folgenden kurz in Erinnerung gerufen und in ihren Grundzügen beleuchtet werden. Seine Bestimmung des Menschen als Weltbürger bereitet Kant im Rahmen einer aus Vernunft gerechtfertigten Geschichtsphilosophie vor, in welcher die Menschheit in ihrer historisch-teleologischen Entwicklung „auf der großen Weltbühne“[10] betrachtet wird. Kants Geschichtsphilosophie kann als ein Anwendungsbeispiel der ersten Kritik (Kritik der reinen Vernunft, erstmals 1781) gelesen werden,[11] das anthropologische und rechtsphilosophische Überlegungen mit einschließt. Wie Werner Flach herausarbeiten konnte,[12] fällt Kant dabei keineswegs hinter die Einsichten seiner Vernunftkritik zurück, da die von ihm vorgelegte Geschichtsschreibung primär geltungstheoretischer und damit eben nicht empirischer Natur ist. Ihr Weg durch die als Menschheitsgeschichte folgt einem Leitfaden a priori innerhalb der Schranken menschlicher Vernunft.[13] Wenn wir auch nichts über die Eigenschaften des dunklen Dinges an sich wissen können, so dürfen wir nach Kant dennoch, um überhaupt sinnvolle Aussagen über die Geschichte zu machen, zumindest annehmen, dass sie „nach allgemeinen Naturgesetzen bestimmt“[14] sei. Deshalb kann Kant den Grundsatz (Erster Satz) aufstellen, dass alle Naturanlagen eines Geschöpfs dazu bestimmt sind, „sich einmal vollständig und zweckmäßig auszuwickeln.“[15] Die von einer solchen vernünftigen Naturabsicht[16] ausgehende, teleologische Naturlehre gibt somit den Leitfaden der allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht vor, die auf das telos einer regulativen Idee hin ausgerichtet sein muss: die Vervollkommnung des Menschen in seiner „unsterblichen Gattung“.[17] Um das dem Menschen a priori mitgegebene Vermögen der „Freiheit des Willens“[18] – deren Erscheinungsweisen nichts anderes als die menschlichen Handlungen sind – zu verwirklichen sowie die Naturanlage der Vernunft ihrem Zweck gemäß vollkommen zu entwickeln, bedarf es nach Kant einer rechtsstaatlichen Republik, was bereits auf die Spätschrift Zum ewigen Frieden (1795) verweist. Darin erweitert Kant seine Konzeption des Weltbürgertums um die kosmopolitische Idee eines völkerrechtlichen Friedensvertrages und die des Weltbürgerrechts, das zum Menschenrecht dazugehört. Um den Frieden zu wahren, muss das Recht dem Menschen „heilig gehalten werden, der herrschenden Gewalt mag es auch noch so große Aufopferung kosten.“[19] Die Freiheit des Einzelnen ist nur dann gesichert, wenn er sich gemäß seiner Naturabsicht „in einer allgemein das Recht verwaltenden bürgerlichen Gesellschaft“[20] universellen Gesetzen unterwirft. Kants Konzeption des Weltbürgertums zielt daher sowohl auf den Einzelnen, als auch auf die Gesellschaft ab: Zwar ist es uns als mangelhaftes und endliches Individuum gar nicht möglich, unsere Naturanlagen ganz auszuschöpfen, doch gerade deshalb soll die Vervollkommnung des Menschen als (Selbst-)Zweck seiner unsterblichen Gattung dienen. Der geschichtliche Fortschritt ist also auf die Tradition in intersubjektiver Gemeinschaft, d.h. auf die Überlieferung des Fortschritts von Generation zu Generation, angewiesen. Er setzt eine bestimmte Generativität voraus, in die das Individuum sich einschreibt. Schließlich ist der Mensch für Kant zwar das animal rationabile, das durch Verwirklichung seiner Vernunftfähigkeit animal rationale sein soll; als Einzelner betrachtet folgt er jedoch immer auch (unmündig) seinen Trieben, anstatt (mündig) vom Vermögen der Vernunft vollständigen Gebrauch zu machen. Diese Entfaltung der sich in weltbürgerlicher Gemeinschaft vervollkommnenden Vernunft aber ist der Idee nach das telos der Menschheit, ohne welches das Vorkommen der Vernunft selbst keinen Zweck hätte. Sofern der Mensch sich in einer republikanischen Staatsform und durch einen Friedensvertrag die richtigen Gesetze, auf die er einen unbedingten Rechtsanspruch hat, selbst gibt und sich ihnen aus freien Stücken unterwirft, ist er nach Kant Weltbürger im kosmopolitischen Sinne. Die Welt wird hier nicht im Sinne der reinen Vernunft epistemologisch, sondern von der praktischen Vernunft her, »ethikotheologisch« „als ein nach Zwecken zusammenhängendes Ganzes und als System von Endursachen“[21] bestimmt. Insofern Kants transzendentaler Idealismus zwischen »Ding an sich« (Noumenon) und »Erscheinungen für uns« (Phaenomena) unterscheidet, nimmt er den Mensch aber nicht nur als moralisch-geistiges Wesen, sondern als »Bürger zweier Welten« in den Blick. Obwohl der Mensch die phänomenale Sinnenwelt, welche durch die in den Naturerscheinungen wirkende Kausalität bestimmt wird, mittels der Vernunft auf eine geistige Welt reiner Idealität mit sittlichen Gesetzen hin transzendiert, denen der Wille sich unterwerfen soll, um an sich selbst moralisch gut zu sein, bleibt er dabei doch an seine endliche Faktizität gebunden. Der kantische Weltbürger bewohnt also nicht bloß die empirische Welt der Erscheinungen, über die wir als solche, da sie selbst die Grenzen möglicher Erfahrung übersteigt, überhaupt keine substantiellen Aussagen treffen können. Stattdessen handelt es sich bei der kosmologischen Weltganzheit um eine transzendentale Idee, die ohne jede empirische Grundlage in der synthetisierenden Vernunft gebildet wird. Das Weltganze kann uns ja nie anschaulich in der Erfahrung gegeben sein. Begriffe ohne Anschauung aber sind, der grundlegenden Kantischen Einsicht gemäß, verworren: „Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind.“[22] Als „Inbegriff aller Erscheinungen“[23] stellt die kosmologisch verstandene Welt den Bedingungszusammenhang von erfahrbaren Erscheinungen dar, der als solcher aber selbst nicht erfahren und somit nicht erkannt werden kann. Auch ob die Welt in ihrer Totalität selbst Grenzen hat – etwa in Raum und Zeit – kann Kants Antinomienlehre zufolge[24] nicht entschieden werden. Um die Grenzen der Welt auszuloten, bedarf es vielmehr der Freilegung einer genuin phänomenologischen Erfahrung des transzendentalen Feldes, in dem der fundierende Seinsboden der Welt sich als konstituierter Sinnhorizont erweist, auf den wir als konstituierende Subjekte je schon bezogen sind. 2. Die Destruktion des Kosmopolitismus in der »welt-bürgerlichen Phänomenologie«
Wenn wir die Phänomene sachgemäß untersuchen wollen, kommen wir billigerweise nicht drum herum, auch uns selbst samt der Verstehens- und Bewusstseinsstrukturen in die Untersuchung mit einzubeziehen, denen die gegebenen Gegenstände ihre Gegenständlichkeit verdanken. Dabei bleiben wir unweigerlich an eine leiblich verankerte Erste-Person-Perspektive in der Lebenswelt gebunden, die sich nicht restlos in objektiven Zusammenhängen eliminieren oder in Bündeln von sprachlichen Zeichen, sozialen Diskursen etc. auflösen lässt. Aus diesem Grund ist die Subjektivität des Subjekts und zwar in der ausgezeichneten Rolle, die ihr beim Werden der Welt zukommt, ein wesentliches Grundthema der Phänomenologie. Das dabei freigelegte Forschungsfeld bezeichnet aber keine abgekapselte Innerlichkeit, sondern vielmehr das Aus-sich-heraus-treten einer Transzendenz, die nach Heidegger als irreduzible Offenheit für den Sinn von Welt aufzufassen ist: „Wählt man für das Seiende, das wir je selbst sind und als ,Dasein‘ verstehen, den Titel ,Subjekt‘, dann gilt: die Transzendenz bezeichnet das Wesen des Subjekts, ist Grundstruktur der Subjektivität.“[27] Insofern Welt den ganzheitlichen Horizont eines umfassenden Bedeutungszusammenhanges meint, in dem wir je schon stehen, kann sie nicht einfach etwas Vorhandenes sein, das uns irgendwie gegenüberstünde. Weder bezeichnet sie die Totalität aller innerweltlich erscheinenden Gegenstände oder Tatsachen, noch darf sie als eine Art Behälter (z.B. als »big physical object«)[28] vorgestellt werden, in dem alles, was ist, irgendwie vorkommt. Vielmehr gibt sie sich als ein ganzheitlicher Sinnhorizont, in den wir je schon eingelassen sind[29] und zu dem wir – um einen weiteren Terminus Heideggers aufzugreifen – in einer wesentlich »ek-statischen« Beziehung stehen. Als verbal verstandene »Ek-sistenz«,[30] die Heidegger auch als ein verstehendes »Hinaus-stehen« in die Offenbarkeit von Welt charakterisiert, sind wir nichts anderes als dieses mit anderen geteilte Weltverhältnis selbst. Das Dasein existiert nach Heidegger nicht zuerst für sich, um sich dann nachträglich auch auf ein Außen zu beziehen, in dem es für Andere da ist. Vielmehr ist das Dasein in seiner Hinausgehaltenheit immer schon außer sich und mit Anderen. Es ek-sistiert als ein ausgesetztes Draußen-sein, das in die Offenbarkeit einer im Miteinandersein geteilten Welt hinaussteht. Einerseits ist die erscheinende Welt in ihrem Erscheinen bedingt vom seinsverstehenden Dasein. Andererseits sind wir als Existierende je schon in die Lebenswelt eingebettet und unsere Existenz lässt sich ihrerseits überhaupt nur in ihrer Weltlichkeit verstehen. Die Welt ist also auf der einen Seite konstitutiv für das Sein des Daseins, auf der anderen Seite konstituiert Welt sich nur in Mitsprache des Daseins. Sie ist dem Dasein immer schon eingeschrieben, sowie das Dasein seit jeher verwoben ist in die Netze der Lebenswelt. „Wesenhaft daseinsbezogen,“[31] schwingt das Ganze der Welt im Sein des Daseins als dessen bestimmender Grundton mit. Um dieser wechselseitigen Verankerung von Subjektivität und Welt Rechnung zu tragen, konnte Heidegger in Sein und Zeit (1927) bekanntlich den zentralen Begriff des In-der-Welt-seins prägen, der die fundamentale Seinsverfassung des Daseins zum Ausdruck bringt. Statt einem ausgedehnten Außen gegenüber zu stehen, sind wir immer schon in einer konkreten Welt aus Sinnzusammenhängen und bedeutungshaften Phänomenen verankert und durch unseren Bezug zu ihr bestimmt. Heidegger weißt aber auch darauf hin, dass dieser innige Weltbezug so selbstverständlich für uns ist, dass wir ihn im alltäglichen Lebensvollzug gleichsam immer schon übersehen. Doch gerade hinter dieser Selbstverständlichkeit unseres durchschnittlichen Selbstverständnisses verbirgt sich für den Phänomenologen, der gerade nichts als selbstverständlich voraussetzen darf, der Abgrund eines Rätsels. Er bleibt einer permanenten Beunruhigung ausgesetzt, die ihn an-sich-halten und hinter das Seiende zurückfragen lässt, um das Ungewohnte im Gewohnten, das Unverständliche im Selbstverständlichen aufzuspüren. Ihm wird gerade dasjenige fragwürdig, „was so fundamental ist, das man es ohne ihm weiter Beachtung zu schenken einfach als gegeben hinnimmt.“[32] Seine unendliche Aufgabe ist es daher, das implizite Alltagsverständnis der Welt allererst explizit zu machen, um es in ein philosophisches Verständnis zu überführen. Der Rückgang auf die Sachen selbst impliziert somit die Freilegung einer originären Welterfahrung des Daseins, die jeder begrifflichen Fixierung vorausliegt und ihre verborgene Voraussetzung bildet. Da auch jede wissenschaftliche Betrachtung des Seienden dem ek-statischen In-der-Welt-sein des Daseins entspringt, das die verborgene Seinsgrundlage jeder intentionalen Bezugnahme bildet, stellen auf empirischen Untersuchungen beruhende Aussagen über die Natur des Menschen oder des Kosmos eine auf Abstraktionen und Idealisierungen aufbauende Artikulation zweiter Ordnung dar. Phänomenologisch gesehen ist die „einseitige Konzentration“ der positiven Einzelwissenschaften „auf das, was aus einer Dritten-Person-Perspektive zugänglich ist, (...) nicht nur naiv, sondern auch unredlich, da die wissenschaftliche Praxis stets die vorwissenschaftliche Welterfahrung aus der Erster-Person-Perspektive voraussetzt.“[33] In diesem Sinn kann Husserls Motto »Zu den Sachen selbst« auch als Ausdruck einer kritischen Haltung verstanden werden, die sich gegen metaphysische oder szientistische Weltanschauungen richtet, um sie auf ein ursprüngliches, zunächst unausdrückliches Weltverhältnis abzubauen. Nichts anderes soll hier mit der phänomenologischen Destruktion des Kosmopolitismus zum Ausdruck gebracht werden. Gemeint ist keine rein negative Bezugnahme im Sinne einer „schlechten Relativierung“ ihres Gegenstandes. Stattdessen zielt sie im Sinne Heideggers darauf ab, die tradierte Konzeption des Kosmopolitismus „in ihren positiven Möglichkeiten, und das besagt immer, in ihren Grenzen“[34] abzustecken und durchsichtig zu machen. Es handelt sich um einen produktiven Abbau, dem es keineswegs um eine bloße Überwindung, sondern vielmehr um eine rekonstruktive Neubelebung des Kosmopolitischen geht. Um die Phänomenologie der Lebenswelt für eine dezidiert »welt-bürgerliche« Praxis (Held) fruchbar zu machen, ist – neben der Heideggerschen Destruktion überkommener Begriffe und Vorstellungen – die Rückbesinnung auf Husserls Bestimmung der Welt als Universalhorizont von entscheidender Bedeutung, der sich in spezifische Unterhorizonte, nämlich in Heim- und Fremdwelt auffächert. Wie Husserl in seinen Texten Zur Phänomenologie der Intersubjektivität (1929–1935) schreibt, stellt jede Kultur oder »spezifische Menschheit« eine endliche und „einheitliche Welt“ unter vielen dar, die allesamt auf den unendlichen Universalhorizont der Menschheit als solcher verweisen, der sich als unthematisch bleibende Rückseite aller Sonderhorizonte „im Fortschreiten der allgemeinen Weltkonstitution“[35] bildet. Auf der einen Seite können wir nur deshalb von pluralen Welten sprechen und sie miteinander in Beziehung setzen, weil wir selbst je schon in einer dieser Welten situiert und verwurzelt sind, die wir mit Husserl als unsere »Heimwelt« bezeichnen können und von deren Standpunkt aus wir andere Welten betrachten, die uns fremd erscheinen.[36] Auf der anderen Seite kommt auch meine gewohnte Welt „als Heimwelt,“ so Husserl, „nur zur Abhebung, wenn schon andere Heimwelten (...) mit im Horizont sind.“[37] Weil das Heimische „sich als solches erst durch den Kontrast zum Fremden“ zeigt, kann die eigene Welt, die bis dahin die einzige Welt war,“ erst in der intermundanen Begegnung mit dem Fremden „als das uns Eigene, d.h. als Heimwelt erfahren werden.“[38] Insofern ich mich nach Husserl „nur auf dem Umweg über die »Anderen«“[39] selbst als Mensch verstehen kann, ist der „fremde Mensch konstitutiv der an sich erste Mensch.“[40] Alles kommt hier darauf an, den Fremden, der Husserl zufolge immer nur durch analogisierende »Apperzeption« im eigenen Selbst gespiegelt und (mit)gegenwärtig gemacht werden kann, nicht auf eine bloße Dublette des Eigenen zu reduzieren und so seine irritierende Fremdheit zu nivellieren: „In mir erfahre, erkenne ich den Anderen, in mir konstituiert er sich — appräsentativ gespiegelt, und nicht als Original.“[41] Doch weil der Fremde sich als Fremder meinem eigenen Zugriff entzieht, bleibt er für Husserl stets nur in einer gewissen Unzugänglichkeit zugänglich.[42] Diese nicht zu tilgende Asymmetrie ist auch der Grund, weshalb wir dem Fremden unser eigenes Urteil im Dialog der Kulturen niemals aufoktroyieren, sondern – wie Klaus Held in Anlehnung an Kant festhält – lediglich »ansinnen« darf. Wer sich zwischen den verschiedenen Kulturwelten bewegt, bleibt dabei doch stets an eine heimweltlich disponierte Perspektive gebunden, die seine Urteilsbildung fundiert. Denn ebensowenig, wie wir die Stelle des Anderen einnehmen können, ist es uns aus phänomenologischer Sicht möglich, einen übergeordneten oder kosmologischen Standpunkt einzunehmen, von dem aus wir die eine Welt im Ganzen samt ihrer mannigfaltigen Sonderwelten neutral in den Blick nehmen und komparativ untersuchen könnten. Aus dieser Selbstbescheidung des Denkens erwächst bei Held eine dezidiert »welt-bürgerliche« Spielart der Phänomenologie, die sich von der Kantischen Konzeption des Kosmopolitismus deutlich abhebt. Der sich als Kosmopolit verstehende Weltbürger im Sinne Kants bleibt ja der romantischen Illusion verhaftet, „an keine heimweltliche Perspektive mehr gebunden und auf der ganzen Welt zu Hause zu sein.“[43] Stattdessen schlägt Held die Praxis eines »welt-bürgerlichen« Denkens vor, das an die Stelle eines normierenden Zugangs zur Moral tritt und „das bei der Thematisierung der einen Welt ihrer unaufhebbaren Unthematizität dadurch gerecht zu werden sucht, dass es sich den Welterfahrungen fremder Kulturen im Bürgergeist der wechselseitigen Erprobung der Ansinnbarkeit nähert.“[44] Damit ist in der Tat eine echte phänomenologische Grundlage für einen interkulturellen Austausch in weltbürgerlicher Absicht gefunden, die allerdings die entscheidende Fragen aufwirft, wo genau das Eigene aufhört und das Fremde beginnt. Wenn die inkommensurable Fremdheit des Anderen sich nicht auf das Selbe reduzieren lässt, dann übersteigt sie den egologischen Horizont des Subjekts, an dem sie nicht einfach spurlos vorbeigeht. Mit Waldenfels gesagt, impliziert die Fremderfahrung vielmehr ein Fremdwerden der eigenen Erfahrung.[45] Indem sie radikale Veranderungen des responsiven Subjekts zeitigt, das ihr pathisch ausgesetzt ist, lässt sie seinen Selbstbezug je schon in einen Fremdbezug übergehen. Dieser irreduziblen »Verstrickung des Anderen im Selben« (Levinas) gilt es nun im Rückgang auf Derridas Überlegungen zur Trauerarbeit auf den Grund zu gehen. Der von Derrida in zahlreichen Gedenktexten performativ ins Werk gesetzte Trauerprozess bringt ein von Anfang an gespaltenes Selbst hervor, das sich selbst nicht durchsichtig ist und das nie ganz zu sich findet, sofern es auf den vorgängigen Anspruch des Anderen in seiner uneinholbaren Andersheit antwortet. Damit trägt er der relationalen Selbstkonstitution eines gastlichen Subjekts Rechnung, das keinen selbstpräsenten Selbstbezug zeitigt, sondern vielmehr in einer abwesenden Welt „nach dem Ende der Welt“[46] überlebt, indem es die ethisch verpflichtende Spur des Anderen verantwortlich auf sich nimmt und in sich austrägt. 3. Die Dekonstruktion des Kosmopolitismus‘ in Derridas Auto-Thanato-Polito-Graphie
Im Gegensatz zu Freud, der die Trauer in Abgrenzung zur Melancholie psychoanalytisch untersucht hat,[49] geht es Derrida nicht bloß darum, innerpsychische Trauerprozesse zu analysieren, die erst nach einer konkreten und erfolgreich zu verarbeitenden Verlusterfahrung einsetzen. Vielmehr lotet er die Möglichkeiten einer immer schon vor dem tatsächlichen Todesfall einsetzenden und niemals zum Abschluss kommenden, »unmöglichen Trauer«[50] aus, in der die Selbstbeziehung des Subjekts durch die Internalisierung des Anderen sowohl allererst eröffnet, als auch unterwandert wird. Derrida Trauertexte – die als kontextuelle Anwendungen des dekonstruktiven Lektüreverfahrens nicht lediglich über die Trauer sprechen, sondern sie performativ selbst aussprechen – legen jedes Mal Zeugnis für eine einzigartige, aber endliche Freundschaft ab, die von Anfang an von der unheimlichen Einsicht getrübt gewesen ist, dass einer der beiden Freunde den anderen überleben wird, um ihn trauernd in Erinnerung zu behalten. Der Preis der Freundschaft ist der Tod, mit dem, obwohl er als ein unvorhersehbares und unkalkulierbares Ereignis über uns hereinbricht, stets zu rechnen ist. Als ein solches Mitsein-zum-Tode, in dem wir primär für den Anderen sind, erweist sich die Freundschaft nach Derrida aber erst im Nachhinein als eine bereits von Vornherein durch das Hereinreichen des Todes in das Leben versehrte Beziehung. Indem sie die Sterblichkeit des Einen vor dem Anderen bezeugt, hüllt die Freundschaft „einen jeden in die Trauer einer unerbittlichen zukünftigen Vergangenheit. Einer von uns beiden wird alleine zurückgeblieben sein, wir wußten es beide im voraus. Und immer schon.“[51] Zwar wird uns die Unersetzbarkeit und absolute Einzigkeit (Singularität) jedes Einzelnen, die seiner uneinholbaren Andersheit (Alterität) geschuldet ist, gerade dann bewusst, wenn wir einen geliebten Menschen für immer verloren haben. Doch gerade in der Trauer ist die Andersheit des Anderen besonders gefährdet ist, weil dieser kein Veto gegen seine posthume Aneignung und erinnernde Verinnerlichung mehr einlegen kann, die ihn gleichsam in uns oder durch uns, die wir seiner gedenken, weiterleben lässt und dem Gedächtnis anheimgibt: „Wenn der Tod dem anderen widerfährt und uns widerfährt durch den anderen, dann ist der Freund nurmehr in uns, unter uns. In sich selbst, durch sich selbst und aus sich selbst ist er nicht mehr. Er lebt nur in uns. Aber wir sind niemals wir selbst und unter uns, mit uns identisch; ein »Ich« ist niemals in sich selbst, identisch mit sich selbst.“[52] Einerseits schreibt die Trauerarbeit vor, die Spur des abwesenden Anderen als verlorenes Lustobjekt symbolisch zu internalisieren und anzueignen, um die Erinnerung an ihn lebendig zu halten. Nur durch die aneignende Einverleibung des stets vom Tod bedrohten Anderen, mit dem es sich in der Trauer von Anbeginn an zu identifizieren versucht – so Derridas These – kann das Selbst sich zu sich selbst, d.h. zu sich als einem Anderen verhalten. Andererseits scheitert der Subjektivierungsprozess einer verinnerlichenden Aneignung des Anderen für Derrida gerade an seiner radikalen Andersheit und uneinholbaren Äußerlichkeit, die jedem Anderen auf Grund seiner absoluten Transzendenz zukommt: „Tout autre est tout autre.“[53] Weil die in der Trauer inkorporierte Spur des Anderen nicht auf eine Präsenz, sondern auf eine unvordenkliche Vergangenheit verweist, die als solche niemals Gegenwart war, entzieht sie sich der verinnerlichenden (Ver-)Gegenwärtigung in der Selbstgegenwart des Bewusstseins. Damit aber fällt die Möglichkeit der Trauer, den Anderen zu internalisieren und ins Selbst aufzunehmen, in eins mit ihrer Unmöglichkeit: der aneignenden Internalisierung des Anderen. Wenn die aporetische Erfahrung einer gewaltvollen Verinnerlichung des Anderen in der Trauer aber billigerweise nicht vermieden werden kann, dann lässt sie nur die Wahl „zwischen mehreren, unendlich unterschiedlichen Arten von Empfängnis-Aneignung-Assimilierung des Anderen.“[54] Eine ethische Trauerarbeit müsste nach Derrida ihren Anfang dann darin nehmen, „die beste, respektvollste und dankbarste, und auch freigiebigste Weise zu bestimmen, sich auf den Anderen und den Anderen auf sich selbst zu beziehen.“[55] Um den ethischen Imperativ der aporetischen Trauerarbeit auf den Punkt zu bringen, zitiert der Denker Derrida in seiner Kondolenzrede für Gadamer immer wieder einen Vers des Dichters Celan: Die Welt ist fort, ich muss dich tragen. Es handelt sich um eine Apostrophe der Trauer, die sich an den transzendenten Anderen (zurück-)wendet, dessen verantwortungsvolle Aufnahme im Selben nur „jenseits oder diesseits der Welt selbst“ stattfinden kann. Insofern der Tod nach Derrida gerade das Entschwinden der Welt und ihrer sinnhaften Bezüge bedeutet, verbleibt der Überlebende fortan „in der Welt außerhalb der Welt und der Welt beraubt. Er fühlt sich zumindest allein verantwortlich, dazu bestimmt, sowohl den anderen als auch dessen Welt weiterzutragen (...), künftig in einer weltlosen Welt, als wäre er erdenlos jenseits des Weltendes.“[56] Weil der Überlebende die einzuverleibende, in ihrer absoluten Transzendenz aber nicht restlos anzueignende Spur des Anderen verantwortlich verinnerlichen muss, ohne sie in der Innerlichkeit der Subjektivität oder im egologisch bestimmten Welthorizont einzuschließen, kann seine Trauerarbeit niemals endgültig zum Abschluss gebracht werden. Stattdessen muss er die transzendente Spur des Anderen als einen irreduziblen Fremdkörper inkorporieren, der in seiner Unzugänglichkeit gleichsam »in uns außer uns« verbleibt. Dadurch aber wird dem Innern des sich in der Trauer aufspaltenden Daseins eine uneinholbare Exteriorität eingeschrieben, die es als ein ausgesetztes Außer-sich-sein markiert. Es handelt sich um eine intrasubjektive Alterität, die das Selbst nur affiziert, indem sie es je schon exponiert und auf den intersubjektiv bestimmten Anderen hin öffnet. Aus dieser offenen Wunde, die das endliche Leben des responsiven Selbst seit jeher als ein vulnerables Überleben kennzeichnet, erwächst zugleich eine unbedingte Responsabilität dem radikal Anderem und absolut Singulären gegenüber. Sie eröffnet die Möglichkeit eine Politik der Trauer, die „über das Weltbürgertum und den Nationalstaat im allgemeinen“[57] hinausgeht, um sie stattdessen der ereignishaften Ankunft des Anderen zu öffnen, den es gastlich im Selben zu empfangen gilt. Indem sie eine Verpflichtung gegenüber der absoluten Andersheit und Einzigkeit des Anderen signiert, setzt die Trauerarbeit somit letztlich eine andere „Universalisierung“ ins Werk, die „nichts anderes universalisiert als die Berücksichtigung der namenlosen und irreduziblen Singularität des Einzelnen.“[58]
Anmerkungen[1] Klaus Held, Husserls phänomenologische Gegenwartsdiagnose im Vergleich mit Heidegger, in: Gerhard Funke (Hg.), Husserl-Symposion Mainz 27.6./4.7.1988, Mainz: Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Wiesbaden und Stuttgart 1989, S. 33–50, hier: S. 35 [2] Vgl. László Tengelyi, Welt und Unendlichkeit. Zum Problem phänomenologischer Metaphysik, Freiburg/München 3. Aufl. 2015, S. 18. [3] Held, Husserls phänomenologische Gegenwartsdiagnose im Vergleich mit Heidegger, S. 35. [4] Ebd. [5] Edmund Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie, Hua III.I, neu hg. von Karl Schuhmann, Den Haag 1976, S. 51. [6] Vgl. Held, Europa und die Welt. Studien zur welt-bürgerlichen Phänomenologie, Sankt Augustin 2013, S. 20. [7] Vgl. Markus Gabriel, Warum es die Welt nicht gibt, 5. Aufl. Berlin 2015. [8] Jacques Derrida, Der ununterbrochene Dialog: zwischen zwei Unendlichkeiten, das Gedicht, in: Jacques Derrida, Hans-Georg Gadamer, Der ununterbrochene Dialog, hg. von M. Gessmann, 4. Aufl. Frankfurt a. M. 2004, S. 7–50, hier: S. 15. [9] Vgl. Jürgen Habermas, Die postnationale Konstellation. Politische Essays, Frankfurt a. M. 1998. [10] Immanuel Kant, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, in: Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Politik und Pädagogik, Werke VI, hg. von W. Weischedel, 8. Aufl. Darmstadt 2016, S. 33–50, hier: S. 34 (A 387, 388). [11] Vgl. Werner Flach, Zu Kants geschichtsphilosophischem „Chiliasmus“, in: Phänomenologische Forschungen, 2005, S. 167–174. [12] Vgl. Ebd. [13] Vgl. Kant, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, S. 34 (A 387, 388). [14] Ebd., S. 33 (A 385, 386). [15] Ebd., S. 35 (A 389). [16] Ebd., S. 34 (A 387, 388). [17] Ebd. [18] Ebd., S. 36 (A 390, 391). [19] Kant, Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf, in: Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Politik und Pädagogik, Werke VI, hg. von W. Weischedel, 8. Aufl. Darmstadt 2016, S. 195–252, hier: S. 243f. (B 96, 97/ A 90, 91). [20] Kant, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, S. 39 (A 395). [21] Kant, Kritik der Urteilskraft, in: Kritik der Urteilskraft und Schriften zur Naturphilosophie, Werke V, hg. von W. Weischedel, 8. Aufl. Darmstadt 2016, S. 233–620, hier: S. 569 (B 413, 414 / A 409). [22] Ebd., S. 98 (B 76 / A 52). [23] Ebd., S. 436 (B 484 / A 456). [24] Ebd., S. 434 ff. (B 480 / A 454). [25] Heidegger, Sein und Zeit, 19. Aufl. Tübingen 2006, S. 31. [26] Ebd., S. 35. [27] Ebd., S. 137f. [28] Vgl. David Lewis, On The Plurality of Worlds, Oxford 1986, p. 1. [29] Vgl. Dan Zahavi, Phänomenologie für Einsteiger, Paderborn 2007, S. 39. [30] Vgl. Heidegger, Brief über den Humanismus, in: Wegmarken, GA 9, hg. von F.-W. von Herrmann, 3. Aufl. Frankfurt a. M. 2004, S. 313–364. [31] Heidegger, Vom Wesen des Grundes, in: Wegmarken, GA 9, S. 123-175, hier: S. 157. [32] Zahavi, Phänomenologie für Einsteiger, S. 46. [33] Ebd., S. 38. [34] Heidegger, Sein und Zeit, S. 22. [35] Husserl, Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass. Dritter Teil: 1929–1935, Hua XV, hg. von I. Kern, Den Haag 1973, S. 205. [36] Vgl. Held, Europa und die Welt, S. 25. [37] Husserl, Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass. Dritter Teil: 1929–1935, Hua XV, S. 176. [38] Held, Europa und die Welt, S. 57. [39] Husserl, Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass. Zweiter Teil: 1921–1928, Hua XIV, hg. von I. Kern, Den Haag 1973, S. 416. [40] Husserl, Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge, Hua I, hg. von S. Strasser, Den Haag 1973, S. 153. [41] Husserl, Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass. Zweiter Teil: 1921–1928, Hua XIV, S. 175. [42] Vgl. Husserl, Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge, Hua I, S. 144. [43] Ebd. [44] Ebd. [45] Bernhard Waldenfels, Grundmotive einer Phänomenologie des Fremden, 6. Aufl. Frankfurt a. M. 2016, S. 8. [46] Derrida, Der ununterbrochene Dialog, S. 15. [47] Vgl. Derrida, Marx Gespenster: Der verschuldete Staat, die Trauerarbeit und die neue Internationale, übers. von S. Lüdemann, 5. Aufl. Frankfurt a. M. 2005, S. 12. [48] Vgl. Till Heller, Die Welt nach ihrem Ende. Interkulturelle Phänomenologie und Auto-Thanato-Polito-Graphie nach Derrida, in: Inga Römer, Sergej Seitz, Georg Stenger (Hg.), Faktum, Faktizität, Wirklichkeit: Phänomenologische Perspektiven, [im Erscheinen] [49] Vgl. Sigmund Freud, Trauer und Melancholie, in: Psychologie des Unbewußten, Studienausgabe Bd. III, Frankfurt a. M. 1989, S. 193–212. [50] Vgl. Derrida, Mémoires: Für Paul de Man, hg. von P. Engelmann, übers. von H.-D. Gondek, Wien 1988. [51] Derrida, Der ununterbrochene Dialog, S. 14. [52] Derrida, Mémoires: Für Paul de Man, S. 50. [53] Derrida, Den Tod geben, in: Anselm Haverkamp (Hg.), Gewalt und Gerechtigkeit. Derrida-Benjamin, Frankfurt a. M. 1994, S. 331–445, hier: S. 413. [54] Derrida, Auslassungspunkte. Gespräche, hg. von P. Engelmann, übers. von K. Schreiner und D. Weissmann, Wien 1998, S. 292. [55] Ebd., S. 292f. [56] Derrida, Der ununterbrochene Dialog, S. 15. [57] Derrida, Die unbedingte Universität, übers. v. S. Lorenzer, Frankfurt a. M. 2001, S. 14. [58] Jürgen Habermas, Jacques Derrida, Philosophie in Zeiten des Terrors. Zwei Gespräche, geführt, eingeleitet und kommentiert von G. Borradori, Darmstadt 2004, S. 157. |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/127/th1.htm |
 Es war der Wuppertaler Philosoph Klaus Held, der in seinem Aufsatz Husserls phänomenologische Gegenwartsdiagnose im Vergleich mit Heidegger (1988) die beiden Gründerväter der Phänomenologie produktiv engführen und das Ganze der Welt in einigen Leitsätzen als die ureigene Sache phänomenologischen Denkens kennzeichnen konnte. „Die Sache der Philosophie“, so Held, ist erstens „identisch mit der des natürlichen Lebens: die Welt.“
Es war der Wuppertaler Philosoph Klaus Held, der in seinem Aufsatz Husserls phänomenologische Gegenwartsdiagnose im Vergleich mit Heidegger (1988) die beiden Gründerväter der Phänomenologie produktiv engführen und das Ganze der Welt in einigen Leitsätzen als die ureigene Sache phänomenologischen Denkens kennzeichnen konnte. „Die Sache der Philosophie“, so Held, ist erstens „identisch mit der des natürlichen Lebens: die Welt.“ Was also meinen wir, wenn wir vom Kosmopolitischen sprechen? Der Kosmopolitismus bezeichnet eine politisch-moralische Haltung im Ganzen der Welt, die heute oftmals als komplementär zur »postnationalen Konstellation« (Habermas)
Was also meinen wir, wenn wir vom Kosmopolitischen sprechen? Der Kosmopolitismus bezeichnet eine politisch-moralische Haltung im Ganzen der Welt, die heute oftmals als komplementär zur »postnationalen Konstellation« (Habermas)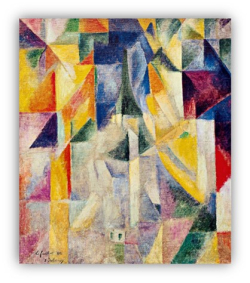 Wie der Name bereits verrät, hat die Phänomenologie mit Phänomenen, d.h. mit Erscheinungen in ihrem subjekt-bezüglichen Erscheinen zu tun. Das Phänomen ist „das Sich-an-ihm-selbst-zeigende,“
Wie der Name bereits verrät, hat die Phänomenologie mit Phänomenen, d.h. mit Erscheinungen in ihrem subjekt-bezüglichen Erscheinen zu tun. Das Phänomen ist „das Sich-an-ihm-selbst-zeigende,“ Derridas zahlreiche Trauerreden, die er für so unterschiedliche verstorbene Weggefährten wie beispielsweise Roland Barthes, Michel Foucault, Louis Althusser, Emmanuel Levinas, Hans-Georg Gadamer oder Maurice Blanchot gehalten hat, stehen in der langen, über Heidegger und Schopenhauer bis hin zu Epikur und Platon zurückreichenden Traditionslinie eines okzidentalen Philosophierens, das sich als »Sterben-lernen«, als eine denkerische »Einübung« oder ein sich-sorgendes »Vorlaufen in den Tod« versteht. Der Verweis auf die Tradition entspricht durchaus dem Selbstverständnis von Derridas dekonstuierenden Lektüren, die als philosophische Interventionen gegenüber dem unaufhebbar mehrdeutigen und unentrinnbaren Erbe der Metaphysik
Derridas zahlreiche Trauerreden, die er für so unterschiedliche verstorbene Weggefährten wie beispielsweise Roland Barthes, Michel Foucault, Louis Althusser, Emmanuel Levinas, Hans-Georg Gadamer oder Maurice Blanchot gehalten hat, stehen in der langen, über Heidegger und Schopenhauer bis hin zu Epikur und Platon zurückreichenden Traditionslinie eines okzidentalen Philosophierens, das sich als »Sterben-lernen«, als eine denkerische »Einübung« oder ein sich-sorgendes »Vorlaufen in den Tod« versteht. Der Verweis auf die Tradition entspricht durchaus dem Selbstverständnis von Derridas dekonstuierenden Lektüren, die als philosophische Interventionen gegenüber dem unaufhebbar mehrdeutigen und unentrinnbaren Erbe der Metaphysik