Gliederung
Teil III: 26. Versailles - 27. Musée Carnavalet - 28. Jardin du Luxembourg - 29. Fondation Louis Vuitton - 30. Place des Vosges - 31. Sacré Cœur - 32. Musée de Quai Branly - 33. Centre Pompidou - 34. Champs Elysées - 35. Bibliothèque Nationale - 36. Metropole und Provinz - 37. Brasserie - 38. Paris in Deutschland - 39. Raum und Komplexität - 40. Zurück in die deutsche Provinz

26. Versailles
Versailles gehört nicht zu Paris und auch nicht zu den Banlieues. Versailles ist eine selbständige Stadt. Man kann höchstens sagen, Stadt und Schloss lägen im Pariser Großraum. Trotzdem braucht der Paris-Besucher den Besuch in Versailles als historischen Kontrapunkt zu Revolution, Barrikaden und Industrialisierung. Und es ist gut, dafür Abstand zu gewinnen von Notre Dame, Champs-Élysées und Eiffelturm. Für Versailles brauchen der Flaneur wie der Spaziergänger Distanz, und umgekehrt schafft das Königsschloss Distanz zur Großstadterfahrung der Arrondissements. Man besteigt den RER, die Schnell- oder S-Bahn, welche die Métro ergänzt, und steigt an der Endhaltestelle der Linie C aus. Von dort aus ist das Schloss in weniger als einer Viertelstunde zu erreichen.
 Wenn der französische Absolutismus des 17. und 18. Jahrhunderts ein architektonisches Gesicht brauchte, dann ist es in diesem weitläufigen Schloss mit seinen Parkanlagen verwirklicht. Stand das Panthéon für herausragende Schriftsteller, Wissenschaftler und Widerstandskämpfer, so steht das Schloss für den absolutistischen Sonnenkönig und sein Gefolge, den adeligen Hofstaat. Der König durfte sich in einer kruden Mischung aus Macht, Hofzeremoniell und Architektur als der symbolische Mittelpunkt des Landes fühlen, im säkularisierten Gegensatz zu seinen Vorgängern Ludwig dem Heiligen, der seine Macht aus der Kooperation mit der Kirche bezog und dessen Leichnam konserviert und in Reliquien aufgeteilt wurde, und zu Heinrich IV. von Navarra, dessen frühaufgeklärter religionsphilosophischer Klugheit Heinrich Mann im 20. Jahrhundert ein Denkmal setzte.[1]
Wenn der französische Absolutismus des 17. und 18. Jahrhunderts ein architektonisches Gesicht brauchte, dann ist es in diesem weitläufigen Schloss mit seinen Parkanlagen verwirklicht. Stand das Panthéon für herausragende Schriftsteller, Wissenschaftler und Widerstandskämpfer, so steht das Schloss für den absolutistischen Sonnenkönig und sein Gefolge, den adeligen Hofstaat. Der König durfte sich in einer kruden Mischung aus Macht, Hofzeremoniell und Architektur als der symbolische Mittelpunkt des Landes fühlen, im säkularisierten Gegensatz zu seinen Vorgängern Ludwig dem Heiligen, der seine Macht aus der Kooperation mit der Kirche bezog und dessen Leichnam konserviert und in Reliquien aufgeteilt wurde, und zu Heinrich IV. von Navarra, dessen frühaufgeklärter religionsphilosophischer Klugheit Heinrich Mann im 20. Jahrhundert ein Denkmal setzte.[1]
Heute ist der umfangreiche Hofstaat durch Heerscharen von Touristen ersetzt worden, und nach dem Gang vom Bahnhof zum Schlosseingang wartet zuerst einmal eine Schlange vor den Sicherheitskontrollen. Die Menge der Gitter und Absperrungen ließ bei meinem Besuch ahnen, wie viele Menschen in der Hauptsaison das Schloss besuchen. Wartezeiten um die zwei Stunden sind dann keine Seltenheit. Im Januar, als ich meinen Rucksack kontrollieren ließ, war es völlig leer. Das Schloss wirkte einsam und verlassen. Im berühmten Spiegelsaal drängten sich keine Touristenmassen.
Im Januar blühte selbstverständlich auch keine einzige Blume im Park, für den kein Ticket nötig ist. Die Brunnenbassins waren geleert, ein Großteil der Statuen winterfest verpackt, und dennoch stand man staunend auf der Terrasse vor der Westseite des Schlosses und blickte hinunter auf die leicht abfallenden regelmäßig angelegten Parkanlagen. Auf den Kanälen trainierten Sportler mit ihren Ruderbooten. Ein ganzer Tag und gute Kondition reichen nicht aus, um sich die Wege und Alleen in dem weitläufigen Gelände zu erschließen. Von den Tuilerien, dem Jardin du Luxembourg und dem Parc des Buttes-Chaumont unterscheidet sich der Park von Versailles darin, dass angenehmerweise kein Spaziergänger durch Verkehrslärm gestört wird. Das Panorama der Landschaft wird nicht durch Hochhäuser begrenzt. Dieses großzügige Gelände musste niemals gegen Stadtplaner mit ihren Verdichtungskonzepten verteidigt werden. Man erinnert sich an all die deutschen Grafen- und Fürstenschlösser, die sich Park, Gärten und Schloss von Versailles zum Vorbild genommen haben: Schwetzingen, Weikersheim, Ludwigsburg und viele andere.
Versailles präsentiert nicht so eine hochgezüchtete und ins Extrem getriebene Gartenarchitektur wie zum Beispiel das Loire-Schloss Villandry[2], das wäre angesichts der Dimensionen des Areals auch überhaupt nicht möglich, aber die Parkanlagen sind auch kein englischer Landschaftsgarten wie Blenheim Palace[3] in der Nähe von Oxford, das der Duke of Marlborough als Belohnung dafür erhielt, dass er den Residenten von Versailles, Ludwig XIV., den Sonnenkönig, in der Schlacht von Höchstädt (im Englischen: Battle of Blenheim) geschlagen hatte. Der Park von Versailles spiegelt beides, menschliche Gestaltung und Planung auf der einen und auf der anderen Seite Zufall und chaotisches Wachstum, wobei besonders in der Nähe des Schlossgebäudes Gestaltung und Planung überwiegen. Ein Garten oder Park ist ein hochsymbolischer Ort, der nicht nur zum Philosophieren und Theologisieren anregt, sondern auch seinerseits auf Philosophie und Theologie als Grundlagen beruht. Nicht umsonst hat der amerikanische Literaturwissenschaftler Robert Harrison[4] sein Buch über Gärten im Untertitel einen „Versuch über das Wesen der Menschen“ genannt. Man muss dafür gar nicht erst das Paradies, den Garten Eden, den Garten Gethsemane und die unzähligen europäischen Klostergärten bemühen.
27. Musée Carnavalet
 Zum einen bestätigt die Metropole Paris die erwähnte These des Historikers Karl Schlögel, dass die Zeit „im Raume zu lesen“ sei.[5] Zum anderen aber geht dem Flaneur, der sich die Geschichte im Raum erschlendert, genau diese chronologische Dimension verloren. Denn im gegenwärtigen Paris lassen sich Entstehung und Chronologie einer Stadt nur mit Mühe dechiffrieren; es braucht dafür das Auge und den Blick eines Experten. Man sieht der Stadt an ihrem gegenwärtigen Zustand nicht mehr richtig an, wie sie geworden ist. Kompensation für dieses Defizit schafft das Museum für Stadtgeschichte, das Musée Carnavalet, angesiedelt in einem Stadtpalais im Marais. In den Räumen sind Stadtmodelle früherer Zeiten, archäologische Funde und Gebrauchsgegenstände vergangener Jahrhunderte zu bewundern.
Zum einen bestätigt die Metropole Paris die erwähnte These des Historikers Karl Schlögel, dass die Zeit „im Raume zu lesen“ sei.[5] Zum anderen aber geht dem Flaneur, der sich die Geschichte im Raum erschlendert, genau diese chronologische Dimension verloren. Denn im gegenwärtigen Paris lassen sich Entstehung und Chronologie einer Stadt nur mit Mühe dechiffrieren; es braucht dafür das Auge und den Blick eines Experten. Man sieht der Stadt an ihrem gegenwärtigen Zustand nicht mehr richtig an, wie sie geworden ist. Kompensation für dieses Defizit schafft das Museum für Stadtgeschichte, das Musée Carnavalet, angesiedelt in einem Stadtpalais im Marais. In den Räumen sind Stadtmodelle früherer Zeiten, archäologische Funde und Gebrauchsgegenstände vergangener Jahrhunderte zu bewundern.
 Vor allem aber sind in einer durch eine schnöde Kette abgesperrten Box die Reste des Mobiliars aus der letzten Wohnung des Schriftstellers Marcel Proust am Boulevard Haussmann ausgestellt: ein Bett, ein Sessel, ein Nacht- und ein Beistelltisch, eine Chaiselongue, ein Spiegel, ein Sekretär, eine Kommode, ein Spazierstock und weniges mehr.[6] Auf das Grab des Schriftstellers auf dem Friedhof Père Lachaise[7] habe ich schon hingewiesen. Seine Möbel und seine Wohnung verdienen Interesse, weil er in ihr sein letztes und größtes Werk, „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“[8], verfasst und überarbeitet hat. Schon der Titel deutet auf eine Auseinandersetzung mit Geschichte und Vergänglichkeit hin. Größere Teile des mehrbändigen Romans spielen im Paris der Jahrhundertwende[9], anderes in der Provinz, im berühmten fiktiven Balbec, das nach dem Vorbild von Cabourg in der Normandie gebildet ist. Zum Schreiben zog sich Proust in eine abgedunkelte und abgedämpfte Wohnung, man erinnere sich an die berühmt gewordenen Korkwände, zurück, um sich, von keiner Störung abgelenkt, auf die Erinnerung an vergangene Zeit, vergangene Geschichten und Personen zu konzentrieren. Erinnerung steht gegen Vergessen, aber neben die zeitliche Dimension tritt auch eine Dimension der ästhetischen Wahrnehmung, die für eine Theologie des Flaneurs von Bedeutung ist.
Vor allem aber sind in einer durch eine schnöde Kette abgesperrten Box die Reste des Mobiliars aus der letzten Wohnung des Schriftstellers Marcel Proust am Boulevard Haussmann ausgestellt: ein Bett, ein Sessel, ein Nacht- und ein Beistelltisch, eine Chaiselongue, ein Spiegel, ein Sekretär, eine Kommode, ein Spazierstock und weniges mehr.[6] Auf das Grab des Schriftstellers auf dem Friedhof Père Lachaise[7] habe ich schon hingewiesen. Seine Möbel und seine Wohnung verdienen Interesse, weil er in ihr sein letztes und größtes Werk, „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“[8], verfasst und überarbeitet hat. Schon der Titel deutet auf eine Auseinandersetzung mit Geschichte und Vergänglichkeit hin. Größere Teile des mehrbändigen Romans spielen im Paris der Jahrhundertwende[9], anderes in der Provinz, im berühmten fiktiven Balbec, das nach dem Vorbild von Cabourg in der Normandie gebildet ist. Zum Schreiben zog sich Proust in eine abgedunkelte und abgedämpfte Wohnung, man erinnere sich an die berühmt gewordenen Korkwände, zurück, um sich, von keiner Störung abgelenkt, auf die Erinnerung an vergangene Zeit, vergangene Geschichten und Personen zu konzentrieren. Erinnerung steht gegen Vergessen, aber neben die zeitliche Dimension tritt auch eine Dimension der ästhetischen Wahrnehmung, die für eine Theologie des Flaneurs von Bedeutung ist.
Wenn etwas die Lektüre von Prousts großem Roman interessant macht, so sind es gar nicht so sehr die großen Linien der Handlung, sondern das Bemühen, die Wahrnehmung über das Alltägliche stark zu schärfen und noch in den kleinsten, sonst übersehenen Details Momente des Bewahrens- und Bedenkenswerten zu erkennen. Eben um diese Details zu erinnern, wollte Proust um keinen Preist gestört oder von Lärm abgelenkt werden. Am Grunde der Welterfahrung und -beschreibung des Autors steht darum keine moralische Theorie von Gut und Böse, sondern eine Philosophie der detaillierten Wahrnehmung. Dinge, Verhältnisse und Menschen wollen nicht zuerst bewertet und verurteilt, sondern in all ihren Differenzierungen wahrgenommen werden. Anders als bei Rilke wird die Wahrnehmung der Welt nicht ausschließlich zum Vehikel, um in das eigene Innere abzutauchen, vielmehr bleibt bei Proust ein Eigenrecht des Anderen, des Objekts, des Nicht-Subjektiven, des Nicht-Individuellen. Proust war kein Theologe, aber diese Konstellation von Wahrnehmung, Erinnerung und Vergessen enthält Elemente, die theologisch zu beerben wären, in der Wahrnehmung vergänglicher, zerbrechlicher Welt, die in der Gefahr steht, vergessen zu werden. Die Welt ist nicht, wie in griechischer Kosmos-Vorstellung eine stabile Ordnung, sondern sie ist ein Ort der Zerstörung, des Vergehens und des Vergessens, deren Details erinnernd bewahrt werden müssen. Das „Buch des Lebens“ (Apk 3,5 u.a.) ist eben nicht nur ein Buch mit Be- und Verurteilungen von Menschen, sondern in ihm sind genauso die Details der seufzenden Kreatur (Röm 8,19) und der Vielfalt der Dinge notiert. In einer anspruchsvolleren Theologie der Schöpfung und Erlösung steht nicht nur die Rechtfertigung der Menschen zur Debatte, sondern die vergessene, schwache, vor allen Dingen detailreiche Schöpfung. Im Anschluss an Prousts Theorie der Wahrnehmung könnte gelten: Erinnerungen sind die Rechtfertigung der Details.
28. Jardin du Luxembourg

Wenn ich mich an den Jardin du Luxembourg[10] erinnere, dann fallen mir nicht Bäume, Spiegelteiche oder Springbrunnen, nicht das Schloss und nicht der Spielplatz, sondern die große Menge von olivgrün angestrichenen Stühlen[11] ein. Wie bei den Tuilerien breitet sich der Park hinter einem Schloss aus, nicht besonders groß und auch nicht von gartenarchitektonischer oder -historischer Besonderheit. Irgendwie gehen Pariser wie Nicht-Pariser stets zur Entspannung in den Jardin du Luxembourg: um die anderen Spaziergänger zu beobachten, um eine Pause zu machen, um in einem Buch zu lesen und sich in der Spätnachmittagssonne zu entspannen. Man muss nur einen Stuhl oder eine Bank finden.
 In einer Szene des Romans „Die Gesandten“ von Henry James kommt die Hauptfigur, der Amerikaner Lambert Sträter in den Park, um sich auszuruhen: „Im Jardin de Luxembourg machte er halt; hier fand er endlich ein lauschiges Plätzchen, und hier, auf einem Mietstuhl, vor dem Terrassen, Alleen, Durchblicke, Fontänen, kleine Bäume in grünen Kübeln, kleine Frauen in hellen Hauben und schrille kleine Mädchen beim Spielen alle zusammen ein sonniges Tableau ‚komponieren‘, hier verbrachte er eine Stunde, in welcher der Becher seiner Impressionen wahrhaft überzufließen schien.“[12] Sträter kommt als in der Wolle gefärbter Amerikaner nach Paris, voller Vorurteile gegenüber dem alten Europa. Schon nach den ersten Tagen beginnt er, an seinem Auftrag zu zweifeln, nämlich den Sohn seiner zukünftigen Ehefrau, einer Witwe, nach Amerika zurückzuholen. Der zukünftige Stiefsohn hat sich in eine adelige, reifere Dame verliebt, was man jenseits des Atlantiks in den sittenstrengeren Neuengland Staaten überhaupt nicht goutierte. Im Jardin du Luxembourg kommt der „Gesandte“ Lambert Sträter zum ersten Mal ins Grübeln, und er ist gerne bereit, die ersten Eindrücke von Paris in die Waagschale zu werfen: „Das größte Unbehagen erwuchs ihm aus dem drohenden Eindruck, seine Autorität aufs Spiel zu setzen, sollte er Paris in irgendeiner Weise akzeptieren. An diesem Morgen präsentierte es sich ihm, das gewaltige, gleißende Babylon, wie ein riesiges irisierendes Etwas, ein Kleinod, glitzernd und hart, an dem sich weder Einzelheiten ausmachen ließen noch Unterschiede bequem aufzeigen. Es flimmerte und vibrierte und verschmolz, und was in einem Moment schiere Oberfläche schien, schien schon im nächsten schiere Tiefe.“[13] Ungeachtet seines (moralischen) Auftrags, der sich mit privaten wie psychologischen Interessen verbindet, kommt der Reisende Sträter ins Nachdenken, und genau darauf zielt James‘ schriftstellerisches Interesse: Er will zeigen, wie amerikanischer Habitus und amerikanische Moral ins Wanken geraten durch die Beobachtungen eines Flaneurs, der sich aus eigensüchtigen Gründen zuerst der Stadt verweigert, ihr dann aber umso mehr erliegt.
In einer Szene des Romans „Die Gesandten“ von Henry James kommt die Hauptfigur, der Amerikaner Lambert Sträter in den Park, um sich auszuruhen: „Im Jardin de Luxembourg machte er halt; hier fand er endlich ein lauschiges Plätzchen, und hier, auf einem Mietstuhl, vor dem Terrassen, Alleen, Durchblicke, Fontänen, kleine Bäume in grünen Kübeln, kleine Frauen in hellen Hauben und schrille kleine Mädchen beim Spielen alle zusammen ein sonniges Tableau ‚komponieren‘, hier verbrachte er eine Stunde, in welcher der Becher seiner Impressionen wahrhaft überzufließen schien.“[12] Sträter kommt als in der Wolle gefärbter Amerikaner nach Paris, voller Vorurteile gegenüber dem alten Europa. Schon nach den ersten Tagen beginnt er, an seinem Auftrag zu zweifeln, nämlich den Sohn seiner zukünftigen Ehefrau, einer Witwe, nach Amerika zurückzuholen. Der zukünftige Stiefsohn hat sich in eine adelige, reifere Dame verliebt, was man jenseits des Atlantiks in den sittenstrengeren Neuengland Staaten überhaupt nicht goutierte. Im Jardin du Luxembourg kommt der „Gesandte“ Lambert Sträter zum ersten Mal ins Grübeln, und er ist gerne bereit, die ersten Eindrücke von Paris in die Waagschale zu werfen: „Das größte Unbehagen erwuchs ihm aus dem drohenden Eindruck, seine Autorität aufs Spiel zu setzen, sollte er Paris in irgendeiner Weise akzeptieren. An diesem Morgen präsentierte es sich ihm, das gewaltige, gleißende Babylon, wie ein riesiges irisierendes Etwas, ein Kleinod, glitzernd und hart, an dem sich weder Einzelheiten ausmachen ließen noch Unterschiede bequem aufzeigen. Es flimmerte und vibrierte und verschmolz, und was in einem Moment schiere Oberfläche schien, schien schon im nächsten schiere Tiefe.“[13] Ungeachtet seines (moralischen) Auftrags, der sich mit privaten wie psychologischen Interessen verbindet, kommt der Reisende Sträter ins Nachdenken, und genau darauf zielt James‘ schriftstellerisches Interesse: Er will zeigen, wie amerikanischer Habitus und amerikanische Moral ins Wanken geraten durch die Beobachtungen eines Flaneurs, der sich aus eigensüchtigen Gründen zuerst der Stadt verweigert, ihr dann aber umso mehr erliegt.
Solche Erfahrungen lassen sich machen, wenn man sich im Jardin du Luxembourg auf eine Bank setzt, sich ausruht und während des Beobachtens der Passanten die Gedanken treiben lässt.
29. Fondation Louis Vuitton
 Der Architekt des nächsten Gebäudes ist wie die Kunstfigur Lambert Sträter ein Amerikaner in Paris: der neunzigjährige Frank O. Gehry. Die Fondation Louis Vuitton liegt ein wenig außerhalb des Zentrums, in Neuilly, am Rande des Bois de Boulogne. Wer sich von der Métro-Haltestelle Les Sablons auf den viertelstündigen Fußweg macht, der hat beim ersten Anblick des Museums den Eindruck, einer vor Anker gegangenen Segelyacht aus der Jahrhundertwende zu begegnen, aber diese dekonstruierte Segelyacht besteht aus vielen Puzzleteilen, die gegeneinander versetzt zusammengestapelt wurden, so als habe ein kleiner Junge ein Bötchen bauen wollen.
Der Architekt des nächsten Gebäudes ist wie die Kunstfigur Lambert Sträter ein Amerikaner in Paris: der neunzigjährige Frank O. Gehry. Die Fondation Louis Vuitton liegt ein wenig außerhalb des Zentrums, in Neuilly, am Rande des Bois de Boulogne. Wer sich von der Métro-Haltestelle Les Sablons auf den viertelstündigen Fußweg macht, der hat beim ersten Anblick des Museums den Eindruck, einer vor Anker gegangenen Segelyacht aus der Jahrhundertwende zu begegnen, aber diese dekonstruierte Segelyacht besteht aus vielen Puzzleteilen, die gegeneinander versetzt zusammengestapelt wurden, so als habe ein kleiner Junge ein Bötchen bauen wollen.
Gebäude zeichnen sich dadurch aus, dass sie geschlossene, überdachte Räume herstellen, Schiff und Chor einer Kirche, einen Konzertsaal, Museumsräume oder schlicht eine Reihe von Wohnungen und Apartments. Das gilt auch für die Fondation Louis Vuitton, aber beim ersten Anblick des verworrenen Stapels von riesigen Segel- und Rumpfelementen hält man das nicht für möglich. Die Wasserkaskaden vor dem Ostende des Gebäudekomplexes verstärken den Eindruck einer Yacht. Wie die Philharmonie de Paris ist die Fondation Louis Vuitton bewusst außerhalb des Pariser Zentrums gebaut worden, das Gebäude steht jenseits des Boulevard Périphérique, es liegt direkt neben einer Art Abenteuerspielplatz vom Anfang des 20.Jahrhunderts, dem Jardin d’Acclimatation, in dem schon Marcel Proust[14] gespielt hat.
 Gehry zählt zu den Hauptvertretern des Dekonstruktivismus, und damit unterläuft er neben dem Bruch mit architektonischen Traditionen und Prinzipien die schlichten pragmatischen Erwartungen eines Nutzers an ein Gebäude: vier Wände, eine Tür, ein Dach. Die Fondation Louis Vuitton ist ein Anti-Gebäude, das radikale Dementi aller ‚normalen‘ Erwartungen an Architektur. Wenn man es mit den schon beschriebenen Museen vergleicht: Die Umnutzung des Bahnhofs am Quai d’Orsay stimmt auf faszinierende Weise mit den impressionistischen Kunstwerken überein, die dort ausgestellt sind. Und den Louvre kann man besuchen, ohne sich groß um die Palastarchitektur zu kümmern. Die Architektur der Fondation ist ein Widerspruch: ein Widerspruch zu ihrer Umgebung, dem Wald und dem Spielplatz, ein Widerspruch zum Pariser Zentrum, in dem sie bewusst nicht ihren Ort fand, ein Widerspruch zu den Konventionen überkommener Architektur (überdachter Raum), schließlich ein Widerspruch der Architektur gegen die Kunst, die dort ausgestellt werden soll. Und zuletzt würde ich sagen: Sie ist ein Zeichen, ein Denk-Mal (im wahren Sinne des Wortes) der selbstwidersprüchlichen Moderne. Darin liegen die Größe und die Wucht des Gebäudes.
Gehry zählt zu den Hauptvertretern des Dekonstruktivismus, und damit unterläuft er neben dem Bruch mit architektonischen Traditionen und Prinzipien die schlichten pragmatischen Erwartungen eines Nutzers an ein Gebäude: vier Wände, eine Tür, ein Dach. Die Fondation Louis Vuitton ist ein Anti-Gebäude, das radikale Dementi aller ‚normalen‘ Erwartungen an Architektur. Wenn man es mit den schon beschriebenen Museen vergleicht: Die Umnutzung des Bahnhofs am Quai d’Orsay stimmt auf faszinierende Weise mit den impressionistischen Kunstwerken überein, die dort ausgestellt sind. Und den Louvre kann man besuchen, ohne sich groß um die Palastarchitektur zu kümmern. Die Architektur der Fondation ist ein Widerspruch: ein Widerspruch zu ihrer Umgebung, dem Wald und dem Spielplatz, ein Widerspruch zum Pariser Zentrum, in dem sie bewusst nicht ihren Ort fand, ein Widerspruch zu den Konventionen überkommener Architektur (überdachter Raum), schließlich ein Widerspruch der Architektur gegen die Kunst, die dort ausgestellt werden soll. Und zuletzt würde ich sagen: Sie ist ein Zeichen, ein Denk-Mal (im wahren Sinne des Wortes) der selbstwidersprüchlichen Moderne. Darin liegen die Größe und die Wucht des Gebäudes.
Wer die Fondation Louis Vuitton zum ersten Mal besucht, der wird gerade zu gezwungen, sich zuerst die Architektur zu widmen und erst dann die ausgestellten Kunstwerke anzuschauen. Wer die gerade konstatierte Größe des Gebäudes akzeptiert, der findet genau darin aber auch eine Kraft, die alles um sie herum verschlingt: die Umgebung, die Kunstwerke, möglicherweise auch die Besucher. Die Architektur ist in keiner Weise zurückgenommen, sie ist selber zu einem der Kunstwerke geworden, für deren Ausstellung und Präsentation das Gebäude eigentlich sorgen soll. Dieses Museum ist kein verwandelter Musentempel mehr, schon gar keine Sammlung oder ein Aufbewahrungsort. Es stellt in seiner dekonstruierten Zerrissenheit selbst schon die Fragen, die zu stellen eigentlich den ausgestellten Kunstwerken vorbehalten sein sollten. An Gehrys Museum kann man lernen, dass zwischen ausgestellten Kunstwerken und umgebender Architektur eine Dialektik besteht. Im günstigen Fall steigert sich beides gegenseitig, im ungünstigen Fall schiebt sich die Architektur bräsig vor die Kunstwerke. Das Museum ist für Wechselausstellungen konzipiert.
 Es ist nicht nötig, nach der Betrachtung von Gebäude und Kunstwerken im Restaurant „Chez Frank“, das nach dem Architekten benannt wurde, einen Aperitif zu nehmen, um über die Widersprüche der Moderne nachzudenken, die der Architekt genial, aber eben ungebremst monumental zur architektonischen Darstellung gebracht hat. Und man muss auch nicht darüber nachdenken, dass es sich bei der Fondation um ein Privatmuseum handelt, gebaut mit den finanziellen Mitteln eines Luxuswarenkonzerns, der Taschen, Seidentücher und Parfums verkauft. Kein Leser muss sich Sorgen machen: Weder habe ich im Restaurant einen Aperitif genossen noch eine der berühmten, überteuerten Taschen gekauft. Aber es lohnt sich, die Frage zu stellen, wie wohl eine dekonstruierte Kirche von Frank O. Gehry aussehen würde. Wenn sie mit dergleichen Wucht daherkäme wie sein Pariser Museum, wie würden dann die Gottesdienste aussehen, die darin gefeiert werden? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Gottesdienste wären, die der Standard-Agende folgen.
Es ist nicht nötig, nach der Betrachtung von Gebäude und Kunstwerken im Restaurant „Chez Frank“, das nach dem Architekten benannt wurde, einen Aperitif zu nehmen, um über die Widersprüche der Moderne nachzudenken, die der Architekt genial, aber eben ungebremst monumental zur architektonischen Darstellung gebracht hat. Und man muss auch nicht darüber nachdenken, dass es sich bei der Fondation um ein Privatmuseum handelt, gebaut mit den finanziellen Mitteln eines Luxuswarenkonzerns, der Taschen, Seidentücher und Parfums verkauft. Kein Leser muss sich Sorgen machen: Weder habe ich im Restaurant einen Aperitif genossen noch eine der berühmten, überteuerten Taschen gekauft. Aber es lohnt sich, die Frage zu stellen, wie wohl eine dekonstruierte Kirche von Frank O. Gehry aussehen würde. Wenn sie mit dergleichen Wucht daherkäme wie sein Pariser Museum, wie würden dann die Gottesdienste aussehen, die darin gefeiert werden? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Gottesdienste wären, die der Standard-Agende folgen.
30. Place des Vosges
 Der Essay neigt sich seinem Ende zu, und es ist Zeit für Konzessionen. Die Auswahl der hier präsentierten Sehenswürdigkeiten verdankt sich subjektiver Entscheidung. Ich wollte keinen dicken Katalog schreiben. Ausgewählt wurde, was ich selbst besucht und gesehen haben. Es fehlt trotzdem unendlich viel: Les Halles, der Parc de la Villette, das Musée Rodin, das Musée Jacquemart-Andrée, das Musée Marmottan Monet, das Hôtel Salé mit dem Musée Picasso, die Orangerie, die Katakomben, ein Kapitel über Pariser Buchhandlungen. Nicht nötig zu sagen, dass auch diese Liste der nicht besuchten Plätze und Gebäude ihrerseits unvollständig ist.
Der Essay neigt sich seinem Ende zu, und es ist Zeit für Konzessionen. Die Auswahl der hier präsentierten Sehenswürdigkeiten verdankt sich subjektiver Entscheidung. Ich wollte keinen dicken Katalog schreiben. Ausgewählt wurde, was ich selbst besucht und gesehen haben. Es fehlt trotzdem unendlich viel: Les Halles, der Parc de la Villette, das Musée Rodin, das Musée Jacquemart-Andrée, das Musée Marmottan Monet, das Hôtel Salé mit dem Musée Picasso, die Orangerie, die Katakomben, ein Kapitel über Pariser Buchhandlungen. Nicht nötig zu sagen, dass auch diese Liste der nicht besuchten Plätze und Gebäude ihrerseits unvollständig ist.
 Es sollte aber nicht fehlen die Place des Vosges im Marais, und zwar am frühen Morgen, bei Sonnenaufgang[15], wenn die Pariser noch nicht zur Arbeit gehen, sondern noch bei Milchkaffee und Croissant sitzen. Ich weiß nicht, was ich faszinierender finde, die Farben der Gebäude rings um den quadratischen Platz, die Regelmäßigkeit der Anlage. Wenn das Licht am Morgen richtig fällt, genügt es, sich einfach auf einer der Bänke zu setzen und zu staunen. Die lange royale Geschichte, die auch dieser Platz repräsentiert, muss man dafür gar nicht unbedingt kennen. Der Platz ist eine Oase mitten in der Stadtwüste.
Es sollte aber nicht fehlen die Place des Vosges im Marais, und zwar am frühen Morgen, bei Sonnenaufgang[15], wenn die Pariser noch nicht zur Arbeit gehen, sondern noch bei Milchkaffee und Croissant sitzen. Ich weiß nicht, was ich faszinierender finde, die Farben der Gebäude rings um den quadratischen Platz, die Regelmäßigkeit der Anlage. Wenn das Licht am Morgen richtig fällt, genügt es, sich einfach auf einer der Bänke zu setzen und zu staunen. Die lange royale Geschichte, die auch dieser Platz repräsentiert, muss man dafür gar nicht unbedingt kennen. Der Platz ist eine Oase mitten in der Stadtwüste.
31. Sacré Cœur
 Was man in Paris von den meisten Plätzen aus sehen kann, sind der Eiffelturm und die weiße Kirche Sacré Coeur auf dem Hügel von Montmartre. Turm wie Basilika eignen sich gut zur Orientierung. Sacré Coeur sieht man zum Beispiel gut durch das berühmte Uhrenfenster in der oberen nördlichen Galerie des Musée d’Orsay oder auch von der oberen Plattform des Centre Pompidou. Sacré Coeur ist also trotz Google Maps selbst dann wichtig, wenn man es gar nicht besucht.
Was man in Paris von den meisten Plätzen aus sehen kann, sind der Eiffelturm und die weiße Kirche Sacré Coeur auf dem Hügel von Montmartre. Turm wie Basilika eignen sich gut zur Orientierung. Sacré Coeur sieht man zum Beispiel gut durch das berühmte Uhrenfenster in der oberen nördlichen Galerie des Musée d’Orsay oder auch von der oberen Plattform des Centre Pompidou. Sacré Coeur ist also trotz Google Maps selbst dann wichtig, wenn man es gar nicht besucht.
Für die Place des Vosges muss man früh da sein, um den Mengen von Touristen zuvorzukommen. Für Sacré Coeur gilt das Umgekehrte: Wer den Hügel im Regen besteigt, wenn die Touristen längst vor der Nässe in die anliegenden Cafés und Brasserien geflohen sind, der erhält einen tristen Eindruck von Hügel und Kirche. Der sieht dann nur noch die Gruppe japanischer Touristen, die sich trotz Regen nicht verdrießen läßt, auf der Treppe unterhalb der Kirche ein Gruppenfoto zu machen. Wenn sich für die Place des Vosges der Sonnenaufgang als Besuchszeit eignet, dann für Sacré Coeur der Sonnenuntergang, nach einem dieser heißen Pariser Tage mitten im Sommer, wenn die Pariser selbst in Urlaub in die Normandie oder Provence gefahren sind. Die Paris-Touristen sitzen dann in lockerer Kleidung auf den Treppen zur Kirche und auch auf den Treppen zum Abgang, einen ökologisch nicht korrekten Plastikbecher mit Cola oder Bier in der Hand und beobachten den Sonnenuntergang über der Stadt. Es herrscht so etwas wie Kirchentagsatmosphäre, freundlich und unbeschwert. Sacré Coeur ist der Ort, den die studentischen Rucksacktouristen aufsuchen. A thousand places to see before you die. Oder wie der Pariser sagt: Mille lieux qu’il faut avoir vus dans sa vie. Zwischen den Sitzenden laufen Getränke- und Souvenirverkäufer auf und ab und bieten neonfarbene kleine Eiffeltürme als Schlüsselanhänger an.
 Die Pariser selbst haben die Basilika nie so richtig gemocht, schon gegen ihren Bau demonstriert, wie es auch Proteste gegen den Eiffelturm gab. Wer das Innere sehen will, muss die obligatorischen Eingangskontrollen über sich ergehen lassen und den „Domschweizer“, der jeden anblafft, der sich einen Fotoapparat umgehängt hat, dass er im Inneren auf keinen Fall fotografieren darf. Um ehrlich zu sein: Das ist auch nicht unbedingt nötig. Zumal die am Eingang ausgehängten Plakate auch eher auf den konservativeren, reaktionäreren Teil des französischen Katholizismus deuten, der in der Basilika offensichtlich eine Bleibe gefunden. Nein, Sacré Coeur ist wichtig als Orientierungspunkt und als Aussichtspunkt für das Stadtpanorama, das im Norden von keinem anderen Ort aus so sehr bewundert werden kann. Es ist ein Ort, um den Abend ausklingen zu lassen; man kommt sofort ins Gespräch, nicht mit Parisern, sondern mit amerikanischen Touristen. Man kann Fünfe gerade sein lassen.
Die Pariser selbst haben die Basilika nie so richtig gemocht, schon gegen ihren Bau demonstriert, wie es auch Proteste gegen den Eiffelturm gab. Wer das Innere sehen will, muss die obligatorischen Eingangskontrollen über sich ergehen lassen und den „Domschweizer“, der jeden anblafft, der sich einen Fotoapparat umgehängt hat, dass er im Inneren auf keinen Fall fotografieren darf. Um ehrlich zu sein: Das ist auch nicht unbedingt nötig. Zumal die am Eingang ausgehängten Plakate auch eher auf den konservativeren, reaktionäreren Teil des französischen Katholizismus deuten, der in der Basilika offensichtlich eine Bleibe gefunden. Nein, Sacré Coeur ist wichtig als Orientierungspunkt und als Aussichtspunkt für das Stadtpanorama, das im Norden von keinem anderen Ort aus so sehr bewundert werden kann. Es ist ein Ort, um den Abend ausklingen zu lassen; man kommt sofort ins Gespräch, nicht mit Parisern, sondern mit amerikanischen Touristen. Man kann Fünfe gerade sein lassen.
Als ich einige Jahre später Marseille besuchte und die Kirche Notre-Dame de la Garde sah, fühlte ich mich an Sacré Coeur erinnert: Marienfrömmigkeit, Bekundungen der Papsttreue, die Lage auf einem Hügel, der Aussichtspunkt. Oben, auf der Plattform vor Sacré Coeur fehlt nur der weite Blick auf das Meer.
32. Musée de Quai Branly
Das Musée de Quai Branly[16] ist nach der Philharmonie und dem Institut du monde arabe das dritte Gebäude des Architekten Jean Nouvel, das hier vorgestellt wird. Das Hauptgebäude mit dem Ausstellungsparcours ist auf Stelzen gebaut; darunter befindet sich ein Garten mit Bänken, die zum Verweilen einladen. Diesen Garten empfinde ich als ein ökologisches Zeichen, gerade wenn man das Museum mit dem pflanzenfreien, mit Platten belegten Platz vergleicht, auf dem die Philharmonie errichtet ist, samt der riesigen betonierten Rampe dort.[17]
Der offizielle Titel des Museums lautet „Musée des arts et civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques“, was man früher ein Museum für Völkerkunde genannt hätte. Es ist der Ort, an dem man lernen kann, dass Paris nicht nur den Franzosen und Europäern gehört. Am Anfang des Museumsrundgangs steht ein riesiger Glaszylinder, wo in einem großen Regalsystem lauter Objekte aufbewahrt werden, die gerade nicht ausgestellt werden. Das Museum stellt zusammen, was Franzosen als Privatiers, als Wissenschaftler oder als koloniale Abgesandte des französischen Staates in allen Teilen der Welt gesammelt haben. Das hat in jüngster Zeit die entsprechenden Debatten um berechtigte Restitution hervorgerufen, die noch lange nicht abgeschlossen ist.
Für den Besucher bleibt das Museum eine wunderbare Schatzkammer aus Alltagsdingen und Kunstgegenständen, die Dutzende von regionalen Welten eröffnet, die alle ohne das Zutun der europäischen, kolonialistischen Moderne eigene Sichtweisen auf Alltag, Leben und Lebenswelt eröffnet haben. Das Museum ist und bleibt, trotz seiner kolonialen Vorgeschichte eine Wunderkammer für Diversität und Unterschiede, für Pluralismus, Dialog und die Selbständigkeit indigener Kultur. An einem kleinen Boot, an einer Maske, einem Teppich oder einem Speer lässt sich ganz anderes ablesen als an einem Ölgemälde, einer Skulptur oder einem kostbaren Altar in einer Kathedrale. Das Musée de Quai Branly ist in besonderer Weise das Museum, in dem ausgestellt wird, was nicht aus Paris kommt und nicht in Europa entstanden ist. Zu der europäischen Moderne, die Paris repräsentiert, gehören die Lebensweltentwürfe, die ohne Zutun dieser Moderne daneben und davor entstanden sind. Man kann sie in diesem Museum betrachten – und findet sich doch als Besucher in der Spannung zwischen Faszination und Kritik des Kolonialismus gefangen, obwohl die Kuratoren des Museums im Gegensatz zu früheren Museumskonzepten alles getan haben, um die Auseinandersetzung mit fremden Kulturen dialogisch zu gestalten und auf einen neuen Weg zu bringen..
33. Centre Pompidou

Gilt das Musée d’Orsay als das Museum für Kunst des 19.Jahrhunderts, so gilt das Centre Pompidou als das Museum für die Kunst der (Pariser) Moderne. Wenn man sich in Erinnerung ruft, wie der italienische Architekt Renzo Piano später am Potsdamer Platz in Berlin gebaut hat, so mag man kaum glauben, dass er in den siebziger Jahren die Planung des Centre Pompidou mit verantwortete. Wenn man in der Eingangshalle sein Ticket erworben hat, gelangt man an der Westmauer des Gebäudes entlang über mehrere Rolltreppen durch Glastunnels auf die oberste Ebene und erkundet das Museum dann von oben nach unten. Vorher wirft man aber von oben einen Blick auf die Dächer von Paris.
 Die Architektengruppe hat Rohre, Rolltreppen, Kabelschächte bewusst nach außen verlegt, um das Innenleben des Gebäudes sichtbar zu machen. Dieser Kunstgriff ist ein Emblem für die Moderne, die sich selbstanalytisch nach außen stülpt, die nichts verbirgt, die ihr eigenes Innere nach außen kehrt. Steht das Musée d’Orsay für eine Auseinandersetzung des Impressionismus mit der Zeit, steht die Fondation Louis Vuitton für eine dekonstruierte, singularisierte (Andreas Reckwitz) Architektur[18], so steht das Centre Pompidou für eine Moderne der Selbsterforschung. Selbsterforschung ist ein ambivalenter Terminus, sie kann einerseits der eigenen Rettung und Heilung, andererseits der Zerstörung und Selbstzerfleischung dienen. Alle drei Museen bilden unterschiedliche Konzepte der Moderne ab, ein temporales, ein analytisches und ein postmodern-beliebiges. Das Centre Pompidou repräsentiert in dieser Phasenabfolge Vernunft, Aufklärung, Technik sowie den radikalen Willen, sich selbst zu verstehen. Dafür sind schon die Rolltreppen am Anfang ein Sinnbild: Sie führen nach oben, gewähren dort einen Überblick. Danach arbeiten sich die Besucher durch die Innenwelt des Museums wieder nach unten, auf den Boden der Tatsachen. Wer das Museum wieder verlässt, für den beginnen Brechts berühmte Mühen der Ebene.
Die Architektengruppe hat Rohre, Rolltreppen, Kabelschächte bewusst nach außen verlegt, um das Innenleben des Gebäudes sichtbar zu machen. Dieser Kunstgriff ist ein Emblem für die Moderne, die sich selbstanalytisch nach außen stülpt, die nichts verbirgt, die ihr eigenes Innere nach außen kehrt. Steht das Musée d’Orsay für eine Auseinandersetzung des Impressionismus mit der Zeit, steht die Fondation Louis Vuitton für eine dekonstruierte, singularisierte (Andreas Reckwitz) Architektur[18], so steht das Centre Pompidou für eine Moderne der Selbsterforschung. Selbsterforschung ist ein ambivalenter Terminus, sie kann einerseits der eigenen Rettung und Heilung, andererseits der Zerstörung und Selbstzerfleischung dienen. Alle drei Museen bilden unterschiedliche Konzepte der Moderne ab, ein temporales, ein analytisches und ein postmodern-beliebiges. Das Centre Pompidou repräsentiert in dieser Phasenabfolge Vernunft, Aufklärung, Technik sowie den radikalen Willen, sich selbst zu verstehen. Dafür sind schon die Rolltreppen am Anfang ein Sinnbild: Sie führen nach oben, gewähren dort einen Überblick. Danach arbeiten sich die Besucher durch die Innenwelt des Museums wieder nach unten, auf den Boden der Tatsachen. Wer das Museum wieder verlässt, für den beginnen Brechts berühmte Mühen der Ebene.
Die Sammlung des Centre Pompidou präsentiert moderne Malerei und Skulpturen des 20. und 21. Jahrhunderts, in einer Dauerausstellung und in verschiedenen Wechselausstellungen. Nach dem Museumsbesuch lohnt die Buchhandlung einen Abstecher.
Mir gefällt die offene, bewusst unästhetische Form der Architektur, über deren Nähe zu einer Fabrik sich bei der Eröffnung des Gebäudes viele Menschen aufgeregt haben. Das Centre Pompidou ist ein Museum, das nicht nur zum Schauen einlädt, sondern auch zum Fragenstellen, zur intellektuellen Auseinandersetzung. Insofern ergänzen Bibliotheken und Forschungsinstitute die Ausstellungsräume des Gebäudes. Im Centre Pompidou kann man eine reflexive Moderne erfahren, welche die intellektuelle Auseinandersetzung nicht scheut. Auch wenn man das für nostalgisch halten mag: In dieser Qualität übertrifft das Centre Pompidou den Narzissmus, welchen die Fondation Louis Vuitton ausstrahlt.
34. Champs Élysées

Wenn man von der Place de la Concorde nach Westen blickt, sieht man die Champs-Élysées in ihrer gesamten Länge. Es fällt auf, wie stark die mehrspurige Straße bis zum Arc de Triomphe ansteigt. Und man unterschätzt leicht die Länge, was man erschöpft bemerkt, wenn man auf dem Bürgersteig an den Boutiquen und Flagship Stores entlang bis zum Triumphbogen flaniert. Erinnert man sich an den Autofahrer-Film von Claude Lelouch[19], so fällt einem auf, wie häufig Ampeln für Autofahrer den Weg blockieren könnten, wenn der Fahrer in Lelouchs Film sie nicht ignorieren würde. Wer als Fußgänger die Champs-Élysées hinauf oder hinunter geht, der muss sich für eine Straßenseite entscheiden. Wer auf der südlichen Seite läuft, bekommt von der rechten Seite nichts mit und umgekehrt. Die Pariser Prachtstraße scheint nicht für Spaziergänger gedacht.
 Regelmäßig taucht die Champs Élysées im Fernsehen auf, bei den Demonstrationen der Gilet Jaunes, der Gelbwesten, bei der Militärparade am Nationalfeiertag, dem 14.Juli und bei der letzten Etappe der Tour de France im Hochsommer, die traditionell über einen Rundkurs vom Arc de Triomphe zum Louvre führt, in mehreren Runden. An der Anzahl der Radprofis, die wütend ihr Rad an den Straßenrand schmeißen, weil sie einen Platten haben, kann man den Straßenzustand der Champs-Élysées ablesen. Selbst der Zuschauer am Fernseher bemerkt, dass an vielen Stellen die Pflastersteine nur notdürftig mit Asphalt überspachtelt worden sind, um die tiefsten Schlaglöcher notdürftig auszubessern. Noch etwas anderes fällt auf. Die Regie bei der Tour de France zeigt regelmäßig genau diesen Fußgängerblick von der Place de la Concorde in den Westen, hinauf zum Arc de Triomphe. Aber beim Blick durch das Objektiv der Fernsehkamera erscheint es so, also würden sich direkt hinter dem Triumphbogen die Hochhäuser von La Défense erheben – eine optische Täuschung.
Regelmäßig taucht die Champs Élysées im Fernsehen auf, bei den Demonstrationen der Gilet Jaunes, der Gelbwesten, bei der Militärparade am Nationalfeiertag, dem 14.Juli und bei der letzten Etappe der Tour de France im Hochsommer, die traditionell über einen Rundkurs vom Arc de Triomphe zum Louvre führt, in mehreren Runden. An der Anzahl der Radprofis, die wütend ihr Rad an den Straßenrand schmeißen, weil sie einen Platten haben, kann man den Straßenzustand der Champs-Élysées ablesen. Selbst der Zuschauer am Fernseher bemerkt, dass an vielen Stellen die Pflastersteine nur notdürftig mit Asphalt überspachtelt worden sind, um die tiefsten Schlaglöcher notdürftig auszubessern. Noch etwas anderes fällt auf. Die Regie bei der Tour de France zeigt regelmäßig genau diesen Fußgängerblick von der Place de la Concorde in den Westen, hinauf zum Arc de Triomphe. Aber beim Blick durch das Objektiv der Fernsehkamera erscheint es so, also würden sich direkt hinter dem Triumphbogen die Hochhäuser von La Défense erheben – eine optische Täuschung.
35. Bibliothèque nationale de France
 Der genaue Titel des Gebäudekomplexes lautet Bibliothèque nationale de France (site Francois Mitterand). Sie liegt seineaufwärts am linken Ufer, schon ein wenig abseits des Zentrums. Über einen Treppensockel erreicht man den Gebäudekomplex, an dessen Ecken für Hochhäuser stehen, die aufgeschlagene Bücher symbolisieren. Die Türme haben eigene Namen: Turm der Zeit, Turm der Gesetze, Turm der Zahlen, Turm der Buchstaben. Der gesamte Gebäudekomplex wirkt monumental, er war bei seinem Bau nicht unumstritten. Das gilt aber auch für andere Pariser Sehenswürdigkeiten wie den Eiffelturm, Sacré Coeur und die Philharmonie.
Der genaue Titel des Gebäudekomplexes lautet Bibliothèque nationale de France (site Francois Mitterand). Sie liegt seineaufwärts am linken Ufer, schon ein wenig abseits des Zentrums. Über einen Treppensockel erreicht man den Gebäudekomplex, an dessen Ecken für Hochhäuser stehen, die aufgeschlagene Bücher symbolisieren. Die Türme haben eigene Namen: Turm der Zeit, Turm der Gesetze, Turm der Zahlen, Turm der Buchstaben. Der gesamte Gebäudekomplex wirkt monumental, er war bei seinem Bau nicht unumstritten. Das gilt aber auch für andere Pariser Sehenswürdigkeiten wie den Eiffelturm, Sacré Coeur und die Philharmonie.
Was mich bei meinem Besuch faszinierte, war der Kiefernwald, der im Innenhof des Gebäudekomplexes gepflanzt wurde, man kann ihnen von oben sehen, für die Öffentlichkeit aber wird er nur einmal im Jahr zugänglich gemacht. Bücher in Paris wären ein eigenes Thema, von den Bouquinisten, die am Seineufer ihre antiquarischen Auslagen anbieten, bis zu diversen Buchhandlungen. Was ich bewundere: Im französischen Fernsehen haben sich eine ganze Reihe von literaturkritischen Sendungen erhalten, die in Deutschland alle schon längst wieder abgeschafft sind oder nur einen Sendplatz am frühen Morgen erhalten.
36. Metropole und Provinz
 Für Pariser kommt der Zeitpunkt, an dem sie ihrer Stadt überdrüssig werden. Wer kann, verlässt die Stadt im Sommer Richtung Normandie, Bretagne oder Provence. Noch tiefer als der jährliche Urlaubswechsel reicht der biographische Wechsel in der Lebenszeit: geboren und aufgewachsen in der Provinz, später in die Metropole gegangen. Exemplarisch hat das schon im 19.Jahrhundert Honoré de Balzac beschrieben.[20] Im 21. Jahrhundert ist die autobiographisch-soziologische Dokumentationsprosa von Didier Eribon[21] zu großem Erfolg gelangt.
Für Pariser kommt der Zeitpunkt, an dem sie ihrer Stadt überdrüssig werden. Wer kann, verlässt die Stadt im Sommer Richtung Normandie, Bretagne oder Provence. Noch tiefer als der jährliche Urlaubswechsel reicht der biographische Wechsel in der Lebenszeit: geboren und aufgewachsen in der Provinz, später in die Metropole gegangen. Exemplarisch hat das schon im 19.Jahrhundert Honoré de Balzac beschrieben.[20] Im 21. Jahrhundert ist die autobiographisch-soziologische Dokumentationsprosa von Didier Eribon[21] zu großem Erfolg gelangt.
Eribon fragt nach den sozialen Gründen für das Erstarken der rechten Populisten in Frankreich, und er kommt unweigerlich auf den Gegensatz zwischen Provinz und Metropole, den er festmacht an seiner Herkunft aus dem Arbeitermilieu und dem Wechsel nach dem Studium in das akademische Milieu. Für die Herkunft steht Reims, für die spätere Entwicklung das akademische Milieu der Universität. Nach der Ausbildung erhält er Gelegenheit zur Arbeit als Journalist, er tritt als öffentlicher Intellektueller in Podiumsdiskussionen auf. Eribon spürt, dass seine akademisch-soziale Ausbildung ihn beiden Sphären, der Provinz wie der Metropole entfremdet. Für das Herkunftsmilieu gilt, dass sein Vater nie die Homosexualität seines Sohnes akzeptieren konnte. Für das intellektuelle und akademische Zielmilieu gilt, dass Eribon nie das Misstrauen ablegen konnte, in diesem Milieu nicht vollständig akzeptiert zu sein. Er bleibt hängen zwischen Baum und Borke. Die sozialen Entwurzelungsprozesse wenden sich gegen denjenigen, der zwar von ihnen profitiert hat und dennoch darunter leidet. Eribons autobiographische Milieutheorie knüpft an seinem Lehrer Pierre Bourdieu an, und darin ähnelt er von ferne der in Deutschland gerade gefeierten Annie Ernaux[22], die allerdings die Literarisierung der Milieutheorie sehr viel weiter treibt als der Soziologe und Journalist Eribon.
Je nachdem, ob man den Gegensatz zwischen Provinz und Metropole auf Jugend und Schule sowie Studium und berufliche Karriere oder auf Urlaub und Alltag bezieht, kommt man zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Für den – standesgemäßen – Urlaub an der Côte d’Azur hat Francoise Sagan[23] im Jahr 1954 im Roman „Bonjour Tristesse“ die Geschichte der jungen Cécile erzählt, die mit ihrem Vater den Sommer in einer Strandvilla verbringt, sich in diesen und jenen jungen Mann verliebt und schließlich, vor ihrer Rückkehr nach Paris, das Schule, Studium, Ausbildung, jedenfalls Disziplin, frühes Aufstehen und einen regelmäßigen Tagesablauf bedeuten würde, bei einem Verkehrsunfall ums Leben kommt, bei dem der Leser nicht richtig weiß, ob es sich um ein Unglück oder einen planmäßig herbeigeführten Selbstmord handelte. Sagans Roman, von einer kaum Zwanzigjährigen geschrieben, überzeugt durch eine unerreichte Mischung aus Leichtigkeit und Melancholie, die über sechzig Jahre später nichts von ihrer Faszination verloren hat.
Die Metropole, die nichts als Hektik, Arbeit, Überforderung und Stress bereithält, braucht ihr Gegengewicht in der Abgeschiedenheit der Provinz, auch wenn sich das für die Küstenstädte der Côte d’Azur nun wahrhaftig nicht mehr sagen lässt. An den Orten des overtourism wird kein Mensch mehr die Klausen des Ateliers oder des Arbeitszimmers beziehen.
Französische Kultur erlag schon immer der Gefahr, in der Fixierung auf die Metropole die Bedeutung der anderen Großstädte wie Nancy[24], Strasbourg[25], Marseille[26] oder Aix-en-Provence[27] zu vernachlässigen. Diejenige Provinz, wo weder Pariser noch andere Franzosen Urlaub machen und wo keine großen Städte als Regionalzentren Anziehungskraft ausüben, versinkt im finanziellen Chaos und in der Einsamkeit verlassener, baufälliger Dörfer.[28]
 Die Verbindung zwischen Metropole und Provinz leistet die Autobahn, in Paris der schon mehrfach erwähnte Boulevard périphérique, der die Arrondissements von den Banlieues trennt. In seinen kreisrunden Verlauf münden die Autoroutes, die Metropole und Provinzen miteinander verbinden. Die Autoroutes führen in alle vier Himmelsrichtungen, am bekanntesten die Autoroute du soleil, welche allerdings nur zwischen Lyon und Marseille so heißt und die Pariser in den Sommermonaten Juli und August in die Provence und an die Côte d’Azur bringt. Die Raststätten auf dem Weg in den Süden hat eindrucksvoll der Schriftsteller Julio Cortázar beschrieben.[29]
Die Verbindung zwischen Metropole und Provinz leistet die Autobahn, in Paris der schon mehrfach erwähnte Boulevard périphérique, der die Arrondissements von den Banlieues trennt. In seinen kreisrunden Verlauf münden die Autoroutes, die Metropole und Provinzen miteinander verbinden. Die Autoroutes führen in alle vier Himmelsrichtungen, am bekanntesten die Autoroute du soleil, welche allerdings nur zwischen Lyon und Marseille so heißt und die Pariser in den Sommermonaten Juli und August in die Provence und an die Côte d’Azur bringt. Die Raststätten auf dem Weg in den Süden hat eindrucksvoll der Schriftsteller Julio Cortázar beschrieben.[29]
37. Brasserie
 Reisen besteht nicht nur aus Schlendern und Spazierengehen. Wer reist, der muss auch irgendwo übernachten, essen und trinken. Für das Essen in Paris gilt, dass auch dort die Kultur des Snacks Einzug gehalten hat. Aber überall finden sich noch, sehr viel häufiger als in deutschen Städten, kleine Restaurants, Cafés und Brasserien, in denen man nicht nur mittags schnell Steak/Frites zu sich nehmen oder am Vorabend einen Apéritif trinken kann. Die Brasserien sind auch so etwas wie Aufenthaltsorte zwischen Öffentlichkeit und Privatheit geworden. Man kann sich dort mit Freunden treffen, sich hinsetzen zum Zeitunglesen, man kann sich dorthin vor einem Regenschauer flüchten – und nebenbei französische Getränke- und Esskultur zelebrieren, die schon Roland Barthes in den fünfziger Jahren zu den Mythen des Alltags[30] zählte, vor allem das Glas Rotwein und das nur kurz gebratene, blutige Steak (saignant).[31] Der Soziologe Marc Augé hat in einem schönen kleinen Büchlein[32] über Brasserien als dritten Ort zwischen Wohnung und Arbeit nachgedacht. Er achtet auf diejenigen, die auf dem Weg zur Arbeit in ihrem Stamm-Bistro noch schnell einen petit café trinken und auf dem Rückweg von ihr ein Glas Blanc nehmen. Über die Jahre hinweg bauen sie dort eine Art Freundeskreis aus Stammgästen auf, aber eben keinen engen und geschlossenen Stammtischrunden, sondern unverbindliche volatile Gruppen über die Milieugrenzen hinweg. Bistros und Brasserien werden nicht nur durch Stammgäste geprägt, sie stehen gelegentlichen Besuchern, also Reisenden, Flaneuren, Tagesgästen genauso offen gegenüber. Das macht ihren großen Vorzug aus.
Reisen besteht nicht nur aus Schlendern und Spazierengehen. Wer reist, der muss auch irgendwo übernachten, essen und trinken. Für das Essen in Paris gilt, dass auch dort die Kultur des Snacks Einzug gehalten hat. Aber überall finden sich noch, sehr viel häufiger als in deutschen Städten, kleine Restaurants, Cafés und Brasserien, in denen man nicht nur mittags schnell Steak/Frites zu sich nehmen oder am Vorabend einen Apéritif trinken kann. Die Brasserien sind auch so etwas wie Aufenthaltsorte zwischen Öffentlichkeit und Privatheit geworden. Man kann sich dort mit Freunden treffen, sich hinsetzen zum Zeitunglesen, man kann sich dorthin vor einem Regenschauer flüchten – und nebenbei französische Getränke- und Esskultur zelebrieren, die schon Roland Barthes in den fünfziger Jahren zu den Mythen des Alltags[30] zählte, vor allem das Glas Rotwein und das nur kurz gebratene, blutige Steak (saignant).[31] Der Soziologe Marc Augé hat in einem schönen kleinen Büchlein[32] über Brasserien als dritten Ort zwischen Wohnung und Arbeit nachgedacht. Er achtet auf diejenigen, die auf dem Weg zur Arbeit in ihrem Stamm-Bistro noch schnell einen petit café trinken und auf dem Rückweg von ihr ein Glas Blanc nehmen. Über die Jahre hinweg bauen sie dort eine Art Freundeskreis aus Stammgästen auf, aber eben keinen engen und geschlossenen Stammtischrunden, sondern unverbindliche volatile Gruppen über die Milieugrenzen hinweg. Bistros und Brasserien werden nicht nur durch Stammgäste geprägt, sie stehen gelegentlichen Besuchern, also Reisenden, Flaneuren, Tagesgästen genauso offen gegenüber. Das macht ihren großen Vorzug aus.

Wenn ich Paris besuche, führt mein Weg für das Abendessen stets einmal in ein Bistro/Weinhandlung in der Nähe der Gare de l’Est. Sie hat den Namen „Chez Marius“[33], und dort toleriert der junge Besitzer, der nach meinen Weinwünschen fragt, selbst mein schlechtes Französisch.
38. Paris in Deutschland
Dieser Essay nähert sich seinem Ende, und das führt zu der Frage nach anderen Flaneuren und Reisenden, die Paris wahrgenommen haben. Entsprechende Kunstwerke und Dokumente sind versammelt in vier Ausstellungen, die innerhalb der letzten beiden Jahre in Süddeutschland eröffnet wurden:
- „Die Erfindung von Paris“ – Deutsches Literaturarchiv Marbach, 13.6.2018-31.3.2019
- „Paris, Paris! Karlsruher Künstler an der Seine 1850-1930“ – Städtische Galerie Karlsruhe, 23.2.-2.6.2019
- „Von Henri Matisse bis Louise Bourgeois. Das Musée d’Art moderne de la Ville de Paris zu Gast in der Kunsthalle Würth, Schwäbisch Hall“ – Kunsthalle Würth, Schwäbisch Hall, 15.4.-15.9.2019
- „Ensemble. Centre Pompidou – Museum Frieder Burda” – Museum Frieder Burda, Baden-Baden, 6.4.-29.9.2019

Unabhängig davon, ob es sich bei dieser Häufung von Ausstellungen in Süddeutschland um Zufall handelt oder nicht, das Faktum zeigt den neuen, anderen und vor allem nachhaltigen Blick, der fernab von der bundesdeutschen Hauptstadt auf die sehr viel nähere französische Metropole geworfen wird. Anders wären die Kuratoren der vier Ausstellungen nicht auf die Idee gekommen, in ihren Häusern fast gleichzeitig Ausstellungen mit Pariser Themen zu präsentieren. Dabei verfolgen die Ausstellungen durchaus unterschiedliche Ziele. In Karlsruhe wurde junge bildende Künstler gezeigt, die nach Paris gegangen waren, um dort Malerei zu studieren oder um in einer fremden Stadt neue Ideen zu sammeln. Die Baden-Badener Ausstellung dokumentiert die Kooperation eines deutschen und eines französischen Museums und zeigt daneben deutsche Künstler, die in Paris oder in Frankreich gearbeitet haben. Die umstrittenen Arbeiten des deutschen Anselm Kiefer, der schon lange in Frankreich, in Barjac in den Cevennen lebt. Dessen Bilder und Skulpturen wurden in Frankreich stets höher eingeschätzt als in Deutschland. Die Ausstellung in Schwäbisch Hall präsentiert die Bilder eines Pariser Museums in Deutschland.
Am interessantesten aber erscheint die Marbacher Ausstellung, weil sie, beginnend mit Heinrich Heine, die Werke, Tagebücher und Fotografien von deutschen Schriftstellern und Künstlern zeigt, die für kürzere oder längere Zeit in Paris gelebt haben. An ihnen allen zeigt sich, wie die Erfahrung einer Großstadt literarische oder fotografische Praxis verändert und zu sehr unterschiedlichen Resultaten führt. Jeder dieser Künstler schafft oder erfindet sich sein eigenes Paris.[34] Die Ausstellungen zeigen allerdings auch, dass die Erfahrung der Metropole auch ihr Gegenteil braucht, die Erfahrung des Anderen, der Provinz, des anderen Sprach- und Kulturraums, so ähnlich sich Deutschland und Frankreich sein mögen.
39. Raum und Komplexität
In den vergangenen Kapiteln habe ich versucht, den Akzent auf die räumliche Durchdringung der Stadt zu legen und religiöse und geographische Erfahrung im Anschluss an die Anregungen von Karl Schlögel[35] miteinander zu kombinieren, da dieser theologische Aspekt in seinem Buch leider fehlt. Schaut man sich die besuchten Orte an, so ergeben sich unterschiedliche Netzwerke, die nach Themen geordnet werden können:
Museen:
Louvre (9) – Musée d‘Orsay (13) – Musée de Quai Branly (32) – Palais de Tokyo (21) – Centre Pompidou (33) – und viele andere Museen.
Religion:
Notre Dame (4) – Sacré-Cœur (31) – Saint-Germain-des-Près (19) – Saint-Denis (8) – Sainte-Chapelle (7) - der Friedhof Père Lachaise (16) – und viele andere Kirchen und Friedhöfe.
Parks:
Tuilerien (10) – Parc des Buttes-Chaumont (14) – Jardin du Luxembourg (28) – Versailles (26) – und viele andere Parks und Grünflächen
Konzert/Oper:
Théâtre des Champs Elysees (12) – Philharmonie de Paris (15) – und die beiden Opern sowie viele andere Theater und Konzertsäle.
Laïcité und Zivilreligion:
Panthéon (23) – Galeries Lafayette (24) – und viele andere Institutionen.
In diesem Versuch, Zusammenhänge und Verbindungen wahrzunehmen, repräsentieren sich zum einen meine Vorlieben, zum anderen die Suche nach einer theologischen Dimension der Stadtbetrachtung. Die Netzwerke könnten auch nach ganz anderen Themen geordnet sein und ganz andere Orte und Nicht-Orte in Paris mit einschließen. Stierle hatte die Komplexität der städtischen Raumerfahrung von Paris in die faszinierende Formel der Übermacht des Abwesenden gekleidet. Aus der Unübersichtlichkeit von Institutionen, Gebäuden und Denkmälern, die kein Stadtplan richtig ordnen kann und aus der Überfülle von Zeichen und Zeichenverbindungen lassen sich ganz unterschiedliche Versuchsanordnungen geographischer wie kultureller Natur bilden, die dem Flaneur, der seine Spaziergänge nicht auf Systematik, Ordnung und Disziplin, sondern auf zufällige Begegnung und Entdeckung ausrichtet, stets eigene Konstellationen vermittelt, die jeweils ihre besondere Aufschlusskraft besitzen.

Paris als Stadt stellt sich somit als Laboratorium zur Erfahrung von Komplexität dar. Der Flaneur stellt sich gehend und schlendernd der Erfahrung unübersichtlicher Wirklichkeit und macht in ihr seine eigenen Erfahrungen. Gerade in einer Stadt wie in Paris stellt sich in besonderer Schärfe die Frage nach der Präsenz von Religion. In der urbanen Komplexität droht das Religiöse unterzugehen. Der Brand von Notre Dame im Frühjahr 2019 hat auch den Franzosen deutlich gemacht, was hier an kultureller Substanz verloren gegangen ist und noch droht, verloren zu gehen. Im Gewirr von Erinnerungsorten (lieux de mémoire) und Nicht-Orten wie Metrostationen, Einkaufszentren, Bahnhöfen und Abflughallen droht die religiöse Dimension zu verschwinden. Das vormoderne Modell platziert die Kirche im Zentrum der Stadt und etablierte so ein Modell der hierarchischen Vorordnung des Religiösen. Mit der Moderne ist die These fragwürdig geworden, dass das Religiöse auf den Innenraum der Kirche, auf die lichtdurchflutete Symbolik der Präsenz Gottes, auf die Feier des Abendmahls und auf die Worte der Predigt begrenzt werden kann.
Dem Protestantismus ist der Gedanke einer örtlichen Präsenz des Heiligen stets fremd gewesen. Zum Raum fand er aus diesem Grund nur ein stets widersprüchliches Verhältnis. Aber ein Ort ohne (sichtbare) Religion ist leider auch ein Ort, an dem Religion vergessen wird. Das Ineinander aus nichtreligiöser Kultur, französischer laizistischer Zivilreligion und den Resten traditioneller christlicher Religionskultur präsentiert darum in Paris auch eine Frage an die Theologie, vielleicht im Sinne von Paul Tillichs Korrelationstheorie von Fragen und Antworten. Die Spuren dafür wurden in den vergangenen Kapiteln abgesucht.
Die protestantische Raumfrage ist im Übrigen auch in dieser Zeitschrift schon gestellt worden.[36] Und Andreas Mertin verwies im Anschluss an Friedhelm Mennekes auf das Stichwort der „Sakralität der Leere“[37], wobei er selbst einräumt, dass sich eine solche spatio-theologische Perspektive durch zu häufigen Gebrauch auch abnutzen kann. Die Pariser Erfahrungen zeigen: Ohne ein räumliches Symbol, nein, ohne irgendeine architektonische ‚Gestalt‘ kann Glaube nicht überleben. Die reformierte Perspektive kann – so würde ich nach meinen Pariser Spaziergangserfahrungen sagen – nicht die einzige bleiben.
40. Rückkehr in die deutsche Provinz
 In Ordnung, lassen wir’s dabei. Irgendwann endet jede Reise, und der Pariser Spaziergänger tritt den Heimweg an. Er packt seinen Koffer, bezahlt das Hotel und steigt an der Gare de l’Est wieder in den TGV. Die Rückkehr in die badische Provinz steht an. Müde geworden vom vielen Gehen und Sehen, bleiben zwei kleine Bemerkungen.
In Ordnung, lassen wir’s dabei. Irgendwann endet jede Reise, und der Pariser Spaziergänger tritt den Heimweg an. Er packt seinen Koffer, bezahlt das Hotel und steigt an der Gare de l’Est wieder in den TGV. Die Rückkehr in die badische Provinz steht an. Müde geworden vom vielen Gehen und Sehen, bleiben zwei kleine Bemerkungen.
Wieso trägt dieser Essay den Titel „Paname“? Der triviale Mythos von Paris geht im Klischee von der „Stadt der Liebe“ nicht auf. Ihn pflegen die asiatischen Paare, die sich in Hochzeitskleidern vor dem Eiffelturm oder in den Tuilerien von professionellen Fotografen ablichten lassen. Paname deutet auf ein Paris, das sich nicht auf den ersten Blick zeigt. Er verweist auf die Stadt Paris als Mythos, als Zeichen- und Symbolwelt (Stierle), die neben und unter der Oberfläche der Sehenswürdigkeiten entdeckt werden muss. Paname symbolisiert das fremde, das sperrige, das nicht auf den ersten Blick sichtbare Paris.
 Das am Anfang beschriebene Video mit der automobilen Paris-Raserei des Regisseurs Claude Lelouch von der Porte Dauphine bis Sacré-Coeur soll mittlerweile auch modern überboten werden. Ein zweites Video[38] zeigt einen E-Scooter-Fahrer auf einer Pariser Stadtautobahn. Der Taxifahrer, der das Video beim Fahren gedreht hat, schwenkt beim Überholvorgang auf den Tachometer. Es wird deutlich, dass der Rollermotor aufgemotzt ist. Der Fahrer ist ohne Helm mit einer Geschwindigkeit von über 80 Stundenkilometern unterwegs.
Das am Anfang beschriebene Video mit der automobilen Paris-Raserei des Regisseurs Claude Lelouch von der Porte Dauphine bis Sacré-Coeur soll mittlerweile auch modern überboten werden. Ein zweites Video[38] zeigt einen E-Scooter-Fahrer auf einer Pariser Stadtautobahn. Der Taxifahrer, der das Video beim Fahren gedreht hat, schwenkt beim Überholvorgang auf den Tachometer. Es wird deutlich, dass der Rollermotor aufgemotzt ist. Der Fahrer ist ohne Helm mit einer Geschwindigkeit von über 80 Stundenkilometern unterwegs.
Im Gegensatz zum Kurzfilm Lelouchs vermag diese Raserei überhaupt nicht mehr zu faszinieren. Hier werden doch Unterschiede deutlich zwischen den Siebzigern des letzten und den Zehnerjahren des neuen Jahrhunderts. Wirkte das Video von Lelouch noch waghalsig und konnte als Ausdruck eines gewissen riskanten Lebensüberschwangs gelten (den man nicht unbedingt teilen muss, um ihn faszinierend zu finden), so wirkt das Video mit dem E-Scooter-Fahrer einfach nur dumm, überzogen und belanglos.
Ganz ehrlich, mir wäre es schon zu riskant gewesen, wie der Regisseur Lelouch im Mercedes Cabrio mit 120 km/h und mehr die roten Ampeln der Champs Elysées zu überfahren. Aber ich im empfinde große Freude dabei, nicht in Paris, sondern im TGV nach Paris 300 km/h zu erreichen. Leider erreicht der TGV diese Spitzengeschwindigkeit genauso bei der Rückfahrt.
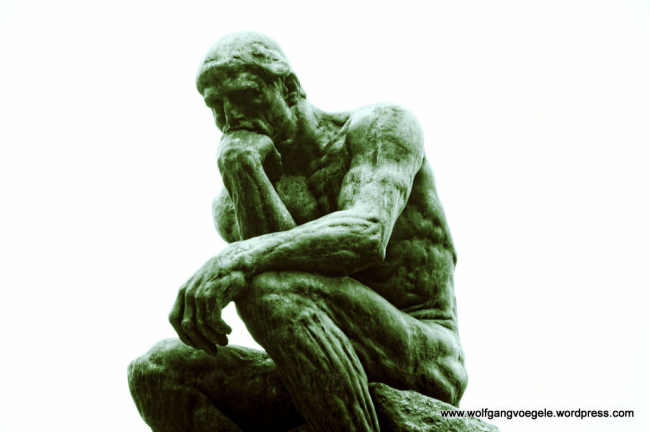
Anmerkungen
[Anmerkung der Redaktion: Wir haben uns entschieden, die Querverweise auf die vorherigen Teile im Anmerkungstext unverändert stehen zu lassen. Wer sie konzentriert nachlesen will, dem empfehlen wir den Download des PDF-Textes des Manuskripts: Gesamter Text]
[4] Robert Harrison, Gärten. Versuch über das Wesen der Menschen, München 2010 (französ. 2007).
[8] Marcel Proust, Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, dt. von Eva Rechel-Mertens, Frankfurt/M. 1979 (französ. 1913ff.).
[9] Reiner Moritz, Mit Proust durch Paris. Literarische Spaziergänge, Frankfurt/M. 2004.
[12] Henry James, Die Gesandten, München 2015, 78f..
[18] S.o. Kapitel 13 und 29.
[20] Zum Beispiel Honoré de Balzac, Verlorene Illusionen (frz. 1843), München 2014.
[21] Didier Eribon, Rückkehr nach Reims, Berlin 2016.
[23] Francoise Sagan, Bonjour Tristesse, Berlin 2017 (frz. 1954).
[29] Julio Cortázar, Carol Dunlop, Die Kosmonauten auf der Autobahn, Berlin 2014 (frz. 1983).
[30] Roland Barthes, Mythen des Alltags, Berlin 2010 (frz. 1957).
[31] Zum theologischen Zusammenhang Vögele, Brot und Wein, a.a.O., Anm. 26..
[32] Marc Augé, Das Pariser Bistro. Eine Liebeserklärung, Berlin 2016 (frz. 2015).
[34] Susanna Brogi, Ellen Strittmatter (Hg.), Die Erfindung von Paris, marbacherkatalog 71, Marbach 2018
[35] Schlögel, a.a.O., Anm. 11.
[36] Vgl. zum Beispiel aus reformierter Perspektive Andreas Mertin, Die Geste des weißen Raumes. White Cube – oder gibt es eine Szenografie reformierten Glaubens?, tà katoptrizómena, H.83, 2013, https://theomag.de/83/am439.htm.

