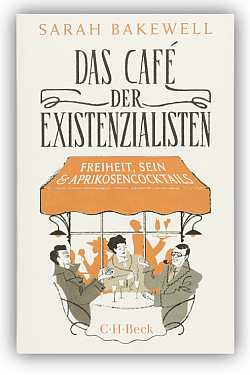Paris |
Das Sein und der KlatschEine Rezension zu Agnès Poirier
Damit ist sie nicht die erste, die sich daran macht, die komplizierten Verhältnisse zwischen Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir, Albert Camus, Maurice Merleau Ponty, Arthur Koestler und Nelson Algren darzustellen. Sartre und Beauvoir haben selbst über die Kriegs- und Nachkriegsjahre geschrieben, Beauvoir hat neben autobiographischen Schlüsselromanen[1] ihre große feministische Studie „Das andere Geschlecht“[2] publiziert, die ursprünglich im Jahr 1949 erschien, also in dem Zeitraum, den Poirier mit ihrem Buch abdeckt. Beauvoirs autobiographische Romane decken dieselbe Zeit und dieselben Personen ab wie Poirier.
Am Anfang des Buches ist aufgelistet, was man eigentlich erst am Ende vermuten würde: eine Chronologie der Ereignisse, ein alphabetisches Verzeichnis der beteiligten Personen und ein Stadtplan von Paris. Wer sich so orientiert hat, kann sich auf das Leseabenteuer an der rive gauche, zwischen Quartier Latin und Saint-Germain-de-Près einlassen. All die Orte, die Poirer historisch beschreibt, lassen sich noch heute besichtigen, auch wenn die Intellektuellen-Cafés um die alte Abteikirche herum zu Touristen Hotspots verkommen sind. Am Anfang von Poiriers Geschichte steht die deutsche Besetzung der französischen Metropole, der Kampf der Résistance gegen die Besatzer, die Gesprächsrunden der misstrauischen Intellektuellen mit dem frankophilen deutschen Offizier Ernst Jünger, Hitlers fehlgeschlagener Versuch, die Stadt vor seiner endgültigen Niederlage kaputtbombardieren zu lassen. Die Autorin erzählt von Untergrundzeitungen und Buchpublikationen, die wohlmeinenden Zensoren und allgemeiner Papierknappheit abgetrotzt wurden.
Nach dem Krieg folgt die „purification“ des Landes und der Stadt von den Kollaborateuren, in ersten Auseinandersetzungen zwischen strengen Kommunisten und versöhnlicheren Existentialisten. In den Mittelpunkt von Poiriers Aufmerksamkeit rückt schnell die offene Arbeits- und Lebensgemeinschaft zwischen Jean Paul Sartre und Simone de Beauvoir. Auch wenn man deren Alltagsleben zwischen Café und Hotelzimmer aus anderen Publikationen schon kennt, so gelingt Poirier doch ein lebendiges Portrait des Paares samt vieler Freunde und Kollegen aus ihrer Entourage. Besonderes Augenmerk erfahren die englischsprachigen Anhänger des Sartre Kreises Arthur Koestler, Samuel Beckett und Saul Bellow. Die letzten beiden folgten dem Schriftstellerpaar eher aus der Distanz. Aber auch Boris Vian und Albert Camus rücken in den Fokus der Aufmerksamkeit. Sichtbar werden Diskussionen in Verlagshinterzimmern und Cafébesuche, journalistische Reisen in die USA und nach Lateinamerika, Alkohol- und Tabletten-Missbrauch, offene und heimliche Affären, eine Vorliebe für den Jazz schwarzer Amerikaner, die, egal ob Musiker oder Schriftsteller, im liberaleren Paris offener und freier Leben konnten als im segregierten Amerika, in dem der Bürgerrechtler Martin Luther King erst ein paar Jahre später mit seinem Kampf für Gleichheit beginnen sollte. Die französische Liberalität spürten Schriftsteller wie Richard Wright und James Baldwin. Aber auch weiße Amerikaner wie Norman Mailer und die ehemaligen Gis, die mit Hilfe von Förderprogrammen in Paris studieren konnten, schätzten die freiere Debattenkultur, eine Gegenerfahrung zur Enge des McCarthy-Milieus. Sartre und Beauvoir lebten in Hotelzimmern statt in Wohnungen, sie pflegten eine offene, vermeintlich eifersuchtsfreie Beziehung und gaben sich gegenseitig ihre Manuskripte vor dem Druck zu lesen. Poirier porträtiert sie als gleichwertig und verschweigt nicht Konflikte, Kränkungen und Demütigungen. Sartre und Beauvoir sind die Fixsterne, um die andere Planeten kreisten. Samuel Beckett gehörte in den Kriegsjahren zu denen, die auf einem Bauernhof in der Provinz überlebten. Zurück in Paris, hielt er sich im Hintergrund, weil der Erfolg als Schriftsteller auf sich warten ließ. Poirier zeigt sehr klar, wie Politik immer wieder hineinschlug in intellektuelle Debatten: die Frage nach einem französischen Sonderweg des Kommunismus, nach der Bewertung der stalinistischen Diktatur und der amerikanischen Rassentrennung. Zur Debatte stand auch der Neuaufbau der Französischen Republik nach der Besatzung. Es ist erschütternd zu lesen, wie Poirier den General de Gaulle beschreibt, wie er nach der Befreiung von Paris in einem Bahnhof eine Gruppe von befreiten Häftlingen aus deutschen Konzentrationslagern begrüßt. Dem gegenüber stehen Anekdoten über eine Tochter aus gutem Hause, Brigitte Bardot, die zuerst Ballerina und keineswegs Filmstar werden wollte. Der jugendliche Francois Truffaut besuchte regelmäßig ein Bordell und erkrankte an Syphilis. Nachdem er erfolgreich behandelt worden war, wandte er sich der Filmregie zu. Poirier reiht parataktisch Geschichte an Geschichte, Anekdote an Anekdote. Weniger interessiert sie sich für die Ursachen von politischen, philosophischen und kulturellen Entwicklungen. Das kann man als Defizit nehmen, man kann es aber auch als weisen Verzicht sehen, der dem Zufall denjenigen Raum lässt, den er auch in der historischen Wirklichkeit einnimmt. Am Ende des Berichtszeitraums, um das Jahr 1950 schimmert schon etwas von den europäischen Ideen auf, die dann zu einer europäischen Union mit einer deutsch-französischen Achse im Fundament führen sollte. Daran werden auch viele von den Unterschieden sichtbar, welche die vierziger und fünfziger Jahre von der Gegenwart trennen: Chaos, Ideenreichtum, Aktivität und Enthusiasmus stehen gegen Erschöpfung, Erstarrung und Resignation, politisch wie intellektuell. Poirier schreibt über den Existenzialismus der Nachkriegszeit:
Poirier gelingt es sehr gut, die Wirbel zu beschreiben, welche die Existentialisten und ihre Gegner im Paris der Nachkriegszeit ausgelöst haben. Und sie verschweigt nicht, dass in diesen Wirbeln einiges an persönlicher Betroffenheit, an individuellen Krisen und schlicht an heißer Luft enthalten war. Man hat Poirier eine kitschige Darstellung der Pariser Nachkriegsgeschichte vorgeworfen, aber der Vorwurf geht in die Irre. Ihr gelingt es, die besondere Pariser Atmosphäre der Nachkriegsjahre zu beschreiben. Poirier fasst das in den Worten James Salters zusammen. Im Vordergrund stehe „eine Rangordnung der Dinge, wie man sie wertschätzt“[5]. In dieser Rangordnung verknüpften sich Alltag und intellektuelle Anstrengung, Politik und Publikation. Paris war für diese Intellektuellen alles zugleich: Politik und Philosophie, Alltagskultur, Lebensstil und eine Art Wertehierarchie. Genau diesen Stil zu beschreiben, hat sich die Autorin vorgenommen, und daraus ein entsteht ein plastisches, aber selbstverständlich kein vollständiges Bild der Pariser Verhältnisse in den vierziger Jahren. Anmerkungen[1] Zum Beispiel Simone de Beauvoir, Die Mandarins von Paris, Reinbek 1965 (französ. Paris 1954). [2] Simone de Beauvoir, Das andere Geschlecht. Sitte und Sexus der Frau, Reinbek 2000 (französ. Paris 1949). [3] Sarah Bakewell, Das Café der Existenzialisten. Freiheit, Sein und Aprikosencocktails, München 2016. [4] Poirier, 163f. [5] Poirier, 421. |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/120/wv53n.htm |