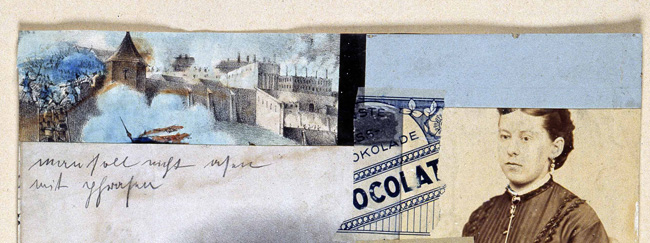GeistesGegenwart |
Der feine Unterschied – oder wie differenziert sich Indifferenz bei Kant und Arendt?Eine Studie zur UrteilstheorieFrauke A. Kurbacher Ein Beitrag zum theomag anlässlich des 60. Geburtstages von Andreas Mertin VorspannFestschriftbeträge lassen – anders als sonst – Raum für ein Moment des Persönlichen. Dies möchte ich ergreifen und von dort aus den Faden weiter ins Thema hinüberspinnen. Philosophie lässt sich sicher als das Gefilde verstehen, in dem das Denken genuin ‚zuhause‘ ist. Und doch erscheinen immer einzelne Bereiche in besonderer Weise mit ihm verbunden – und in vielen Fällen findet sich das, was zum Denken veranlasst oder einlädt, zu denken gibt oder geradezu herausfordert, andernorts. In solch‘ bestimmter Hinsicht ziehen insbesondere Theologie und Ästhetik Reflexion auf sich, lässt sich unter Umständen gerade hier in besonderer Weise ‚Denken lernen‘, wiewohl es sich – zumindest verstanden als Philosophieren – grundsätzlich nicht lernen lässt. Aber das Lernen sei auch hier nicht als bloße Anweisung und Befolgung missverstanden, sondern in der Hinsicht aufgegriffen und beleuchtet, dass in theologischer und ästhetischer Reflexion – wie eben im besten Fall auch in philosophischer – begriffen werden kann, was es bedeutet zu denken bzw. was Denken bedeuten kann. Vor allem im Ästhetischen kann sich hier in Unruhe, Irritation und lustvoller Erhöhung des Lebensgefühls – wie Kant es in Aussicht gestellt hat[1] – eine Freiheit eröffnen.
In diesem Dreiklang aus Philosophie, Ästhetik und Theologie – und den intendierten Reibungen zwischen diesen drei – bewegt Andreas Mertin als freier Geist mit dem theomag seit nunmehr über hundert Ausgaben. Die folgenden Gedanken schwingen anlässlich seines 60. Geburtstages mit in diese Trias ein: AuftaktDer Titel „Der ‚feine Unterschied‘ – oder wie differenziert sich Indifferenz bei Kant und Arendt?“ spielt unverkennbar auf Pierre Bourdieus berühmte Kant-Kritik Die feinen Unterschiede an,[2] in denen er zugleich den großen Philosophen aber auch konstruktiv fortschreibt. Die Kritik und das Augenmerk des Soziologen Bourdieu und enfant terrible der Hochschulen und ihrem klassischen Kanon gilt dabei der Herausarbeitung von Milieus und ihren gewichtigen Differenzen. Es handelt sich um den aufmerksamen Blick auf soziale Konkretionen, Umstände, die ein Konzept freier Schönheit nicht einfach hinwegfegen kann und doch – lässt sich auch mit Kant dagegen halten – da das Ästhetische nicht nur als Theorie, Leitspruch oder Maxime aufklärerischen Lebens, sondern vor allem als eine Weise, Welt zu erschließen eine Tür zur Freiheit über alle sozialen Diskrepanzen hinweg offen hält, birgt es gerade darin selbst auch politisches und emanzipatorisches Potential. Wie auch immer die möglichen Streitpunkte zwischen beiden Denkern ausgelotet werden, leistet Bourdieu damit eine bis heute bedachte Historisierung und soziale Konkretisierung der Gedanken zum ästhetischen Subjekt bei Kant, das so durch die Dimension des Kollektiven kritisch angereichert wird, wiewohl auch dies bei Kant bereits angelegt ist.[3] Die – beinah unüberbrückbaren Unterschiede, auf die der französische Soziologe mit wachem politischem Gespür kritisch aufmerksam machen möchte, finden sich dort also primär extern. Der Unterschied, um den es hier gehen soll, ist jedoch vielmehr zunächst ein interner und geht aber ebenfalls auf Kants Ästhetik zurück. Es ist ein so feiner Unterschied, dass er bisher in der Fachliteratur oft übersehen wurde. Ihm und seiner produktiven Aufnahme im Denken Hannah Arendts gelten die folgenden Ausführungen. Von der Ethik zur Ästhetik – und zurück?
Für Arendt wird mittlerweile gemeinhin die außerordentliche Relevanz des Urteilens für ihr Werk angenommen – ein Grund mehr auf dieses Urteilen und Arendts Vorlage Kant noch einmal genauer und differenziert zu schauen, denn über die beiden bereits in den vorgängigen Kritiken behandelten Urteilstypen, dem logisch-bestimmenden und dem reflektierenden, hinaus, präsentiert Kant in der dritten Kritik auch einen dritten Weg für das Urteilen. Und nur diese dritte Urteilsform, das ästhetisch-reflektierende, subjektiv-allgemeingültige Urteil hat die Kraft für das, was Kant selbst zur ‚Rehabilitierung des Gefühls‘ in seinem Spätwerk ausführt.[5] Die weitere Analyse wird zeigen, dass Kant für diese dritte Art zu Urteilen eine Form der Indifferenz ansetzt, die auch in Richtung Freiheit und Eigenheit gelesen werden kann, und gleichzeitig eine Idee von Prototypizität bietet – gleichsam als theoretisch benötigter Formalität des Urteilens bei aller Besonderheit und Freiheit, die gerade in dieser Urteilsform zum Tragen kommt. Daher können Kant und Arendt vom besonderen „Talent“ des Urteilens zwischen Besonderheit und Allgemeinheit zu vermitteln sprechen. Ich betone diesen Punkt, weil aus verkürzter Reflexion das Prototypische schon als bloß rational in der Forschung missverstanden wurde. Es geht aber Kant wie Arendt um den Gedanken, dass wir grundsätzlich darauf reflektieren müssen, dass das, was am ästhetischen Urteil aufgezeigt wird, letztlich für alles Urteilen gilt – daher weist gerade der Prototyp des ästhetischen Urteilens auf die Anteile von Eigenheit, Freiheit, Besonderheit, Gefühl und Erfahrung an jedem Urteil – und lässt sich von hierher gut mit modernen Phänomenologien und auch haltungsphilosophischen Entwürfen zusammendenken. Von hierher gewinnt Indifferenz – anders als in ihrer abendländischen moralisch-ethischen Tradition – einen ausgesprochen positiven Aspekt. Und entscheidend ist zu konstatieren, dass nur diese dritte Urteilsart die Basis für Arendts Urteilsverständnis bildet. Die Aufteilung von Urteilsarten bei Kant kann nicht nur als verschiedene Weisen des Denkens begriffen werden, wie es im kantischen Begriff der „Denkungsart“[6] zum Ausdruck kommt, sondern auch als drei verschiedene Weisen, die Welt zu verstehen und mit ihr umzugehen. Insofern ist es auch von besonderem Interesse für die Denkerin einer ‚Welthaftigkeit‘, die ihr über ihr gesamtes Schaffen hin eine Auszeichnung bedeutet. Die Vielfalt des Urteilens – in Kants Kritik der Urteilskraft herausgearbeitet – ist ebenso ein existentieller Ausdruck für die menschliche Fähigkeit zur ‚Haltung‘ beziehungsweise auch Beleg für die Möglichkeit ihrer Änderung.[7]
Ein Neubeginn westlichen Denkens? – statt einer EinleitungEin Umstand der Arendt-Forschung, der bis heute einige Forscher bewegt, ist die Frage, warum sich die politische Theoretikerin der vita activa mit all ihren Kritiken gegenüber der abendländischen Tradition im Spätwerk nun selbst auf die vita contemplativa wirft mit all den klassischen, philosophischen weltfernen metaphysischen Themen, die zuvor eher als ‚weltlos‘ diskreditiert schienen.[8] Im vorliegenden Text sei eher gezeigt, dass es ein tiefes Interesse von Seiten Arendts an den tradierten philosophischen Konzepten gab, in denen sie sowohl z.T. auch ungelöste Probleme ihres eigenen Schaffens wiedererkannte als auch solche, die die europäisch geprägte Philosophie als Ganzes betreffen. Daraus erhellt sich ihr, aber auch überhaupt das anhaltende Bedürfnis weiter zu diesen drei philosophischen Schlüsselthemen zu forschen: der Fähigkeit zu denken, dem freien Willen und der Urteilskraft. Während, vor allem aber auch nach den beiden Weltkriegen, insbesondere dem Zweiten, hat sich eine Reihe von Philosophen kritisch mit der westlichen Philosophie auseinandergesetzt und sich auch der Herausforderung eines Neudenkens gestellt; die meisten von ihnen in einer Kritik und Neudefinition der Vernunft, wie z.B. Theodor W. Adorno, Jürgen Habermas oder Wolfgang Welsch. Anderen wie Hans-Georg Gadamer, Jean-François Lyotard und Jacques Derrida starten eher von der Urteilskraft aus – so auch Hannah Arendt. Dies bedeutet zumeist einen Rückgriff auf Kants dritte Kritik, die den Begriff und die Vorstellung von Urteilskraft bis heute nachhaltig geprägt hat. Der Umstand aber, dass Arendt ihr letztes und von ihr als wichtigstes erachtetes Werk Das Urteilen nicht vollenden, ja kaum beginnen konnte, schreit nach einer Rekonstruktion der Urteilskraft und dem,[9] was Urteilen überhaupt heißen kann – oder präziser, was der Urteilsakt bedeutet, wie er sich konkret vollzieht, welche spezifischen Erfahrungen zum Urteilen gehören und wie sich der Urteilende selbst darin wahrnimmt. Arendts Vorlesungen über Kant aus den 1970er Jahren geben mehr oder minder versteckte, mehr oder minder offenkundige Hinweise auf ihre eigenen Ideen zum Thema des Urteilens. Doch hätten wir ihr komplettes und ihr letztes Werk zum Urteilen vorliegen, es hätte gewiss noch einige Überraschungen enthalten, die wir uns nicht ausdenken können. So bleiben Rekonstruktion und Spekulation und nicht zuletzt das Angewiesensein auf das eigene Urteil.[10] Arendt versucht mit ihrem Spätwerk einen Neuentwurf der Philosophie. In ihm spielen Eigenständigkeit, Gewaltenteilung, Innerlichkeit, Indifferenz und Ambivalenz eine Rolle, doch wie kommen diese Punkte zusammen und wofür? Arendt kombiniert in ihrem Versuch eines philosophischen Neuentwurfs ganz verschiedene Ansätze, in denen nicht nur die kantische Ästhetik, sondern auch die Vermögenspsychologie eine Rolle spielt. Daher reflektiere ich nach grundsätzlichen Überlegungen zum Spätwerk und zur Vermögenslehre im hiesigen Kontext zunächst die beiden Denkmuster, die ihr neben Aristoteles insbesondere Kant und Montesquieu liefern, bevor ich danach noch einmal das Grundmodell der Vermögenslehren im Vergleich und Kontrast zur Rückführung aller menschlichen Fähigkeiten auf das Bewusstsein anschaue und ausblickend Arendts eigenen Versuch reflektiere. – Insofern Arendt verschiedene Muster kompiliert, gewinnt das ‚Zwischen’, dass sie – wie schon Martin Buber – mit anthropologischem, politischem und vor allem interpersonalem Gehalt zum philosophischen Terminus erhebt, noch eine weitere (methodische) Komponente hinzu, da auch ihre eigene Philosophie immer zwischen den Zeilen, zwischen den Aussagen und Annahmen selbstdenkend eruiert werden muss. Ein Grundanliegen Arendts im Spätwerk ist die nochmalige kritische Überprüfung und Reflexion ihrer eigenen steilen These von der „Banalität des Bösen“, die sie vor allem auch als unverantwortliche Gedankenlosigkeit und Weltlosigkeit versteht, deren Gegenteil aber: verantwortliche Geistestätigkeit und Welthaftigkeit nicht nur jedem von uns zumutbar, sondern auch gerechtfertigt von uns verlangt werden kann. Wie dieser Anspruch möglich und sinnvoll zu begründen ist, scheint ein Hauptmotor ihrer Überlegungen in diesen späten Texten. Dabei zeigt sich eine eigenartige Spannung im Spätwerk: Während mangelnde Welthaftigkeit bisher kritisch als Manko von ihr gewertet wurde, tritt die durchgängige, wenn auch verschieden gewichtete Weltferne der Geistestätigkeiten in den späten Schriften positiv zutage. Wie ist das zu verstehen? Auch dieser Frage möchte ich nachgehen. In der Einleitung ihres letzten Buches Vom Leben des Geistes, das als Trilogie zu den drei geistigen Tätigkeiten: Denken, Wollen, Urteilen angelegt ist, nennt Arendt also zwei Gründe für ihr Unternehmen: Zuerst die kritische Revision okzidentaler Philosophie und danach die kritische Untersuchung und Befragung ihrer eigenen These von der „Banalität des Bösen“. Wenn sie diese selbst als „Gedankenlosigkeit“ – und damit als eine Form der Indifferenz – definiert, ist es nur logisch und plausibel, über das Denken nachzudenken und all die anderen geistigen Fähigkeiten, die sie als Tätigkeiten begreift und umdeutet – und zwar in kritisch-positiver Absicht. Es drängt sich förmlich auf, nach dem Gegenteil von Gedankenlosigkeit zu fragen. Eine andere Schlüsselfrage für Arendt ist die, die im Eichmann-Kontext aufkam, ob und wie jemand persönlich Verantwortung für Gedankenlosigkeit tragen kann. Wenn Gedankenlosigkeit das Problem ist, dann ruft dies zunächst nach einer Definition derselben und weiterhin nach einer Alternative. Drittens wäre zu zeigen, dass auch Gedankenlosigkeit in den Bereich individueller Verantwortung fällt und dass wir ihr unter Umständen etwas entgegenhalten können, wenn wir uns sowohl theoretisch als auch praktisch um ein differenziertes Verständnis unserer geistigen Tätigkeiten bemühen. Entsprechend dieser drei genannten Punkte möchte ich im Weiteren das Verhältnis zwischen Urteilen, Indifferenz und unseren menschlichen Fähigkeiten respektive Tätigkeiten in drei Schritten entfalten. Zuerst möchte ich auf die innere, interne Unterscheidung von Indifferenz eingehen, die mit dem ästhetischen Urteil verknüpft ist. Im zweiten Schritt werde ich die Relevanz dieses kantisch im ästhetischen Urteil fundierten Verständnis des Urteilens in Arendts Werk herausarbeiten und im dritten Zugriff versuche ich, die Bedingungen und Möglichkeiten dieses Urteilens – nach Kant der ästhetisch-reflektierende Typ – zu sondieren und zu erhellen. Der weitere Horizont von Arendts Trilogie Denken, Wollen, Urteilen enthält zwei weitere Modelle für unsere geistigen Tätigkeiten, nämlich Aristoteles‘ Vermögenspsychologie und Montesquieus Vorstellung der „Gewaltenteilung“, auch die seien betrachtet, bevor alles in einen Ausblick mündet.
Erster Schritt: Drei Variationen von IndifferenzGleich zu Beginn von Das Denken nennt Arendt zwei gute Gründe, warum sie die ‚relativ sicheren Gefilde der politischen Wissenschaften‘ für das traditionelle philosophische Thema des Denkens verlässt.[11] Es scheint, als wolle sie überprüfen, ob etwas von dieser Tradition den Ersten und Zweiten Weltkrieg und den Holocaust hätte vermeiden können oder ob sogar etwas davon zu den Bedingungen ihrer Möglichkeit gehört. Diese Fragen sind es, die den Hintergrund für sie und andere Denker bilden, nach einer Grunderneuerung westlicher Philosophie zu fragen. Die erste Frage stellt sich als kritisches Unterfangen einer Analyse des Denkens vor der Folie des Eichmann-Falles, in der sie „Gedankenlosigkeit“ konstatieren musste und – nicht wie erwartet – eine einzigartige Form des Bösen:
Und der zweite Grund wird gleichsam als Antiphon vernehmbar, wenn sie Folgendes reflektiert:
Die Erneuerung der Philosophie beginnt hier mit einer für Arendt spezifischen Weisen. Sie transponiert ein Begriffskonzept – wie Verstand und Vernunft – in eine (u.a. auch sprachliche) Aktivität: Denken. Anstelle des altehrwürdigen Themas des Verstandes und der Vernunft, reflektiert sie auf das Denken als eine Tätigkeit, die als menschliche Fähigkeit Anteil am „Leben des Geistes“ hat – sogar einen entscheidenden Beitrag zu seiner Lebendigkeit leistet. Die Verben denken, wollen, urteilen werden als menschliche Tätigkeiten und Fähigkeiten der vita contemplativa angesehen, hier aber in eine vita activa umgewandelt oder ihr zumindest angenähert. Dies ist eine der Verbindungen zwischen Arendts früherem und ihrem späten Werk, die hier förmlich greifbar wird. Nichtsdestotrotz gehören – auch für Arendt – die geistigen Tätigkeiten einer Metaphysik an, weil wir sie per se nicht sehen und greifen können. Aus diesem Grund beschäftigt sich Arendt weite Teile ihres Spätwerks mit der Frage, in welcher Form sie doch erscheinen, vor dem Faktum, das in dieser Welt alles für uns erscheint, einer Grundannahme ihrer ‚Phänomenologie des Erscheinens‘, wie ich es nenne, und die von zentraler Bedeutung für ihr Denken von Pluralität ist. Von diesen geistigen Tätigkeiten ‚Gebrauch zu machen‘ könnte eine grundlegende Widerständigkeit gegen Unverantwortlichkeit bedeuten, die u.U. zuerst als Gedankenlosigkeit erscheint. Damit ist das eigenständige, autonome Denken, Wollen und Urteilen erklärtermaßen eine Frage von Verantwortung, Freiheit und Menschlichkeit. Arendts Analyse von Eichmanns Verhalten fällt weniger als außerordentlich und genuin böse denn als trivial und alltäglich aus: „Die Taten waren ungeheuerlich, doch der Täter – zumindest jene einst höchst aktive Person, die jetzt vor Gericht stand – war ganz gewöhnlich und durchschnittlich, weder dämonisch noch ungeheuerlich“[15] – und irritiert bis heute. Vor allem, weil damit keine rettende Kluft mehr zwischen seinem Fehlverhalten und dem von allen anderen aufrecht zu erhalten ist. Arendt deckt die Verbrechen des dritten Reichs als flächendeckendes Bürgerphänomen auf: Das einzig zu Konstatierende „war etwas rein Negatives: nicht Dummheit, sondern Gedankenlosigkeit“[16] und Eichmann funktioniert aus Arendts Beobachtung im Gerichtssaal genauso wie unter dem Nazi-Regime, etwas, das sie als eine Form der Selbstfunktionalisierung analysiert:
Arendt reduziert die erhoffte Distanz zwischen uns und dem ‚Schreibtischtäter‘ in beunruhigender Weise. Sie beschreibt das Böse des Zweiten Weltkrieges und des Holocaust als etwas, das potentiell im Verhalten, den Gewohnheiten und Haltungen von uns allen grundsätzlich möglich ist und nicht allein spezifisch auf ‚Nazis‘ appliziert werden kann – oder in anderen Worten: Wir können das Potential zum Bösen nicht aus unserem Verhalten exkludieren und müssen uns auch daher stets kritisch reflektieren und prüfen. Aufgrund dieser Tragweite der arendtschen Analyse ist es bedauerlich, dass bis heute das Missverständnis grassiert, Arendt habe mit ihrer Aussage zur „Banalität des Bösen“ die Taten Eichmanns unbotmäßig, unangemessen depotenziert, ja trivialisiert und den Menschen Eichmann völlig falsch beurteilt. Dies ist mitnichten der Fall. Ihr Diktum bezieht sich nicht auf die Taten, sondern auf die Gründe seines Handels und die sind abgründig, aber nicht exklusiv. Arendt entlässt in ihrer Erörterung niemanden aus ihren kritischen Anfragen, ganz gleich, welcher Nationalität oder Religion er angehören mag. Unter Umständen ist es auch diese Verweigerung einer intellektuellen Entlastung, die ihr bis heute nachgetragen wird.[18] Die Indifferenz – dies alte Etikett in der Moralphilosophie, aber auch aus der Logik – hat nun drei Aspekte in Arendts Untersuchung. Das erste betrifft den moralischen Rahmen und besteht in der problematischen moralischen Qualität derer, die sich um nichts kümmern möchten, diejenigen, die nichts etwas angeht und in dieser Hinsicht vielleicht individuelle Defizite aufweisen, aber Konformität und Gleichheit demonstrieren und nach außen tragen. In dieser konventionellen moralischen Diskussion, scheint Indifferenz schlimmer als Un- oder Amoral zu sein, weil sie ohne jede Positionierung ist. Und in solcher Weise erscheint Indifferenz wie eine Lücke, Leerstelle oder Variable, wenn es um die Reflexion der subjektiven und intersubjektiven Dimension des Urteilens geht und alle Beurteilungen und Stellungnahmen gegenüber der Welt, einander und uns selbst. Jemand hat einen Standpunkt, aber ein Niemand ist indifferent. Die indifferente Person ist ungreifbar. Arendt bedenkt in diesem Zusammenhang Gedankenlosigkeit als eine Form der Indifferenz, aber auch als einen basalen Aspekt des Überlebens und menschlicher Bedingtheit. Denn im Leben würde uns ein permanentes Denken völlig überfordern. Daher ist die Abwesenheit des Denkens, die Gedankenlosigkeit durchaus ein normaler Zustand in unserem täglichen Leben: „Wollte man diesen Anspruch [zu denken] ständig erfüllen, so wäre man bald erschöpft“ und: „Dieses Fehlen des Denkens – eine durchaus normale Erfahrung im Alltagsleben […] rief mein Interesse wach“.[19] Doch wenn dies der Fall ist, wie kann dann ein solch unproblematischer Zustand von Gedankenlosigkeit gegen einen im moralischen Sinn hochgradig problematischen unterschieden werden? Die Frage selbst deutet schon darauf hin, dass eine klare Differenzierung hier schwierig werden dürfte, weil es sich um ein ambivalentes Phänomen handelt. Genau diese Ambivalenz interessiert Arendt und stellt den dritten Aspekt von Indifferenz im Urteilen. Der Urteilsprozess ist eine Form offener Reflexion, die frei und zunächst unentschieden sein muss, weil das Urteilen sonst immerzu schon bestimmt und eine freie Entscheidung unmöglich wäre. Für eigene Entscheidungen ist der Akt des Urteilens konstitutiv und Indifferenz hat hier offenbar vielmehr positive als negative Konnotationen. Der Urteilsakt selbst – anders als die Erfahrung des Denkens, die aus Arendts und auch aus Sicht verschiedener Positionen seit der Antike, eher von der eigenen Person ab und auf die thematischen Zusammenhänge hinsieht – ist ausdrücklich mit der Person des Urteilenden verbunden. Im Urteilen beziehen wir Stellung und verleihen unserem Standpunkt Ausdruck, selbst wenn wir angehalten sind, uns in Neutralität zu üben, wie dies z.B. bei Gericht oder in Prüfungen der Fall ist. Auch Neutralität ist eine Form der Positionierung. Im Akt des Urteilens sind wir uns unserer selbst als auch des Urteilens bewusst. Der einzige Unterschied zwischen Eichmann und uns ist nach Arendt nur, dass er überhaupt keinen Anspruch an sich als Denkender habe, das allein bestimmt hier die Indifferenz negativ und den Zustand des Unbewussten, der allerdings einstmals willentlich entschieden wurde – nämlich als eine wissentliche Einstimmung in unbedingten Gehorsam und der damit gegebenen grundlegenden Abwälzung von Verantwortung. Diese negative Form der Indifferenz muss vom weniger problematischen Typ, der unseren Alltag gleichsam als Selbstschutz begleitet, unterschieden werden. Und genauso von jenem notwendig unentschiedenen Zustand im Urteilsprozess selbst, in dem eine Entscheidung erst gefällt wird. Das heißt, dass Indifferenz in gewisser Weise sogar für unsere mögliche Verantwortung und Verantwortungsübernahme unabdingbar ist. Indifferenz – sozusagen wörtlich ‚in-Differenz‘ ist eine Vorbedingung für jegliche Reflexion und vermag sie zu initiieren, sie setzt aber eben ein nicht-identitäres, sondern eben differenziertes (Selbst-)Verhältnis voraus. Die weitere Analyse wird zeigen, dass allen drei geistigen Tätigkeiten: Denken, Wollen, Urteilen eine solche, wie hier an der Indifferenz auf der Basis einer inneren Differenz gezeigte Ambivalenz eigen ist, die jedoch je spezifisch und produktiv ist. Für Arendt ist jede Tätigkeit durch eine besondere Offenheit, Spannung oder auch Lücke gekennzeichnet. Die daraus resultierende Spaltung bzw. Differenz ist konstitutiv für jede der drei geistigen Tätigkeiten. Im Falle des Denkens ist es – der Platon entlehnte – innere Dialog. Wir sind nicht einfach wir selbst, sondern in besonderer, nämlich produktiver Weise nicht eins mit uns selbst, wir sind „zwei in einem“ für Arendt, es ist zugleich dieser Umstand, der die Reflexivität aller „geistigen Vorgänge“ begründet und für sie kennzeichnend ist.[20] Und bezüglich des Wollens sind wir nicht nur ein zeitgleiches Wollen und Nicht-Wollen, sondern vor allem die daraus erwachsende Möglichkeit und Freiheit, die in der Gewissheit besteht, jederzeit auch anders Wollen zu können. Damit ist zugleich auch unsere grundgegebene Verantwortung apostrophiert. Wie drängend die Erfahrung und vor allem der im Wollen erlebte Konflikt aus Wollen und Nicht-Wollen auch ist, kein Wollen ist alternativlos. In Zitation des schottischen Scholastikers Duns Scotus weist Arendt darauf hin, dass „nur das wollende Ich weiß, daß ‚eine aktuell getroffene Entscheidung nicht hätte getroffen werden müssen, daß man auch eine andere hätte treffen können‘“.[21] Das Wollen konfrontiert nicht nur mit individueller, persönlicher Freiheit, sondern auch mit Kontingenz. (Für Arendt zwei Gründe, warum der Wille so wenig bisher von der Philosophie berücksichtigt und betrachtet wurde.)
Es ist das Bewusstsein unserer eigenen Möglichkeiten im Sinne einer Selbst-Reflexion, dass uns unserer eigenen Möglichkeiten gewahr werden lässt. Doch der Wille ist nicht nur mit Oppositionen beschäftigt:
Dies ist bemerkenswert. Hier wird die Indifferenz willentlich gewählt. Nicht im problematischen Sinn der Selbstfunktionalisierung, aber in einer philosophischen, stoischen, geradezu husserlschen Weise: Indifferenz als epoche kann als produktive Form der Urteilsenthaltung verstanden werden, eine temporäre Absenz des Urteilens, nicht dauerhaft, aber lang genug, um Freiheit als einen inneren Freiraum zu realisieren, der entscheidend ist, um Urteile fällen zu können. Indifferenz in dieser positiven Hinsicht ist hochgradig wichtig für den Akt des Urteilens, während sie in negativer Ausprägung als problematische, dauerhaft eingenommene Haltung, gerade die persönliche Freiheit negiert und daher Verantwortung unterläuft und behindert. Diese polyvalente Indifferenz ruft nach kritischer Aufmerksamkeit und dauerhafter Reflexion.
Zweiter Schritt: Ein ästhetischer Urteils-Prototyp für moralische-ethische FragenDie bestechende Konstitutivität der Indifferenz für das Urteilen und ihre folglich unabdingbare Notwendigkeit auch im Kontext moralischer Fragen, wirft überhaupt die Frage nach dem Verhältnis zwischen Moralität und Urteilen auf. Die Hypothese im Rahmen einer kritischen philosophischen Revision ist, dass sie sich nicht vor dem Hintergrund des Ethisch-Moralischen vollzieht, sondern eine ästhetische Signatur trägt. Denn Arendts Analysen der Indifferenz beruhen auf Kants Konzept des ästhetisch-reflektierenden Urteils, dem anders als dem logisch-bestimmenden Urteil nur eine subjektive Allgemeingültigkeit zukommt. Im Rahmen dieses Artikels können nur kurze Streiflichter auf diese so spannende wie komplexe Thematik geworfen werden. Im Folgenden werde ich die basalen Elemente von Kants ästhetischem Urteil (dem Geschmacksurteil) und der Hauptstruktur von Arendts Entwurf behandeln.[24] In seinen früheren Kritiken bestimmt Kant das Urteilen als eine Relation zwischen Besonderem und Allgemeinem und umgekehrt und differenziert nur zwei Weisen des Urteilens, das bestimmende und das reflektierende. In beiden Fällen geht es letztlich um eine Unterordnung, eine Subordination des Besonderen unter das Allgemeine. Einmal ist das Allgemeine vorgegeben, im bestimmenden Urteil, und einmal wird es erst noch gesucht, im reflektierenden. So weit so gut. Es scheint gleichwohl erstaunlich, dass Kant in seiner dritten Kritik, die eben das ästhetisch-reflektierende Urteil exponiert, sich vor allem aber überhaupt zu fragen scheint, was Urteilen eigentlich ist und bedeutet. Was passiert im Urteilen? Ästhetische Urteile handeln traditionell (im Diskurs der Künste und den Fragen der Schönheit) mit dem sogenannten ‚je ne sais quoi‘, dem ‚ich weiß nicht was‘, mit etwas, das gegeben ist, aber nicht in Worte gefasst werden kann, d.h. nur eben in diesem Urteil: „Das ist schön!“ Kant, der die Autonomie der Fähigkeit des Urteilens erweisen möchte, wie seine beiden vorherigen Kritiken zuvor ebenfalls die Autonomie der jeweils behandelt Fähigkeit zum Gegenstand haben, bekommt nun ein massives Problem und Arendt ist sich dessen bewusst und entsprechend interessiert. Im Rahmen des kantischen Transzendentalprojekts gilt es, die Autonomie zu erweisen, und dies bedeutet, ein a priori – ein vor aller Erfahrung – der Urteilskraft aufzuzeigen. Aber was könnte das für ein a priori für die Urteilskraft sein, die als Geschmacksurteil augenfällig auf Erfahrung angewiesen ist. Dies ist, was Arendt gleichsam zum ‚Skandal‘ der dritten Kritik erklärt. Und ist das Urteilen nicht überhaupt etwas, was immer nach der Erfahrung kommt? Kant entdeckt nun einen dritten Typ des Urteilens, der zugleich als Prototyp für alles Urteilen überhaupt gelten kann. Das ästhetisch-reflektierende Urteil ist auf Gefühl gegründet, das subjektive Gefühl der Lust und Unlust, die Kant in den Feldern des Kunst- und Naturschönen exemplifiziert, und in den Themen der freien Schönheit und des Erhabenen. Auf Basis dieser Begründungsfigur im subjektiven Gefühl kann verständlich werden, warum in der dritten Kritik die Gefühle, die für die erste und zweite Kritik, der reinen und praktischen Vernunft, keine besondere und schon gar keine fundierende Rolle spielen und spielen können, rehabilitiert werden. Das ästhetisch-reflektierende Urteil befindet sich zwischen dem bloßen Sinnenurteil und dem allgemeinen und neutralen Charakter des logisch-bestimmenden Urteils. Die beiden am Urteilsprozess beteiligten Erkenntniskräfte, der Verstand für die Begriffsbildung und die Einbildungskraft für die Lieferung von Anschauungen, ergänzen sich aber auch hier sinnvoll und funktionstüchtig wie in allem anderen Urteilen auch. Sie befinden sich allerdings hier im Kontext des Ästhetischen in einem „harmonischen Wechselspiel“, das eine „Reflexionslust“ hervorruft und das Lebensgefühl erhöht. Und gleichzeitig wird es von Kant als „interesseloses Wohlgefallen“ gegenüber dem Objekt vorgestellt, das das so urteilende Subjekt affiziert hat. Da der Grund seines Urteilens im Gefühl liegt, kann der Anspruch dieses Urteils nurmehr ein subjektiver sein, weil aber auch anderen dasselbe Urteil zugemutet und angesonnen wird, spricht Kant von einer subjektiven Allgemeingültigkeit, auch um es von einem bloßen Privatgeschmack zu unterscheiden, wie ihn etwa die Sinnenurteile liefern. Wie auch immer – die urteilende Person hofft, mutmaßt, erwartet, dass auch andere so urteilen könnten. Wir alle haben, aufklärerisch betrachtet, die Fähigkeit zu Urteilen und Kant appelliert daher im Rückgriff auf den gesunden Menschenverstand und seine Maximen an den sensus communis, nur fälschlich für ihn Gemeinsinn genannt, bzw. er weist aus, dass wir unter demselben eben jenen Selbst- und interpersonalen Anspruch verstehen können, bei aller Verschiedenheit doch als Menschen zusammen zu gehören, oder wie Arendt es überträgt, die Welt gemeinsam zu teilen. Im berühmten § 40 der dritten Kritik erinnert er in der 2. Maxime des gesunden Menschenverstandes daran, dass wir uns jederzeit an die Stelle eines anderen versetzen können. Dies weist einen Menschen von Welt aus, sich über die eigenen kleinen begrenzten Borniertheiten und eingefahrenen Urteile hinwegzusetzen vermag, zwischen denen anderen „wie eingeklammert“ sind.[25] Wir sind fähig, uns selbstkritisch auf die anderen hin zu übersteigen. Das Urteilen begriffen als menschliche Möglichkeit, Standpunkte zu beziehen wird in dieser Hinsicht auf einen „allgemeinen Standpunkt“[26] hin erweitert und eröffnet eine Diskussion verschiedener Urteile – zumindest im Geist. Auf diese Weise verbindet Kant Inner- und Intersubjektivität im ästhetischen Konzept des Urteilens als „erweiterte Denkungsart“, von dem er annimmt, dass es letztlich „wie zu einem Erkenntnisse überhaupt“ erforderlich ist. Aus diesem Grund gilt Kants dritte Kritik auch als Selbstkritik an den beiden vorherigen kritischen Schriften und viele Aspekte dieser Urteilsexemplifikation haben Arendt und andere Denker inspiriert, denn mit ihr hat nicht nur das Gefühl, sondern haben auch Erfahrung und Kontingenz Eingang in die Subjekttheorie gefunden und in die der Intersubjektivität. Das Urteilen ist konstitutiv mit der urteilenden Person verbunden, die sich für dasselbe verantwortlich zeichnet. Wenn Erkenntnis, wie Arendt bemerkt, ‚zwingt‘, weil ihr jeder letztlich logisch folgen kann und können muss, dann lässt das Urteilen uns in Freiheit, wir können zustimmen oder auch nicht, wir können, müssen aber nicht gleich urteilen und wissen, dass wir immer anders urteilen können. Im logisch-bestimmenden und auch im einfachen reflektierenden Urteil ist dasselbe letztlich funktionalisiert, zu einem Zweck bestimmt. Das ist auch notwendig, weil wir solch funktionalisierte Urteile letztlich auch zum Überleben benötigen. Aber das ästhetisch-reflektierende Urteil ist weder funktionalisiert, noch funktionalisiert es, sondern zeigt uns eine andere Möglichkeit des Verhältnisses zur Welt auf, eines das frei ist, es ist „zweckmäßig ohne Zweck“. Daher taugt das ästhetisch-reflektierende Urteil so gut für einen kritischen Neuentwurf von Philosophie.
Dritter Schritt: Vermögenspsychologie und Gewaltenteilung als Modelle für ein produktiv-kritisches Verhältnis zwischen den geistigen TätigkeitenArendts fragmentarisches Spätwerk gibt viel Anlass zu denken. Unter anderem stellt sich die Frage, in welcher Relation sich überhaupt die drei geistigen Tätigkeiten: Denken, Wollen, Urteilen befinden. Im Folgenden möchte ich dafür drei Vorschläge bzw. Thesen unterbreiten. Die erste ist, dass Arendt verschiedene philosophische Modelle dafür kombiniert hat – und eine Reflexion auf dieselben aufschlussreich sein könnte. Die zweite bezieht sich auf die Tradition, der Arendt folgt, indem sie sie kritisiert. Und die dritte These betrifft die Trilogie, die uns in ihrem Aufbau Winke gibt, die es weiter zu reflektieren gilt: ich begreife sie als Arendts Ansatz einer Philosophie der Interpersonalität. Die drei menschlichen Fähigkeiten – Denken, Wollen, Urteilen – haben je eine eigenständige, unabhängige Kraft und ihre eigene philosophische Relevanz: anthropologisch, politisch und methodisch. Bis hierher scheint es, als ob das neue Projekt einer Philosophie vor allem auf Autonomie, Gewalten-Teilung, Indifferenz und Ambivalenz setzt und Inner- wie Intersubjektivität eine Rolle spielen, aber wie sind die Kräfte miteinander verbunden und warum? Während die philosophische Tradition in der Gefährdung der Isolation (z.B. Solipsismus), der Formalität und Abstraktion steht (die allerdings ebenso unbestritten auch Wichtiges bewirken und herausarbeiten), und Gefühl, Erfahrung, Kontingenz, Intersubjektivität und Interpersonalität eher vermisst werden, folgt Arendt einer Tradition der Vermögenslehren, die von Aristoteles bis Kant als letztem in dieser Reihe in Anschlag gebracht wird – also die Vorstellung, dass verschiedene Kräfte im Menschen wirken. Im 19. Jahrhundert wird dieses Konzept vor allem durch den Einfluss Hegels durch die Vorstellung einer einzigen Kraft, auf die alles zurückgeführt werden kann, abgelöst: Es ist das Konzept des Geistes oder bis heute gültig – des Bewusstseins. Innerhalb der Vermögenslehren standen im philosophiegeschichtlichen Verlauf als Anwärter für die verschiedenen Vermögen ebenso viele verschiedene Kräfte im steten Streit um die Vorherrschaft zur Disposition, wie es vielleicht besonders deutlich an den vor allem in der Scholastik viel diskutierten tres operationes mentis hervortritt: memoria, ingenium, judicium, Erinnerung, Einbildungs- und Urteilskraft oder – je nach Interpret – auch in jeder anderen möglichen hierarchisch verstandenen Reihenfolge. Und so fragt sich von hier aus mindestens Zweierlei: Was bedeutet es für uns und unsere Vorstellungen, für unsere Selbstkonstitution und unsere Selbstverständnisse, von verschiedenen Vermögen auszugehen oder nur eine wirksame Kraft anzunehmen? Und was bedeutet es, wenn Arendt die kantische Trias Vernunft, praktische Vernunft, Urteilskraft zu Denken, Wollen, Urteilen hin verschiebt und modifiziert – und die Denkerin im 20. Jahrhundert vor allem eher ein unhierarchisches Verhältnis der Kräfte vor Augen steht? Was sagt das aus? Und kann wirklich bei ihr von Vermögen gesprochen werden, wenn sie doch die Verbformen und die Geistes-tätigkeiten akzentuiert?
Kants Vermögensmodell der Subjektivität und Personalität und seine Aufnahme und Abwandlung bei ArendtDas erste übergeordnete Modell, an das Arendt anschließt, wäre also die aristotelisch geprägte Vermögenspsychologie überhaupt. Und das zweite ist das kantische Modell, dass insofern bei Arendt greift, als sie genau wie Kant nach der Autonomie dieser Vermögen fragt. Da nun mit der gesuchten Autonomie, letztlich die des Subjekts bei Kant bezeugt wird, lässt sich auch bei Arendt vermuten, dass es von subjekt- und mehr noch von persontheoretischer Relevanz ist, was in den Schriften Denken, Wollen, Urteilen und mit den gleichnamigen Geistestätigkeiten ausgetragen wird. Kant untersucht und verfolgt in seinen kritischen Schriften die Autonomie der Vermögen, die allein ihr begründendes und vor allem begründungsstiftendes Potential im Sinne einer unabdingbaren Denkannahme gewährleisten. Vernunft, praktische Vernunft und Urteilskraft werden sich hier als solche autonomen Vermögen erweisen und bewähren. Auch Arendt geht von einer Eigenständigkeit der geistigen Tätigkeiten des Denkens, Wollens und Urteilens aus, die sie in ihrer Spezifität sucht. Hier zeigen sich die Tätigkeiten als in sich bewegte, ambivalente und sprechen gerade so für die Lebendigkeit des Geistes. Arendt bemerkt diese Bewegtheit in der Vorstellung eines „Zwei-in-einem“ in jedem der „geistigen Vorgänge“, das zugleich die eigene Freiheit und Autonomie verbürgt. Welche Bewegtheit das Urteilen vorgewiesen hätte, kann nur gemutmaßt werden: das innere Gespräch wäre hier wohl nach dem Modell der bei Kant ausgearbeiteten „erweiterten Denkungsart“ eher als denkende Einfühlung in Andere und das Gespräch mit Anderen, auch in Form von Kontroversen und kritischen Meinungen vorstellbar im Sinne des sensus communis. In der Frage nach dem Unterschied und seinen Konsequenzen, kann zunächst festgehalten werden, dass Arendt mit dem Leben des Geistes und seinen drei Teilen Denken, Wollen, Urteilen bereits eine Kompilation dieser Traditionen und eine entscheidende Modifikation von Kants reiner Vernunft, praktischer Vernunft und Urteilskraft liefert. Weiterhin lässt sich konstatieren, dass im Gegensatz dazu die alleinige Rückführung auf eine Kraft, Differenzen fallen lässt oder unter einer Fähigkeit uniert, nämlich einer rationalen, deren Eigenheiten und Differenzierungen selbst Kant noch ein eigenes Anliegen sind und deren jeweilige Autonomie er zu erweisen sucht. Dieser Zug bestimmt auch Arendts Ausführungen, die ebenfalls an der Eigenständigkeit jeder der Tätigkeiten interessiert ist und ihrer Unabhängigkeit. Für jede der Tätigkeiten besteht sie in einer inneren Differenz, dem inneren Dialog für das Denken, dem inneren Konflikt für das Wollen und vermutlich die Pluralität der Urteile und Standpunkte für das Urteilen, Kants „erweiterte Denkungsart“, die es erlaubt, die Standpunkte anderer gleich einem internen Diskurs, inneren Theater oder Kopfkino aufzurufen. Dieses nicht-identitäre Konzept für die geistigen Tätigkeiten begründet Verantwortlichkeit – geradezu im Wortsinn und zeigt eine produktive Ambivalenz als konstitutiv für Welthaftigkeit und für das Verhältnis zur Welt. Arendt geht davon aus, dass eine Spaltung und damit verbundene Distanznahme, die jede Tätigkeit auf ihre Weise inkludiert, notwendig ist, nichtsdestotrotz befähigen gerade darum die geistigen Tätigkeiten zur aktiven, verantwortlichen Verbundenheit mit der Welt, sich selbst und anderen, wie es im Urteilen besonders hervortritt.
Montesquieus Modell der Kollektivität und PluralitätNeben diesem, an der Vermögenslehre orientierten Modell entdeckt Arendt noch ein anderes für ihren eigenen philosophischen Entwurf: Montesquieus Konzept der Gewaltenteilung. Seine Vorstellung der Gewaltenteilung im Staat, wie sie bis heute noch als Grundbaustein unserer Rechtstaatlichkeit gilt, kann als eine analoge Vorstellung dafür genommen werden, wie Arendt sich u.a. die Funktion der Geistestätigkeiten denkt und ihr Verhältnis zueinander. Gleichzeitig fällt an der Kompilation beider Muster und Denkfiguren auf, dass sie auf der einen Seite einen Subjekttheoretiker par excellence bemüht: Kant, und auf der anderen Seite einen bis in unsere Zeit grundlegenden Staatstheoretiker: Montesquieu. In Vom Leben des Geistes, wird der französische Denker, der die unhintergehbaren strukturellen Voraussetzungen für unsere Demokratien bis heute geschaffen hat, von der politisch interessierten und versierten Arendt nur ein einziges Mal erwähnt, dafür aber in prominenter und sprechender Weise:
Das Leben des Geistes ist niemals stumm, wegen der Reflexivität der geistigen Tätigkeiten, und selbst das mögliche Urteil – als Akt der Entscheidung – ist, wie es Montesquieu bemerkt, noch eine geheime oder sogar ‚geheimnisvolle Rückkehr‘ zu uns selbst. Die mit dem Urteilen hervortretende menschliche Fähigkeit, einen Standpunkt zu beziehen (die Arendt in Auseinandersetzung mit Scotus bemerkt), gibt immer auch Aufschluss über uns selbst. Diese Reflexivität der geistigen Tätigkeiten basiert auf ihrer spezifischen Gebrochenheit. Und jede dieser reflexiven Tätigkeiten wirft ein Licht auf die Eigenheit und Besonderheit der Person in ihrem Denken, Wollen, Urteilen und ihren Erfahrungen als Denkende, Wollende und Urteilende und begründet einen Anspruch auf persönliche Verantwortung. Selbst, wenn wir nicht immerzu denken, sind wir fähig dazu und können Verantwortlichkeit für unser Denken beanspruchen und falls nötig, auch für unsere Gedankenlosigkeit. In dieser Weise kann Montesquieus geheime Rückkehr zu sich selbst nicht nur als philosophische Form der Selbstreflexion aufgefasst werden, sondern auch als kritischer, selbstreflexiver Anspruch an Philosophie selbst. Mit der „geheimen Rückkehr zu sich selbst“ erfährt so auch die Innerlichkeit als Ort der Reflexivität eine Wertschätzung, wofür u.a. offenbar sogar Montesquieu ein Gewährsmann für Arendt ist. Die Weltferne steht hier offenkundig im Sinne produktiver Auseinandersetzung als abgesondert von der Welt, um sich ihr – und damit gerade in Verantwortung für diese Welt – erneut zuzuwenden. Denn mit Montesquieu tritt nicht nur ein Gewährsmann auf den Plan, der als Adliger der Auffassung war, „daß der Staat ‚allen Bürgern gesicherten Unterhalt, Ernährung, anständige Kleidung und eine gesunde Lebensweise schuldig ist’“, sondern auch einer, woran Jean Starobinskis erinnert, der mit „seinem Landsmann Montaigne“ zu den Wenigen gehört, „die sich auf mittlere Wege verstehen, ohne der Mittelmäßigkeit anheimzufallen. Mäßigung, so wie Montesquieu sie praktiziert (und womit er aus meiner Sicht auch an Aristoteles anknüpft), ist keine Tugend der Beschränkung. Ganz im Gegenteil ist sie die Haltung, welche die größte Öffnung hin zur Welt und deren Aufnahme möglich macht“, was überdies auch den Widerspruch impliziert.[28] Auch in anderen Hinsichten bietet sich Montesquieu für Arendts Denken an: als nicht eurozentristischer Denker, als Denker in Umbruchzeiten und als Verfasser der Lettres persanes, wo im Hineinversetzen in andere und fremde Perspektiven zugleich auch die Selbstverständlichkeit der eigenen Welt aufgehoben und damit deutlich wird, dass die mögliche Infragestellung und Irritation dem Gedanken der „erweiterten Denkungsart“ eben auch anhaftet. Das auf Montesquieu zurückgehende Modell der Gewaltenteilung untergliedert sich nach gemeinem Verständnis in heutiger Differenzierung für die Funktionen der Staatsgewalt nun grob in: Gesetzgebung, Regierung (respektive Verwaltung) und Rechtsprechung (Legislative, Exekutive, Judikative), die allesamt auf verschiedene Träger verteilt sind, damit sie sich gegenseitig beschränken und kontrollieren. Zuerst von Locke und dann maßgeblich von Montesquieu in De l’esprit des lois von 1748 gefordert,[29] ging die Vorstellung der Gewaltenteilung in die Theorie des Rechtstaates über. Die Legislative als Prinzipiengebendes, als über die Grundlagen Reflektierendes passt sowohl gut zur kantischen ‚Vernunft’ als auch zu Arendts Vorstellung des ‚Denkens’. Die Exekutive hat zumindest deutliche Verbindung zum Wollen, dessen konstitutive und grundgebende Konfliktualität nur durch das Handeln beendet und insofern ‚gelöst’ werden kann. Darum beschreibt Arendt das Wollen als ‚Übergängigkeit’ zum Handeln, das freilich implizit allen geistigen Vermögen in der Bezeichnung als Tätigkeiten unterlegt ist. Die Freiheit jedoch wird gerade im Zwist des Wollens gegründet und findet ihr jeweilig partielles Ende mit der Entscheidung zu einer bestimmten Handlung bzw. besteht dann darin, im Sinne des Willens zu handeln.[30] Und die Judikative wäre dann das zum Urteilen gehörige Pendant. Nun könnte freilich sogleich protestiert und eingewendet werden, dass beide Modelle, das kantische und das montesquieusche, unvereinbar aufeinander zu prallen scheinen. Während die Vermögenslehre im kantischen Sinn auf Autonomie basiert, zeigt das Gefüge bei Montesquieu vielmehr eine anscheinend heteronome Verzahnung, die erst zusammen ein funktionierendes Staatsgebilde darstellt. Aber mit Kant, der selbst mit folgender Passage aus der Metaphysik der Sitten auf Montesquieu rekurriert, kann aufgezeigt werden, dass Eigenständigkeit und Verbindung zusammengehören und zusammengedacht werden müssen. Denn nach Kant ist jede der drei Gewalten: „das Ergänzungsstück der anderen zur Vollständigkeit der Staatsverfassung“ und jede der anderen in dem Sinne untergeordnet, dass sie „nicht zugleich die Funktion der anderen, der sie zur Hand geht[,] usurpieren kann“.[31] Das heißt übertragen auf das hier behandelte Verhältnis der geistigen Tätigkeiten zueinander: der Zusammenhang beruht gerade auf der irreduziblen Eigenheit der einzelnen Vermögen, ihrer bedarf es für die Gesamtheit der Person. Dies spricht, wie noch zu zeigen sein wird, für eine holistische Auffassung der Person in ihrer Interpersonalität. Montesquieus Modell unterscheidet die Kräfte in Legislative, Exekutive und Judikative, und jede von ihnen hat eine unersetzbare Funktion für die beiden anderen. Macht ist hier in weiser Form reduziert und aufgeteilt. Die Legislative reflektier und etabliert Prinzipien (dies ließe sich übertragen z.B. die Prinzipien der Vernunft bei Kant beziehen oder auf die zum Denken bei Arendt). Die Exekutive lässt sich mit dem Willen verbinden, denn der konstitutive Konflikt zwischen Wollen und Nicht-Wollen kann nur durch das Handeln und nicht den Willen selbst gelöst werden, der Akt aber beendet wiederum (durch Festlegung) die Freiheit, in der sich das Wollen befindet. Und die Judikative wäre vermutlich ein Äquivalent zum Urteilen.[32] Nun fragt sich, wie Kants Autonomie-Konzept und Montesquieus Gewaltenteilung zusammenkommen. In Arendts Adaption beider im Spätwerk ist es die spezifische Eigenheit der drei Tätigkeiten, die das Verhältnis zwischen ihnen garantiert und mit Arendts Konzept der Person und Interpersonalität korrespondiert. Auf der einen Seite gibt es die drei gespaltenen Tätigkeiten, die in ihrer Eigenheit eine Dreiheit begründen und auf der anderen Seite stehen sie in einem kritischen Verhältnis zueinander, gleich einem regulativen Prinzip, wie Kant es nennen würde. Es ist nicht zuletzt dieser kritische Geist des (inneren) Widerspruchs, der sie von einer geeinten, identitären Vorstellung lediglich eines Bewusstseins unterscheidet. Das Verhältnis der drei geistigen Tätigkeiten zueinander ist kritisch und produktiv zugleich und bezeugt eine Unruhe des Geistes, die auch als seine Lebendigkeit begreifbar wird. Dies könnte eine Bedeutung „Vom Leben des Geistes“ sein.
Arendts Konzept einer Interpersonalität – statt eines SchlussesTatsächlich verhält es sich bei Arendt so, dass die Art der jeweiligen Differenz, des „Zwei-in-einem“ für die beiden Tätigkeiten Denken und Wollen und mutmaßlich auch für das Urteilen, nicht in einander übersetzbar sind, sondern etwas je gänzlich Eigenes darstellen, was aber für die Person jeweils unersetzbar entscheidend für ihre Individuierung, Selbstbildung und Verantwortlichkeit ist, ohne eine Hierarchie unter den Vermögen ausmachen zu können. Interessant ist nun, unter der Annahme meiner Hypothese, dass Arendt die Auffassungen der kantischen Vermögen und der montesquieuschen Gewaltenteilung neben Aristoteles für ihre kritische Vermögenslehre Pate gestanden haben, dass in dem ersten Fall das autonome Subjekt perspektiviert ist und in Arendts Umschreibung die eigenständige Person und in dem zweiten Fall damit die Voraussetzungen für den Staat als juristische Person, als Rechtsperson beschrieben werden, d.h. der Staat selbst wird als willentlich handelnde juristische Person gewährleistet. In dieser Weise kämen dann Aspekte des Einzelnen und der Vielen zusammen und dies könnte aus meiner Sicht in dem arendtschen Bemühen gelesen werden, die interpersonale Anlage der Person, ihr ‚Wohlgerüstet- und Geöffnet-Sein’ zur Welt,[33] ihre Pluralität und Pluralitätsfähigkeit bereits in der Anlage der Geistestätigkeiten in differenzierter Form aufzuweisen und darzulegen. So kommen dann in Arendts Aufnahme und Diskussion der Vermögen in Bezug auf die Person in ihrer Verantwortbarkeit beide Perspektiven zusammen, die individuelle und die gemeinschaftlich-kollektive. So wie Montesquieu über den Zusammenhang von Recht, Politik und gesellschaftlicher Ordnung nachdenkt, kann auf Basis von Arendts Zusammenfügung der verschiedenen Denkfiguren und Muster über die Verflechtung der Person in ihrer (internen) Organisation im Kontext der Gemeinschaft in ihrer eigenen Organisation anhand der Modelle: Vermögenslehre, Autonomie und Gewaltenteilung nachgedacht werden. Und dies vor allem eingedenk dessen, dass Arendt Zeitzeugin einer Epoche ist, in der auf erschreckende Weise das Band zwischen Einzelnem und Anderen, die angenommene Allianz von Einzelnem und Gemeinschaft und umgekehrt von Gemeinschaft und Einzelnem in ihrer gegenseitigen Stabilisierung in der Sorge um das Wohlergehen des jeweils anderen in ihrer Verletzlichkeit, Brüchigkeit, ja Auflösung sichtbar wurde. Und hier prüft sie die philosophische Tradition daraufhin kritisch, wie die Bedeutung des Menschen als „zoon politikon“ und als „animal sociale“ derart aus dem Blick und in Vergessenheit geraten konnte. Und insofern die Aufnahme einer, wenn auch variierten Vermögenslehre an aristotelische Vorstellungen anknüpft, geht es ihr bei dem Band zwischen Einzelnem und Gemeinschaft, den staatlich organisierten Gesellschaften und den Einzelnen in ihrer Pluralität vermutlich auch um ihre je einzelne und gemeinsame Orientierung auf ein gutes Leben im ethischen Sinne. Mit der Gewaltenteilung als Analogon zum Verhältnis der verschiedenen menschlichen Tätigkeiten des Geistes wird eine Abkehr vom fixierten Subjekt zugunsten eines beweglichen Machtgefüges im Sinne der produktiven Wirksamkeit deutlich. Diese fungiert mit verschiedentlich gelagerten Kräften und Tätigkeiten als eine Subjektstruktur und bedeutet damit auch eine Abkehr bzw. eine indirekte Problematisierung der insbesondere seit dem 19. Jahrhundert anhebenden philosophischen Versuche, alles allein auf das Bewusstsein zu vereinen. Wobei es sich um eine Vorstellung handelt, die bereits mit Descartes’ Cogito ihren Anfang genommen hatte. Die hier in Variation aufgegriffene Vermögenslehre ist hingegen in subjekt- und persontheoretischer Hinsicht insofern eigens gewichtig, weil sie eine differenzierte und flexible Struktur zeigt, die von vorneherein bekundet, dass wir auf Pluralität, auf ein Zwischen hin angelegt sind, mehr noch: dass wir nur in diesem Zwischen auftauchen und zum Tragen kommen, was ich als Haltung bezeichnen würde und anderer Stelle eigens ausgearbeitet habe. Dies zusammen umschreibt einen holistischen Ansatz zur Interpersonalität bei Arendt. Erst in der Zusammenfügung der verschiedenen Modelle kann Arendt ihren Gedanken einer grundlegenden Interpersonalität der Person untermauern. Hierzu gehört auch der eigenartige Zusammenschluss von Weltferne und Weltzugewandtheit, der als Ambivalenz in verschiedenen Gewichtungen durch die drei geistigen Tätigkeiten hindurch dekliniert wird, an denen das interpersonale Potential der Person merklich hervorscheint. Insgesamt zeichnet sich so an den verschiedenen Vermögen das eingangs bemerkte unerwartete Verhältnis von Welthaftigkeit und Weltferne im Spätwerk ab. Der in den zunächst nur weltfern scheinenden Geistestätigkeiten vollzogene Selbstumgang scheint eine Bedingung für die verantwortliche Zuwendung zur Welt. Arendt zeigt damit im Grunde die Weltferne der geistigen Tätigkeiten in ihrem Wert für eine Welthaftigkeit auf. Darauf beruht auch die Autonomie der Geistestätigkeiten und letztlich die der Person in Gemeinschaft und gleichzeitig spielt dafür sowohl eine Indifferenz als auch eine Ambivalenz – je spezifisch – eine Rolle. In Bezug auf die eingangs gestellte grundlegende Frage, wie es sich mit den bloßen Bewusstseinsannahmen und Bewusstseinsstrukturen im Vergleich zu den Vermögenslehren, die tatsächlich in vielen Lexika als überholt gekennzeichnet werden, verhält, lässt sich vielleicht vorläufig Folgendes festhalten: Bewusstsein scheint leichter und einmütiger als vornehmlich rational, d.h. also noch nicht einmal als vernünftig, eingestuft. Und auch wenn dieser terme parapluie mittlerweile qua Bewusstseinspsychologie ebenso mit anderen Gehalten angereichert wird, bleibt doch diese rationale Prägung bestehen und auch das Bild eines geeinten Subjekts, das eher weniger mit einer offenen Subjektstruktur in ihren möglichen internen Widersprüchen gemein hat, die Arendt mit Denken, Wollen, Urteilen für Personen beschreibt. Diese Widersprüche gehören offenbar schon zum Leben des Geistes. Und Bewusstseinsphilosophie wäre aus Arendts Sicht vermutlich auch wieder ein – vielleicht eleganter – aber immer noch ein Weg, das Thema und das Problem des Wollens zu umgehen, also: sich der Freiheit und damit auch den ethisch-moralischen Fragen philosophisch und persönlich nicht zu stellen. Die Tätigkeiten-, Fähigkeiten- und Kraft-Modelle unserer menschlichen Existenz – plastisch geworden im Denken, Wollen, Urteilen – sind unverzichtbar für die eigene Verantwortlichkeit eines jeden. Das kantische Modell betont die Autonomie des Subjekts, während Montesquieus Konzept eher die juristische Person als einen Teil der Gemeinschaft perspektiviert. Beide zusammen kreieren die Konzeption einer Person, die „der Welt zugeeignet“ ist oder ihr offen gegenübersteht, wie bei Maurice Merleau-Ponty, den Arendt mehrfach in ihrem Spätwerk zitiert, und von dem sich ihre ‚Phänomenologie des Erscheinens‘ inspiriert zeigt.[34] So erweisen sich die Tätigkeiten als individualitäts- wie pluralitätsbefähigt, als Indizien für Pluralität wie Individualität. Und es bestätigt sich darin eine philosophische Tradition des Menschen als zoon politikon, die Arendt als kritisches und spezifisches Konzept ausarbeitet. Das Verhältnis zwischen Gemeinschaft und Einzelnem, das während der Kriegszeit grausam vom Totalitarismus infiltriert war, ist ein fragiles und bedarf des Schutzes und der Aufmerksamkeit. Autonomie selbst ist fragil und muss in unserem Denken, Wollen, Urteilen realisiert werden, eingedenk des gefühlsbasierten ästhetisch-reflektierenden Urteils, beinhaltet sie auch passive Elemente, wie die alltägliche Indifferenz als Teil des Urteilens oder das ambivalente Phänomen der Gedankenlosigkeit, das ebenfalls bestimmend für unser geistiges Leben sein kann. Arendt hebt mit einer differenzierten und flexiblen Struktur an und zeigt, dass wir sowohl zur Pluralität als auch zur Autonomie fähig sind, beide einander bedingen und wir uns zwischen ihnen befinden. Pluralität verbürgt in diesem Zusammenhang unsere Befähigung zur Interpersonalität, diskutiert im sensus communis, und Autonomie meint hier unsere spezifische Befähigung zur Eigenständig- bis Eigenwillig- und sogar Widerständigkeit, wenn nötig auch einmal gegen unsere Gemeinschaften. Beide Aspekte sind notwendig für Verantwortlichkeit: Relation besteht in Verbundenheit und Distanz, Übereinstimmung und Widerspruch. Nur in unseren Verhältnissen (halb gegeben, halb gemacht), in unseren Tätigkeiten zeigen wir uns als Person unter Personen. Es ist nicht nur jedes Urteil, ein in einer Gemeinschaft gefälltes, unser ganzes Leben ist so – und als solches ‚unvertretbar‘. Geistige Tätigkeiten sind für Arendt auch durch eine spezifische Distanz zur Welt gekennzeichnet – darin knüpft sie an die Tradition an. Bezüglich dieser latenten Weltferne unserer geistigen Tätigkeiten, zeigt Arendt paradoxer Weise ihre Relevanz für die Welt und unsere Welthaftigkeit. In dieser Struktur der Widersprüche, die gewiss zum Leben des Geistes gehören, liegt unsere Offenheit für die Welt begründet. Anmerkungen[1] Vgl. Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft. Werkausgabe Bd. X. Hrsg. v. Wilhelm Weischedel. Frankfurt a. M. 1974. Vgl. z. B. S. 229. B 163/ A 161. [Künftig zitiert: Kant: KdU.] [2] Pierre Bourdieu: La distinction. Critique sociale du jugement. Paris 1979. Dt. Ausg.: Ders.: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt a. M. 1992. [3] Diese Dimension taucht auch bei anderen Denkern auf, wie etwa bei Hannah Arendt in der Annahme einer ‚Urteilsgemeinschaft‘, dem Gedanken, dass man sich mit bestimmten Urteilen auch den Umgang mit bestimmten Personen wählt und ist bei Kant selbst angelegt, wie es der Text noch zeigen wird. Siehe auch Hannah Arendt: Das Urteilen. Texte zu Kants politischer Philosophie. Hrsg. v. Ronald Beiner. Aus dem Amerik. v. Ursula Ludz. München 1998. [Künftig zitiert: Arendt: Urteilen.] [4] Hannah Arendt: Vom Leben des Geistes. Bd. 1: Das Denken. Bd. 2: Das Wollen. Hrsg. v. Mary McCarthy. Aus dem Amerik. v. Hermann Vetter. München 1998. [Künftig zitiert: Arendt: Denken. Und: Arendt: Wollen.] [5] Freilich ist es nicht nur das Gefühl, auf das sich das ästhetische Urteil stützt, sondern auch die Regel und daher ein Fall für die Urteilskraft. Vgl. Kants Einleitung in der ersten Fassung. S. Kant: KdU. S. 39. [6] Vgl. z.B. Kant: KdU. S. 226. B 158f / A 156f. [7] Siehe zum gesamten Zusammenhang auch meine Studien zur Haltung, z.B. Frauke A. Kurbacher: Zwischen Personen. Eine Philosophie der Haltung. Würzburg 2017. Oder dies.: „Interpersonalität zwischen Autonomie und Fragilität. Grundzüge einer Philosophie der Haltung“. In: Was ist Haltung? Begriffsbestimmungen, Positionen, Anschlüsse. Hrsg. v. Frauke A. Kurbacher u. Philipp Wüschner. Würzburg 2016. S. 145-162. [8] Die Meinungen der Forschung gehen hier bis heute auseinander. Siehe auch meinen Artikel zu Arendts Spätwerk im Arendt-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Hrsg. v. Wolfgang Heuer, Bernd Heiter u. Stefanie Rosenmüller. Stuttgart/Weimar 2011. S. 124.132. [9] Siehe auch die triftige Studie zu Arendt wie zur Urteilskraft von Ernst Vollrath: Die Rekonstruktion der politischen Urteilskraft. Stuttgart 1977. [10] Diesem Beitrag liegt in weiten Teilen eine Überarbeitung und Rückübersetzung meines Aufsatzes: „The Power of Judging – or How to Distinguish ‚Indifference‘ in Kant and Arendt. Some Critical Notes on the Structure of Activities“. In: Estudos Iberoamericanos. Hrsg. v. Wolfgang Heuer u.a. Porto Alegre, Dez. 2017 zugrunde. [11] Vgl. Arendt: Denken. S. 13-17. [12] Siehe Arendt: Denken. S. 14. [13] Arendt: Denken. S. 15. [14] Siehe Arendt: Denken. S. 16. Hier erweitert sie wissen- und willentlich die Frage über den Rahmen des Ethischen hinaus. [15] Arendt: Denken. S. 14. [16] Ebd. [17] Ebd. [18] Wiewohl auch andere – wie etwa Adorno und Mitstreiter der Frankfurter Schule in den Studien zum autoritären Charakter in ihrer Aussageweite ähnlich gelagerte Untersuchungen und Konstatierungen vornehmen. [19] Arendt: Denken. S. 14. [20] Vgl. Arendt: Wollen. S. 371. [21] Arendt: Wollen. S. 360. [22] Ebd. S. 361. [23] Ebd. [24] Siehe hierzu auch meine diversen Studien zur Urteilskraft, zum Urteilen und zu Kant; exemplarisch: Frauke A. Kurbacher: Selbstverhältnis und Weltbezug. Urteilskraft in existenz-hermeneutischer Perspektive. Würzburg 2005. [25] Kant: KdU. S. 227. B 160 / A 158. [26] Ebd. [27] Arendt: Denken. S. 81. [28] Jean Starobinski: Montesquieu. Ein Essay. Aus dem Franz. v. Ulrich Raulff. Mit ausgewählten Lesestücken. München/Wien 1991. S. 10 u. S. 20. [29] Siehe Montesquieu: Vom Geist der Gesetze. Buch II, Kap. 4. In: Montesquieu: Vom Geist der Gesetze. 2 Bde. In neuer Übertragung eingeleitet u. hrsg. v. Ernst Forsthoff. Leipzig 1951. Hier Bd. 1, Buch II, 4. Kap., S. 29: „Ich bin durchaus nicht auf die Vorrechte der Geistlichen versessen, aber ich wünschte doch, daß man endlich einmal den Umfang ihrer Gerichtsbarkeit genau begrenzte. Es handelt sich nicht darum zu wissen, ob man recht daran tat, sie einzuführen, sondern ob sie zu Recht besteht, ob sie einen Teil der Gesetze des Landes ausmacht und ob sie ihnen durchaus entspricht; ob nicht zwischen zwei als unabhängig voneinander anerkannten Mächten alle Beziehungen auf Gegenseitigkeit beruhen müssen, und ob [Hervorhebung von der Autorin] es einem guten Untertan nicht gleichviel gilt, die Gerichtsbarkeit des Fürsten oder die Grenzen zu verteidigen, die ihr von jeher gezogen waren.“ Aber zuvor heißt es auch: „Man schaffe in einer Monarchie die Vorrechte der Großen, der Geistlichkeit, des Adels und der Städte ab, dann wird man bald einen Volksstaat oder gar einen despotischen Staat haben. [Absatz] Die Gerichtshöfe eines großen europäischen Staates rütteln seit mehreren Jahrhunderten unaufhörlich an der Patrimonialgerichtsbarkeit der weltlichen und geistlichen Herren. Wir wollen so weise Behörden nicht rügen, möchten aber doch zur Entscheidung stellen, bis zu welchem Grade dadurch die Verfassung geändert werden kann. [Absatz] Ich bin durchaus nicht auf die Vorrechte der Geistlichen versessen, aber ich wünschte doch, daß man endlich einmal den Umfang ihrer Gerichtsbarkeit genau begrenzte.“ (ebd.) [30] Vgl. Arendt: Wollen. S. 371. [31] Immanuel Kant: Metaphysik der Sitten. Werkausgabe Bd. VIII. Hrsg. v. Wilhelm Weischedel. Frankfurt a. M. 1977. § 48. [32] Das aber mit Derrida gedacht, auch eine Reflexion auf die Begründung seiner Gültigkeit provoziert. Siehe Jacques Derrida: Force de loi. Le fondement ‚mystique de l’autorité‘. Paris 1994. Dt. Ausg. ders.: Gesetzeskraft oder der ‚mystische Grund der Autorität‘. Frankfurt a. M. 1996. [33] Vgl. Arendt: Denken. S. 30. [34] Siehe Maurice Merleau-Ponty: Phénoménologie de la perception. Paris 1945. S. 11. Phänomenologie der Wahrnehmung. 6. Aufl. Berlin 1977. S. 7. |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/113/fk16.htm |

 Als eines der schlimmsten ethischen Szenarien – mehr noch als Unmoral oder Amoral – gilt schon den Denkern ferner Epochen moralische Indifferenz. Moralisch ungreifbar und nicht positioniert zu sein – dies erscheint als der bedenklichste Fall. In ihrem Spätwerk Vom Leben des Geistes
Als eines der schlimmsten ethischen Szenarien – mehr noch als Unmoral oder Amoral – gilt schon den Denkern ferner Epochen moralische Indifferenz. Moralisch ungreifbar und nicht positioniert zu sein – dies erscheint als der bedenklichste Fall. In ihrem Spätwerk Vom Leben des Geistes