Erfahrungen mit dem Reformationsjubiläum. Ein Essay
Wolfgang Vögele
1.
 Mein erstes persönliches Luther-Jahr feierte ich 1973 oder 1974, die genaue Jahreszahl lässt sich nicht mehr ermitteln. Jedenfalls war ich zwölf oder dreizehn Jahre alt. Ich hatte einen Großonkel, der als Pfarrer in einer Gemeinde im Siegerland arbeitete. Alle halbe Jahre schickte er mir ein Paket mit Büchern und Traktaten, denn er stand dem Siegerländer Pietismus nahe. Die Pakete enthielten Bekehrungstraktate, denen ich wenig Beachtung schenkte. Darunter fanden sich die Romane Jörg Erbs, Geschichten von Landsknechten aus dem Dreißigjährigen Krieg, in denen König Gustav Adolf, seine schwedischen Kompanien und andere Lutheraner gegen die bösen Katholiken kämpften. Das fand ich zwar nicht ganz so spannend wie Sir Francis Drake, Lord Hornblower oder Robin Hood, aber doch spannend genug, um diese Bücher nachts unter der Bettdecke zu lesen.
Mein erstes persönliches Luther-Jahr feierte ich 1973 oder 1974, die genaue Jahreszahl lässt sich nicht mehr ermitteln. Jedenfalls war ich zwölf oder dreizehn Jahre alt. Ich hatte einen Großonkel, der als Pfarrer in einer Gemeinde im Siegerland arbeitete. Alle halbe Jahre schickte er mir ein Paket mit Büchern und Traktaten, denn er stand dem Siegerländer Pietismus nahe. Die Pakete enthielten Bekehrungstraktate, denen ich wenig Beachtung schenkte. Darunter fanden sich die Romane Jörg Erbs, Geschichten von Landsknechten aus dem Dreißigjährigen Krieg, in denen König Gustav Adolf, seine schwedischen Kompanien und andere Lutheraner gegen die bösen Katholiken kämpften. Das fand ich zwar nicht ganz so spannend wie Sir Francis Drake, Lord Hornblower oder Robin Hood, aber doch spannend genug, um diese Bücher nachts unter der Bettdecke zu lesen.
Mein Lutherjahr begann damit, dass mir dieser Onkel ein Luther-Buch[1] von Hanns Lilje schenkte, einen dicken, in dunkelgrünes Leinen gebundenen Band mit vielen schwarz-weißen Abbildungen. Ich war skeptisch, aber ich begann, darin zu blättern und später auch zu lesen. Mir ist nicht mehr in Erinnerung ob ich das Buch von Anfang bis Ende gelesen habe. Der Name Hanns Liljes sagte mir damals gar nichts. Aber dieser Band vermittelte mir die erste Begegnung mit Martin Luther: der Kämpfer für die Freiheit, gegen den kaiserlichen Frühkapitalismus, gegen die katholischen Ablasshändler, für eine neue Gerechtigkeit. Er kämpfte nicht als Ritter mit Schwert, Lanze und Schild, dafür gab es im 16. Jahrhundert schon zu viele Musketen. Ich hatte pubertierend sagen wir: einen guten Eindruck von dem Mann. Nicht ganz wie Robin Hood, leider ohne Bogen und Pfeile, aber doch in jedem Fall ein Kämpfer für eine gerechte Sache. Der Gedanke an ein Theologiestudium lag mir damals sehr ferne. Der Vierzehnjährige, der ich damals war, bemerkte nicht den großen Denkmalssockel, auf den Bischof Lilje den Reformator stellte. Auf ihm stehend, ragte er für den Abt von Loccum mitten hinein in die damalige Wirklichkeit seiner Kirche. Auch wenn ich heute weiß, dass dieses Lutherbild von Projektionen und Idealisierungen geprägt war, mich hat es beeinflusst und ich bin – mit Unterbrechungen – bei der Sache der Theologie geblieben.
 Ich habe mit dieser autobiographischen Erinnerung begonnen, um die subjektive Perspektive dieses Essays deutlich zu machen. In jedem Fall wollte ich die Feldherrnpose des Jubiläumsstrategen und die Beobachtungspose des theologischen Großkritikers zu vermeiden, wobei aber nicht gesagt sein soll, dass sich mit einer subjektiven Betrachtungsweise alle Kritik an Kitsch und Banalität des Reformationsjubiläums auflöst. Viele Protestanten haben ein merkwürdig masochistisches Verhältnis zur Kritik: Entweder sie nehmen sie nicht wahr, um sie dann unausgesprochen umso größer werden zu lassen. Oder sie tun so, als nähmen sie sie nicht ernst, weil sie sie in Wahrheit näher an sich herangelassen haben als ihnen gut tut. Im allerschlimmsten Fall wird Kritik als „Wertschätzung“ schön geredet. Die zynische Nebenbedeutung dieses Begriffs als Taxieren, Untersuchen, als Abschätzen des (Gebrauchs-)Wertes einer Person bleibt in jedem Fall unberücksichtigt.
Ich habe mit dieser autobiographischen Erinnerung begonnen, um die subjektive Perspektive dieses Essays deutlich zu machen. In jedem Fall wollte ich die Feldherrnpose des Jubiläumsstrategen und die Beobachtungspose des theologischen Großkritikers zu vermeiden, wobei aber nicht gesagt sein soll, dass sich mit einer subjektiven Betrachtungsweise alle Kritik an Kitsch und Banalität des Reformationsjubiläums auflöst. Viele Protestanten haben ein merkwürdig masochistisches Verhältnis zur Kritik: Entweder sie nehmen sie nicht wahr, um sie dann unausgesprochen umso größer werden zu lassen. Oder sie tun so, als nähmen sie sie nicht ernst, weil sie sie in Wahrheit näher an sich herangelassen haben als ihnen gut tut. Im allerschlimmsten Fall wird Kritik als „Wertschätzung“ schön geredet. Die zynische Nebenbedeutung dieses Begriffs als Taxieren, Untersuchen, als Abschätzen des (Gebrauchs-)Wertes einer Person bleibt in jedem Fall unberücksichtigt.
2.
 Im Jubiläumsjahr 2017 haben Protestantismus, Politik, Kunst und Kultur Luther gefeiert, und ich will gar nicht erst den Versuch machen, den ganzen Wust aus Luther-Büchern, Luther-Oratorien, Luther-Devotionalien, Luther-Ausstellungen und Luther-Denkschriften im Überblick abzuschreiten. Es ist einfach nicht möglich, und deswegen werde ich mich auf persönliche Beobachtungen und Erfahrungen beschränken. Kritiker, Gegner, Befürworter, Fans tragen im Moment alle ihre Indizien zusammen, und in der unübersichtlichen Menge von Gelegenheiten finden alle diejenigen Details, die sie für ihre Argumente benötigen. Luther ist Projektionsfläche, und jedem steht es frei, ihn zum wiederholten Mal mit Argumenten zu verbrennen oder ihn zum wiederholten Mal auf den Denkmalsockel zu stellen und ins Monumentale zu vergrößern. Noch fünfhundert Jahre nach dem Thesenanschlag löst der Reformator eine ganze Menge von Emotionen aus, die ein ausgewogenes, abwägendes Urteil eher behindern als fördern.
Im Jubiläumsjahr 2017 haben Protestantismus, Politik, Kunst und Kultur Luther gefeiert, und ich will gar nicht erst den Versuch machen, den ganzen Wust aus Luther-Büchern, Luther-Oratorien, Luther-Devotionalien, Luther-Ausstellungen und Luther-Denkschriften im Überblick abzuschreiten. Es ist einfach nicht möglich, und deswegen werde ich mich auf persönliche Beobachtungen und Erfahrungen beschränken. Kritiker, Gegner, Befürworter, Fans tragen im Moment alle ihre Indizien zusammen, und in der unübersichtlichen Menge von Gelegenheiten finden alle diejenigen Details, die sie für ihre Argumente benötigen. Luther ist Projektionsfläche, und jedem steht es frei, ihn zum wiederholten Mal mit Argumenten zu verbrennen oder ihn zum wiederholten Mal auf den Denkmalsockel zu stellen und ins Monumentale zu vergrößern. Noch fünfhundert Jahre nach dem Thesenanschlag löst der Reformator eine ganze Menge von Emotionen aus, die ein ausgewogenes, abwägendes Urteil eher behindern als fördern.
Ich habe in den vergangenen Jahren ein paar Dutzend Vorträge über die Reformation gehalten und dabei folgende Erfahrungen gemacht. Vorträge über die Bekenntnisschriften[2], Augsburger Konfession, Heidelberger Katechismus, Leuenberger Konkordie stießen beim gebildeten Publikum auf verständnislose Blicke und Ratlosigkeit, selbst dann, wenn ich nach den ersten Erfahrungen mit Vorträgen zu diesem Thema alles so einfach wie möglich erklärte. Aber Melanchthons subtiler letzter Gesprächsversuch mit der traditionellen Kirche beim Reichstag von Augsburg war schwierig zu vermitteln. Dass die daraus resultierende Schrift, die Confessio Augustana heute noch als Bekenntnisschrift zu den normativen Texten der meisten Landeskirchen gehört, rief Erstaunen hervor. Dass weitere normative Schriften, der Kleine Katechismus Luthers und der Heidelberger Katechismus hinzukamen und bis heute gelten und sich gegenseitig interpretieren, das verwunderte viele. Mit dem Gegensatz zwischen reformierter und lutherischer Konfession können viele Zuhörer nichts mehr anfangen, die Feinheiten der Abendmahls-, der Providenz- und der Rechtfertigungslehre werden sehr schnell als ewiggestrig und irrelevant abgetan. Dass sich das reformatorische Bekenntnis weiter entwickelte über die Unionen des 19. Jahrhunderts bis zur Leuenberger Erklärung von 1973, wurde sehr rasch als reine Theologenspezialität abgetan, trotz meiner immer intensiveren Bemühungen, die theologische Bekenntnisdebatte in ihrer Gegenwartsbedeutung so elementar wie möglich darzustellen.
3.
 Auf sehr viel mehr Interesse stießen dagegen Vorträge, die anknüpften an den – horribile dictu – touristischen Orten, an denen Reformation sichtbar wird. Allein in Baden-Württemberg sind die Tourismusbehörden mit solchen Orten und Stätten nicht gesegnet. Von der wichtigen Heidelberger Disputation 1518 ist nicht viel mehr geblieben als eine runde Bodenplatte, die doch eher an einen Gullydeckel erinnert. Heidelberger Theologiestudenten, denen die kirchengeschichtliche Bedeutung vertraut sein müsste, laufen achtlos über die Platte hinweg. Die Reformation war eher intellektuelles als architektonisches Ereignis, und die Luther-Denkmäler gehören ins 19. Jahrhundert mit seinem monumentalen, heroischen und auch deutschnationalen Lutherbild. Sieht man einmal von den Wittenberger, Eisenacher biographischen Gedenkstätten ab, so bleibt vieles an der Reformation in unserer Gegenwart architektonisch unsichtbar. Wer zum Beispiel in Basel nach den Spuren Erasmus von Rotterdams sucht, der wird feststellen, dass die Häuser, in denen er wohnte, und die Verlagshäuser und Druckereien, denen er seine Werke lieferte, zumeist bei Bränden oder anderen Katastrophen zerstört worden sind. Trotzdem waren in Basel zwei außerordentlich originelle Ausstellungen zu sehen, die eine im Münster, die andere in der Barfüßerkirche, dem Stadtmuseum Basels. Die zweite Ausstellung arbeitete sehr überzeugend nicht mit Ausstellungsräumen, sondern mit Exponaten, die über die Standardsammlung des Museums verteilt waren. Insofern wurde Erasmus‘ Lebensgeschichte in die Baseler Stadtgeschichte integriert. Die Besucher erhielten einen Tabletcomputer, auf dem sie sich die entsprechenden biographischen Zusammenhänge anschaulich machen konnten.
Auf sehr viel mehr Interesse stießen dagegen Vorträge, die anknüpften an den – horribile dictu – touristischen Orten, an denen Reformation sichtbar wird. Allein in Baden-Württemberg sind die Tourismusbehörden mit solchen Orten und Stätten nicht gesegnet. Von der wichtigen Heidelberger Disputation 1518 ist nicht viel mehr geblieben als eine runde Bodenplatte, die doch eher an einen Gullydeckel erinnert. Heidelberger Theologiestudenten, denen die kirchengeschichtliche Bedeutung vertraut sein müsste, laufen achtlos über die Platte hinweg. Die Reformation war eher intellektuelles als architektonisches Ereignis, und die Luther-Denkmäler gehören ins 19. Jahrhundert mit seinem monumentalen, heroischen und auch deutschnationalen Lutherbild. Sieht man einmal von den Wittenberger, Eisenacher biographischen Gedenkstätten ab, so bleibt vieles an der Reformation in unserer Gegenwart architektonisch unsichtbar. Wer zum Beispiel in Basel nach den Spuren Erasmus von Rotterdams sucht, der wird feststellen, dass die Häuser, in denen er wohnte, und die Verlagshäuser und Druckereien, denen er seine Werke lieferte, zumeist bei Bränden oder anderen Katastrophen zerstört worden sind. Trotzdem waren in Basel zwei außerordentlich originelle Ausstellungen zu sehen, die eine im Münster, die andere in der Barfüßerkirche, dem Stadtmuseum Basels. Die zweite Ausstellung arbeitete sehr überzeugend nicht mit Ausstellungsräumen, sondern mit Exponaten, die über die Standardsammlung des Museums verteilt waren. Insofern wurde Erasmus‘ Lebensgeschichte in die Baseler Stadtgeschichte integriert. Die Besucher erhielten einen Tabletcomputer, auf dem sie sich die entsprechenden biographischen Zusammenhänge anschaulich machen konnten.
 Auf das größte Interesse stießen Vorträge zum Thema des Glockenläutens in der Reformation und in der Gegenwart[3]. Glocken atmen noch jene Anschaulichkeit, die abstrakten theologischen Themen wie der Rechtfertigungs- und der Zweinaturenlehre fehlt. Nun waren Glocken kein zentrales Thema der Reformation, aber die Kirchenreformer des 16. Jahrhunderts versuchten sich dennoch an einigen Veränderungen (Türkenläuten, Angelusläuten, Wetterläuten), mit denen sie auf den Widerstand der Gemeinden stießen. Beim Glockenläuten werden wie bei wenigen anderen Themen die Unterschiede zwischen 21. und 16. Jahrhundert deutlich. Gleich ob Katholiken oder Protestanten, die Menschen des 16. Jahrhunderts benötigten die Glocken und das damit verbundene kommunale Informationssystem für ihre kurz- und langfristige Zeitorganisation. Deswegen wollten sie unbedingt in der Nähe von Glocken wohnen, damit sie von diesem Informationssystem nicht abgeschnitten waren. Mit der Entwicklung von Taschen- und Armbanduhren im 19. Jahrhundert, mit der Entwicklung der Lärm- und Geräuschkultur der Moderne, vom Verkehr bis zur Sirene, schließlich mit den Smartphones der digitalen Kultur der Gegenwart ist dieses an Glocken gebundene Gemeindeinformationssystem zusammengebrochen, auch wenn man sich eine Kirche ohne Glocken immer noch schwer vorstellen kann. Am Thema Glocken kann man die historischen Unterschiede deutlich machen, übrigens auch am Predigen. Denn Glocken läuteten im 16. Jahrhundert häufig zu Beginn und am Ende der Predigt, und die Kirchenreformer des 16. Jahrhunderts mussten die Pfarrer häufig ermahnen, nicht über neunzig Minuten zu predigen, und zwar pro Sonntag in zwei verschiedenen Gottesdiensten. Wer einmal die Beschwerden von Gottesdienstbesuchern ertragen musste, weil eine Predigt wenig über eine Viertelstunde dauerte, dem stehen die Unterschiede zwischen 16. und 21. Jahrhundert lebendig vor Augen.
Auf das größte Interesse stießen Vorträge zum Thema des Glockenläutens in der Reformation und in der Gegenwart[3]. Glocken atmen noch jene Anschaulichkeit, die abstrakten theologischen Themen wie der Rechtfertigungs- und der Zweinaturenlehre fehlt. Nun waren Glocken kein zentrales Thema der Reformation, aber die Kirchenreformer des 16. Jahrhunderts versuchten sich dennoch an einigen Veränderungen (Türkenläuten, Angelusläuten, Wetterläuten), mit denen sie auf den Widerstand der Gemeinden stießen. Beim Glockenläuten werden wie bei wenigen anderen Themen die Unterschiede zwischen 21. und 16. Jahrhundert deutlich. Gleich ob Katholiken oder Protestanten, die Menschen des 16. Jahrhunderts benötigten die Glocken und das damit verbundene kommunale Informationssystem für ihre kurz- und langfristige Zeitorganisation. Deswegen wollten sie unbedingt in der Nähe von Glocken wohnen, damit sie von diesem Informationssystem nicht abgeschnitten waren. Mit der Entwicklung von Taschen- und Armbanduhren im 19. Jahrhundert, mit der Entwicklung der Lärm- und Geräuschkultur der Moderne, vom Verkehr bis zur Sirene, schließlich mit den Smartphones der digitalen Kultur der Gegenwart ist dieses an Glocken gebundene Gemeindeinformationssystem zusammengebrochen, auch wenn man sich eine Kirche ohne Glocken immer noch schwer vorstellen kann. Am Thema Glocken kann man die historischen Unterschiede deutlich machen, übrigens auch am Predigen. Denn Glocken läuteten im 16. Jahrhundert häufig zu Beginn und am Ende der Predigt, und die Kirchenreformer des 16. Jahrhunderts mussten die Pfarrer häufig ermahnen, nicht über neunzig Minuten zu predigen, und zwar pro Sonntag in zwei verschiedenen Gottesdiensten. Wer einmal die Beschwerden von Gottesdienstbesuchern ertragen musste, weil eine Predigt wenig über eine Viertelstunde dauerte, dem stehen die Unterschiede zwischen 16. und 21. Jahrhundert lebendig vor Augen.
4.
 Dieser Abstand zwischen damals und heute scheint mir ein entscheidender Punkt. Wer ihn einfach überspringt (siehe Luther-Oratorium, siehe Luther-Socken etc. pp.), der landet hart auf dem Boden der Banalität. Der historische und der gegenwärtige Martin Luther driften auseinander.
Dieser Abstand zwischen damals und heute scheint mir ein entscheidender Punkt. Wer ihn einfach überspringt (siehe Luther-Oratorium, siehe Luther-Socken etc. pp.), der landet hart auf dem Boden der Banalität. Der historische und der gegenwärtige Martin Luther driften auseinander.
Der Ratsvorsitzende der EKD sagte in einem Interview zum Reformationstag 2017 einen sehr merkwürdigen Satz: „Man darf Luther weder historisieren noch funktionalisieren.“[4] Ich bin der Meinung, an der Historisierung und folgend an der Kontextualisierung Martin Luthers in seine Zeit, an der Herausarbeitung der Unterschiede zur Moderne, geht überhaupt kein Weg vorbei. Die Theologie Luthers muss so präsentiert werden, dass sie aus den damaligen Umständen, ihren kirchenpolitischen und außenpolitischen, ihren innerstädtischen Kontroversen erklärt wird. Erst die Erkenntnis des fremden Luther des 16. Jahrhunderts bildet die Voraussetzung, um das entwickeln, was man wirklich eine lutherische Theologie der Moderne nennen könnte. Vor dem Kurzschluss zwischen Luthers Theologie und der Moderne ist zu warnen. Man kann die Weimarer Ausgabe der Schriften Luthers nicht einfach zum Maßstab für die Gegenwart zu nehmen. Ich werde stets misstrauisch bei dem Versuch, Luthers Theologie als ein Bollwerk gegen die Moderne zu entfalten. Wiederum die Bekenntnisschriften und ihre Entwicklung in entscheidenden Topoi (Abendmahlslehre, Lehre von Kirche und Staat, Christologie) zeigen, dass sich der europäische Protestantismus hier weiter entwickelt hat. Das gilt für die Unionsbildung im 19. Jahrhundert, die bekenntnistheologisch noch nie richtig ernst genommen worden ist. Das gilt für die Barmer Theologische Erklärung, die nun auch von lutherischen Kirchen als Bekenntnisschrift ernst genommen wird. Das gilt für die Leuenberger Erklärung mit ihrer Relativierung der historischen und theologischen Streitigkeiten aus dem 16. Jahrhundert.
 Der historische Luther, der der Moderne in seinen antijüdischen und antiislamischen Tiraden, auch in seinem Grobianismus fremd geworden ist, und die Aufgabe einer lutherischen, gegenwartstauglichen Theologie sind auseinanderzuhalten. Lutherische Theologie ist nicht einfach die antimoderne Revitalisierung der Theologie Martin Luthers. Insofern sind – trotz Jubiläum – zwei Dinge auseinanderzuhalten, nämlich die Frage nach der historischen und theologiehistorischen Bedeutung Martin Luthers und deren Kontextualisierung sowie die Frage nach dem Selbstverständnis des nicht deutschen, sondern europäischen Protestantismus in der Gegenwart. Letzteres scheint mir doch das zu sein, was die meisten Kritiker und Befürworter des Jubiläums eigentlich beschäftigt. Der deutsche Protestantismus hält den Vergleich mit der katholischen Weltkirche, so problematisch diese sein mag, nicht aus. Man hat sich zu lange mit den volkskirchlichen Verhältnissen der siebziger und achtziger Jahre zufrieden gegeben, hielt diese für den klügsten Schluss ekklesiologischer Glaubensweisheit und wundert sich nun, dass auch das gefeierte, kirchen- und staatstragende Jubiläum die Renovationsbedürftigkeit der Landeskirchen nicht überdecken kann. Man weiß, dass man längst den praktisch-theologischen TÜV hätte aufsuchen sollen. In den fünfziger Jahren suchte man Hilfe bei einer strengen Wort-Gottes-Theologie, die allen Kulturprotestantismus ausmerzen wollte, danach kamen ab den Sechzigern die Religionssoziologen mit ihren Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen an die Reihe, schließlich in den Neunzigern die Journalisten, welche die evangelische Botschaft ohne die Sprache Kanaans „rüber“ bringen wollten und schließlich in der jüngsten Zeit die Marketingleute, deren Plakate, Gimmicks, Apps und Hochglanzbroschüren sich nicht lange mit Theologie und Kirchengeschichte aufhalten. Alle diese Reparaturanstrengungen führten zu keinem positiven Ergebnis, und das Fehlen davon sorgte und sorgt uneingestanden bei den Funktionären der Landeskirchen für erhebliche Verunsicherung. Die Konsistorien und Oberkirchenräte finden sich in der Rolle von austherapierten, schwerkranken Patienten, die nach dem vergeblichen Versuch, die Schulmedizin zu konsultieren, nun mit alternativen Heilungsmethoden liebäugeln.
Der historische Luther, der der Moderne in seinen antijüdischen und antiislamischen Tiraden, auch in seinem Grobianismus fremd geworden ist, und die Aufgabe einer lutherischen, gegenwartstauglichen Theologie sind auseinanderzuhalten. Lutherische Theologie ist nicht einfach die antimoderne Revitalisierung der Theologie Martin Luthers. Insofern sind – trotz Jubiläum – zwei Dinge auseinanderzuhalten, nämlich die Frage nach der historischen und theologiehistorischen Bedeutung Martin Luthers und deren Kontextualisierung sowie die Frage nach dem Selbstverständnis des nicht deutschen, sondern europäischen Protestantismus in der Gegenwart. Letzteres scheint mir doch das zu sein, was die meisten Kritiker und Befürworter des Jubiläums eigentlich beschäftigt. Der deutsche Protestantismus hält den Vergleich mit der katholischen Weltkirche, so problematisch diese sein mag, nicht aus. Man hat sich zu lange mit den volkskirchlichen Verhältnissen der siebziger und achtziger Jahre zufrieden gegeben, hielt diese für den klügsten Schluss ekklesiologischer Glaubensweisheit und wundert sich nun, dass auch das gefeierte, kirchen- und staatstragende Jubiläum die Renovationsbedürftigkeit der Landeskirchen nicht überdecken kann. Man weiß, dass man längst den praktisch-theologischen TÜV hätte aufsuchen sollen. In den fünfziger Jahren suchte man Hilfe bei einer strengen Wort-Gottes-Theologie, die allen Kulturprotestantismus ausmerzen wollte, danach kamen ab den Sechzigern die Religionssoziologen mit ihren Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen an die Reihe, schließlich in den Neunzigern die Journalisten, welche die evangelische Botschaft ohne die Sprache Kanaans „rüber“ bringen wollten und schließlich in der jüngsten Zeit die Marketingleute, deren Plakate, Gimmicks, Apps und Hochglanzbroschüren sich nicht lange mit Theologie und Kirchengeschichte aufhalten. Alle diese Reparaturanstrengungen führten zu keinem positiven Ergebnis, und das Fehlen davon sorgte und sorgt uneingestanden bei den Funktionären der Landeskirchen für erhebliche Verunsicherung. Die Konsistorien und Oberkirchenräte finden sich in der Rolle von austherapierten, schwerkranken Patienten, die nach dem vergeblichen Versuch, die Schulmedizin zu konsultieren, nun mit alternativen Heilungsmethoden liebäugeln.
5.
 Sehr deutlich wurde dieser Gegensatz zwischen historischer Werkstatt und Identitätsfindung an der Kabale, die sich die Leitung der EKD mit einigen systematischen Theologen und Kirchenhistorikern lieferte. Aber dieser (Kirchen-)Historikerstreit, der schnell aufgebauscht wurde, versandete auch genauso schnell wieder, ohne dass die notwendigen Differenzierungsleistungen in die Debatte eingebracht worden wären. Man hatte den offensichtlichen Eindruck, hier wurden persönliche Animositäten ausgetragen, und die sachliche Klärung des schwierigen Verhältnisses von Theologie und Kirchenleitung[5] blieb aus. Beide Seiten konnten ja auch wohlfeile Beispiele publik machen. Und irgendwie kann man froh sein, dass die Jubiläumsparade des Protestantismus sicherlich nicht aus Hannover, nicht aus Göttingen oder München gesteuert wurde. Ich kann das im Übrigen zum Beispiel nicht so schlimm finden, dass man einen Juristen und Intellektuellen, der der katholischen Kirche angehört, zum Vorsitzenden einer der Jubiläumskommissionen machte.
Sehr deutlich wurde dieser Gegensatz zwischen historischer Werkstatt und Identitätsfindung an der Kabale, die sich die Leitung der EKD mit einigen systematischen Theologen und Kirchenhistorikern lieferte. Aber dieser (Kirchen-)Historikerstreit, der schnell aufgebauscht wurde, versandete auch genauso schnell wieder, ohne dass die notwendigen Differenzierungsleistungen in die Debatte eingebracht worden wären. Man hatte den offensichtlichen Eindruck, hier wurden persönliche Animositäten ausgetragen, und die sachliche Klärung des schwierigen Verhältnisses von Theologie und Kirchenleitung[5] blieb aus. Beide Seiten konnten ja auch wohlfeile Beispiele publik machen. Und irgendwie kann man froh sein, dass die Jubiläumsparade des Protestantismus sicherlich nicht aus Hannover, nicht aus Göttingen oder München gesteuert wurde. Ich kann das im Übrigen zum Beispiel nicht so schlimm finden, dass man einen Juristen und Intellektuellen, der der katholischen Kirche angehört, zum Vorsitzenden einer der Jubiläumskommissionen machte.
Schon vor dem Jubiläumsjahr, im Jahr 2014, erschien ein Papier, das die Gegenwartsbedeutung der Reformation unter dem Titel „Rechtfertigung und Freiheit“[6] erhellen wollte. Verantwortet von der theologischen Kammer der EKD, akzentuierte es eine Glaubenstheologie, die unter den Stichworten Rechtfertigung und Freiheit die Gegenwartsbedeutung der Theologie Luthers in eine Mischung aus Werten, Orientierungen und besonderer evangelischer Spiritualität legte. Dabei hielt sich das Papier nicht groß mit der Tatsache auf, dass diese Mischung aus der Lebenswelt Luthers abstrahiert und von dort vergleichsweise unmittelbar in die Gegenwart transponiert wurde. Aber immerhin war das ein Versuch, der eine gründlichere Diskussion verdient gehabt hätte. Und ich weise nochmals auf meine Erfahrungen als Reformationsvortragender hin. Vor einem Publikum, in dem nur wenige sitzen, die eine theologische Ausbildung haben oder kirchlich sozialisiert wurden, wirkt die Schilderung solcher Kontroversen merkwürdig bis weltfremd. Mir läge an einer Theologie, die solche Weltfremdheit gerade vermeidet. Um es auf eine Formel zu bringen: Mehr Reformation, mehr Verantwortung! Weniger „Kirche der Freiheit“.
6.
 Es ist auch ein Wort zu sagen über die Ökumene und den großen Wunsch mindestens nach ökumenischer Gastfreundschaft beim Abendmahl[7]. Ich will dazu zwei Bemerkungen machen. Zuerst ist mir der Optimismus fremd, den protestantische Offizielle in Bezug auf den kommenden ökumenischen Kirchentag verbreiten. Ich frage, warum einige so tun, als müsse spätestens dann die gegenseitige Einladung zum Abendmahl, wenn nicht gar eine gemeinsame Abendmahlsfeier erfolgen. Ich sehe für einen solchen Optimismus keinen Grund, und die jüngsten Äußerungen von Kardinälen und Bischöfen der katholischen Kirche bestätigen das. Denn die gegenseitige Einladung zu Abendmahl oder Eucharistie ist ja kein ausschließlich ökumenisches Thema, sondern eine solche Einladung hätte auch innerkatholische Folgen: Die innerkatholischen Pragmatiker und Ökumeniker würden über die Konservativen und Traditionalisten triumphieren, und die katholische Kirche wäre vor eine interne Zerreißprobe gestellt. Auf der protestantischen Seite lässt sich ökumenische Gastfreundschaft allein mit Zweckoptimismus nicht herbeiführen.
Es ist auch ein Wort zu sagen über die Ökumene und den großen Wunsch mindestens nach ökumenischer Gastfreundschaft beim Abendmahl[7]. Ich will dazu zwei Bemerkungen machen. Zuerst ist mir der Optimismus fremd, den protestantische Offizielle in Bezug auf den kommenden ökumenischen Kirchentag verbreiten. Ich frage, warum einige so tun, als müsse spätestens dann die gegenseitige Einladung zum Abendmahl, wenn nicht gar eine gemeinsame Abendmahlsfeier erfolgen. Ich sehe für einen solchen Optimismus keinen Grund, und die jüngsten Äußerungen von Kardinälen und Bischöfen der katholischen Kirche bestätigen das. Denn die gegenseitige Einladung zu Abendmahl oder Eucharistie ist ja kein ausschließlich ökumenisches Thema, sondern eine solche Einladung hätte auch innerkatholische Folgen: Die innerkatholischen Pragmatiker und Ökumeniker würden über die Konservativen und Traditionalisten triumphieren, und die katholische Kirche wäre vor eine interne Zerreißprobe gestellt. Auf der protestantischen Seite lässt sich ökumenische Gastfreundschaft allein mit Zweckoptimismus nicht herbeiführen.
 Zweite Bemerkung: Zwar versichern mittlerweile katholische wie evangelische Ökumeniker, dass die theologischen Differenzen in der Abendmahlsfrage wie Opferverständnis, Realpräsenz, Abendmahl in beiderlei Gestalt, Amtsfrage und apostolische Sukzession ausgeräumt seien. Und dafür können sie einige überzeugende Argumente anführen. Aber es ist die Frage zu stellen, ob zum Beispiel ein strenges und nicht ökumenisch ermäßigtes Verständnis der Voraussetzung der Priesterweihe wirklich mit dem evangelischen Theorem vom Priestertum aller Gläubigen vereinbar ist. Das verbindet sich damit, dass in der offiziellen evangelischen Kirche über das theologische Verständnis des Abendmahls vorsichtig formuliert eine gewisse Unklarheit herrscht. Was die evangelische-katholische Ökumene angeht, so lehrt hier ein weiteres Mal die Leuenberger Erklärung den Umgang mit alten Streitigkeiten aus der Vergangenheit. Differenzen müssen theologisch neu bewertet werden, auch in den wichtigen Abendmahlsfragen.
Zweite Bemerkung: Zwar versichern mittlerweile katholische wie evangelische Ökumeniker, dass die theologischen Differenzen in der Abendmahlsfrage wie Opferverständnis, Realpräsenz, Abendmahl in beiderlei Gestalt, Amtsfrage und apostolische Sukzession ausgeräumt seien. Und dafür können sie einige überzeugende Argumente anführen. Aber es ist die Frage zu stellen, ob zum Beispiel ein strenges und nicht ökumenisch ermäßigtes Verständnis der Voraussetzung der Priesterweihe wirklich mit dem evangelischen Theorem vom Priestertum aller Gläubigen vereinbar ist. Das verbindet sich damit, dass in der offiziellen evangelischen Kirche über das theologische Verständnis des Abendmahls vorsichtig formuliert eine gewisse Unklarheit herrscht. Was die evangelische-katholische Ökumene angeht, so lehrt hier ein weiteres Mal die Leuenberger Erklärung den Umgang mit alten Streitigkeiten aus der Vergangenheit. Differenzen müssen theologisch neu bewertet werden, auch in den wichtigen Abendmahlsfragen.
7.
 Abseits von diesen offiziellen Debatten war das Jahr 2017 begleitet von der Publikation wunderbarer Bücher, aus denen ich außerordentlich viel gelernt habe. Ich zähle dazu, als Gegenentwurf zu Liljes Porträt des protestantisch-heroischen Luther die Biographie, welche die Kirchenhistorikern Lyndal Roper aus Cambridge verfasst hat[8]. Mit ihrem psychohistorischen Ansatz gelingt es ihr, vieles an Luthers Biographie aufzuhellen, das zuvor in den stärker theologischen Biographien unter den Tisch gefallen war. Ich zähle dazu den Band „Europa reformata“[9], herausgegeben von Michael Welker und Albert de Lange, der die Reformation als europäisches Netzwerk präsentiert und deswegen so zu loben ist, weil er ganz konsequent über den deutschen Tellerrand hinausblickt. Ich zähle dazu nicht zuletzt die Biographie Johann Sebastian Bachs, die der Dirigent John Eliot Gardiner vorgelegt hat[10]. Bach lebte zwar nicht im reformatorischen Jahrhundert, aber Gardiner kann zeigen, wie Bach von Kindheit an durch Schule und Elternhaus theologisch durch Luther und die Reformation geprägt wurde, selbst eine riesige Bibliothek mit den Werken der Reformation und ihrer Nachfolger besaß und schließlich, vor allem in seinen Kantaten und den Passionen eine durch Luther zutiefst geprägte geistliche Musik entwickelte, die noch heute nicht zu verstehen ist, wenn die geistigen Quellen missachtet werden, aus denen diese Musik lebt. Ich belasse es bei diesen drei Beispielen, wohl wissend, dass sehr viel mehr Bücher publiziert wurden, darunter auch solche, die keine Aufmerksamkeit verdienen. Aber auch das gehört zu einem solchen Jubiläum. Es ist gut, wenn man einige Bücher nicht gelesen, einige Ausstellungen nicht gesehen und einige Konferenzen nicht besucht hat.
Abseits von diesen offiziellen Debatten war das Jahr 2017 begleitet von der Publikation wunderbarer Bücher, aus denen ich außerordentlich viel gelernt habe. Ich zähle dazu, als Gegenentwurf zu Liljes Porträt des protestantisch-heroischen Luther die Biographie, welche die Kirchenhistorikern Lyndal Roper aus Cambridge verfasst hat[8]. Mit ihrem psychohistorischen Ansatz gelingt es ihr, vieles an Luthers Biographie aufzuhellen, das zuvor in den stärker theologischen Biographien unter den Tisch gefallen war. Ich zähle dazu den Band „Europa reformata“[9], herausgegeben von Michael Welker und Albert de Lange, der die Reformation als europäisches Netzwerk präsentiert und deswegen so zu loben ist, weil er ganz konsequent über den deutschen Tellerrand hinausblickt. Ich zähle dazu nicht zuletzt die Biographie Johann Sebastian Bachs, die der Dirigent John Eliot Gardiner vorgelegt hat[10]. Bach lebte zwar nicht im reformatorischen Jahrhundert, aber Gardiner kann zeigen, wie Bach von Kindheit an durch Schule und Elternhaus theologisch durch Luther und die Reformation geprägt wurde, selbst eine riesige Bibliothek mit den Werken der Reformation und ihrer Nachfolger besaß und schließlich, vor allem in seinen Kantaten und den Passionen eine durch Luther zutiefst geprägte geistliche Musik entwickelte, die noch heute nicht zu verstehen ist, wenn die geistigen Quellen missachtet werden, aus denen diese Musik lebt. Ich belasse es bei diesen drei Beispielen, wohl wissend, dass sehr viel mehr Bücher publiziert wurden, darunter auch solche, die keine Aufmerksamkeit verdienen. Aber auch das gehört zu einem solchen Jubiläum. Es ist gut, wenn man einige Bücher nicht gelesen, einige Ausstellungen nicht gesehen und einige Konferenzen nicht besucht hat.
8.
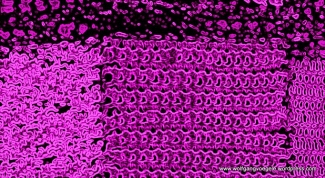 Und man nimmt manche Kritik besser nicht zur Kenntnis, zum Beispiel diejenige der beiden Bürgerrechtler Friedrich Schorlemmer und Christian Wolff, deren früh veröffentlichtes Papier[11] zum Jubiläumsjahr zum Musterbeispiel verfehlter, miesepetriger Jubiläumskritik geriet. Hier werden im quengelnden Ton Parallelen zwischen 16. und 21. Jahrhundert beschworen, nur um dann zu einer Kritik des gegenwärtigen Protestantismus zu gelangen, der mit den lange bekannten Klischees und Gemeinplätzen protestantischen Selbstmitleids spielt. Aber wer so mit „Parallelen“ umgeht, der wird weder historisch der Ära der Reformation noch aktuell den Notwendigkeiten von Kirchenreform gerecht, so angemessen es sein mag, die schlecht besuchten Großveranstaltungen des Kirchentags und seiner kleineren Satelliten in den neuen Bundesländern einmal deutlich hervorzuheben. Der Streit um die Zahl der Teilnehmer der Abschlussveranstaltung des Kirchentags in Wittenberg kam einem ja vor wie die Farce um die Einführung des amerikanischen Präsidenten im Januar 2017 in Washington, D.C., als die Presseabteilung den Unterschied zwischen geschönten Teilnehmerzahlen und kompromittierenden Fotos mit einem beinahe leeren Feld vor dem Kapitol mit „alternativen Fakten“ wegerklären wollte.
Und man nimmt manche Kritik besser nicht zur Kenntnis, zum Beispiel diejenige der beiden Bürgerrechtler Friedrich Schorlemmer und Christian Wolff, deren früh veröffentlichtes Papier[11] zum Jubiläumsjahr zum Musterbeispiel verfehlter, miesepetriger Jubiläumskritik geriet. Hier werden im quengelnden Ton Parallelen zwischen 16. und 21. Jahrhundert beschworen, nur um dann zu einer Kritik des gegenwärtigen Protestantismus zu gelangen, der mit den lange bekannten Klischees und Gemeinplätzen protestantischen Selbstmitleids spielt. Aber wer so mit „Parallelen“ umgeht, der wird weder historisch der Ära der Reformation noch aktuell den Notwendigkeiten von Kirchenreform gerecht, so angemessen es sein mag, die schlecht besuchten Großveranstaltungen des Kirchentags und seiner kleineren Satelliten in den neuen Bundesländern einmal deutlich hervorzuheben. Der Streit um die Zahl der Teilnehmer der Abschlussveranstaltung des Kirchentags in Wittenberg kam einem ja vor wie die Farce um die Einführung des amerikanischen Präsidenten im Januar 2017 in Washington, D.C., als die Presseabteilung den Unterschied zwischen geschönten Teilnehmerzahlen und kompromittierenden Fotos mit einem beinahe leeren Feld vor dem Kapitol mit „alternativen Fakten“ wegerklären wollte.
9.
 Ich sagte, es sei gut, wenn man einige Konferenzen nicht besucht habe. Für eine Konferenz gilt das definitiv nicht. Sie fand in Gladbeck statt, gerade kein Zentrum des Reformationstourismus. Schon der Ort war sehr gut gewählt, ein von der evangelischen Kirche aufgegebenes Gemeindezentrum, das in der Folge von einem Verein zum Martin-Luther-Forum mit Ausstellung, Vortragsraum und Konferenzsälen umgenutzt worden war. Die Tagung „Luther reloaded. Brauchen wir eine neue Reformation?“[12] fragte nach Reformbemühungen im Protestantismus, im Katholizismus, aber auch in anderen Religionen, in Judentum, Islam, Hinduismus und anderen. In dieser Perspektive wird die protestantische Reformation einer doppelten Relativierung ausgesetzt. Die erste Relativierung zielt auf die historische Phase der Reformation, die im Vergleich mit anderen innerreligiösen Reformbewegungen einiges von ihrer Singularität verliert. Die zweite Relativierung zielt auf die Ortsbestimmung des Protestantismus in der Moderne, denn nicht nur die Evangelischen müssen sich in Konfrontation mit der Moderne neu erfinden, sondern andere Religionen auch.
Ich sagte, es sei gut, wenn man einige Konferenzen nicht besucht habe. Für eine Konferenz gilt das definitiv nicht. Sie fand in Gladbeck statt, gerade kein Zentrum des Reformationstourismus. Schon der Ort war sehr gut gewählt, ein von der evangelischen Kirche aufgegebenes Gemeindezentrum, das in der Folge von einem Verein zum Martin-Luther-Forum mit Ausstellung, Vortragsraum und Konferenzsälen umgenutzt worden war. Die Tagung „Luther reloaded. Brauchen wir eine neue Reformation?“[12] fragte nach Reformbemühungen im Protestantismus, im Katholizismus, aber auch in anderen Religionen, in Judentum, Islam, Hinduismus und anderen. In dieser Perspektive wird die protestantische Reformation einer doppelten Relativierung ausgesetzt. Die erste Relativierung zielt auf die historische Phase der Reformation, die im Vergleich mit anderen innerreligiösen Reformbewegungen einiges von ihrer Singularität verliert. Die zweite Relativierung zielt auf die Ortsbestimmung des Protestantismus in der Moderne, denn nicht nur die Evangelischen müssen sich in Konfrontation mit der Moderne neu erfinden, sondern andere Religionen auch.
 Am Anfang beschrieb der Historiker Jörn Rüsen (Essen) die Transformationen, welche die Moderne seit den sechziger Jahren durchgemacht hat. Das politische Projekt, mehr Demokratie zu wagen (Willy Brandt) wird abgelöst von Bewegungen des Transhumanen und des human enhancement. Im Fragwürdig werden der universalen, aufgeklärten Moderne, die das Ende der Geschichte ausgerufen hat, sind Fehlbarkeit, Fragilität und Verwundbarkeit des Menschen neu in den Blick gerückt. Entgegen den Unkenrufen der Säkularisierungspropheten hat sich Religion nicht aufgelöst. Auch in der modernen Gesellschaft besteht Bedarf nach Religion und Transzendenz. Rüsen meint nun, dem sei nicht mehr mit einer Unterscheidung zwischen wahrer und falscher Religion beizukommen, sondern nur mit einem humanistischen Koexistenzmodell, das in manchen Punkten der von John Hick und anderen entwickelten Theologie der Religionen nahekommt. Religionen müssen sich mit dem Problem auseinandersetzen, einerseits absolute Wahrheitsansprüche für den eigenen Glauben aufzustellen, andererseits aber mit anderen Religionen konfrontiert zu werden, die diese Absolutheitsansprüche in gleicher Weise stellen.
Am Anfang beschrieb der Historiker Jörn Rüsen (Essen) die Transformationen, welche die Moderne seit den sechziger Jahren durchgemacht hat. Das politische Projekt, mehr Demokratie zu wagen (Willy Brandt) wird abgelöst von Bewegungen des Transhumanen und des human enhancement. Im Fragwürdig werden der universalen, aufgeklärten Moderne, die das Ende der Geschichte ausgerufen hat, sind Fehlbarkeit, Fragilität und Verwundbarkeit des Menschen neu in den Blick gerückt. Entgegen den Unkenrufen der Säkularisierungspropheten hat sich Religion nicht aufgelöst. Auch in der modernen Gesellschaft besteht Bedarf nach Religion und Transzendenz. Rüsen meint nun, dem sei nicht mehr mit einer Unterscheidung zwischen wahrer und falscher Religion beizukommen, sondern nur mit einem humanistischen Koexistenzmodell, das in manchen Punkten der von John Hick und anderen entwickelten Theologie der Religionen nahekommt. Religionen müssen sich mit dem Problem auseinandersetzen, einerseits absolute Wahrheitsansprüche für den eigenen Glauben aufzustellen, andererseits aber mit anderen Religionen konfrontiert zu werden, die diese Absolutheitsansprüche in gleicher Weise stellen.
 Solche Fragen wurden in der Tagung für verschiedene Religionen durchgespielt. Georg Essen (Bochum) problematisierte für die katholische Kirche zwei Formeln, die Papst Benedikt XVI. in die Diskussion eingebracht hatte. Benedikt hatte bei seinem Deutschlandbesuch in Freiburg die „Entweltlichung“ der Kirche und später ein „Ende der Diktatur des Pluralismus“ gefordert. Beide Formeln kritisierte Essen und legte sie aus als Resignation und Kapitulation vor den Problemen der Moderne. Was das kanonische Recht angeht, so bedarf es einer Revision des (katholischen) Naturrechts und dessen substantialistisch-normativer Setzungen (so Judith Hahn, Bochum). Und der Tübinger Kirchenhistoriker Florian Bock konnte zeigen, wie nach dem großen Reformschritt des 2.Vatikanum die katholische Kirche sich in inhomogene Gruppen von Progressiven und Konservativen aufspaltete. Die Progressiven versammeln sich in gemeindenahen Laienbewegungen, während die Konservativen die Tradition verherrlichen und das vorkonziliare Dogma absolut setzen. Die katholische Kirche ist demnach einem Polarisierungsprozess ausgesetzt, mit dem sie sich langfristig selbst gefährdet. In fünfzig Jahren, so Bock, werde es „romfreie Individualkatholiken“ geben, die sich von einer kleiner gewordenen und weniger universalistischen Papstkirche absetzen.
Solche Fragen wurden in der Tagung für verschiedene Religionen durchgespielt. Georg Essen (Bochum) problematisierte für die katholische Kirche zwei Formeln, die Papst Benedikt XVI. in die Diskussion eingebracht hatte. Benedikt hatte bei seinem Deutschlandbesuch in Freiburg die „Entweltlichung“ der Kirche und später ein „Ende der Diktatur des Pluralismus“ gefordert. Beide Formeln kritisierte Essen und legte sie aus als Resignation und Kapitulation vor den Problemen der Moderne. Was das kanonische Recht angeht, so bedarf es einer Revision des (katholischen) Naturrechts und dessen substantialistisch-normativer Setzungen (so Judith Hahn, Bochum). Und der Tübinger Kirchenhistoriker Florian Bock konnte zeigen, wie nach dem großen Reformschritt des 2.Vatikanum die katholische Kirche sich in inhomogene Gruppen von Progressiven und Konservativen aufspaltete. Die Progressiven versammeln sich in gemeindenahen Laienbewegungen, während die Konservativen die Tradition verherrlichen und das vorkonziliare Dogma absolut setzen. Die katholische Kirche ist demnach einem Polarisierungsprozess ausgesetzt, mit dem sie sich langfristig selbst gefährdet. In fünfzig Jahren, so Bock, werde es „romfreie Individualkatholiken“ geben, die sich von einer kleiner gewordenen und weniger universalistischen Papstkirche absetzen.
 Genau diesen katholischen Diskussionsstrang kann man auf die protestantische Kirche übertragen. Weil Georg Essen meinte, die große Pathologie des Protestantismus sei die Partikularisierung des Christentums, so ist doch für beide Kirchen die Frage, wie sie die jeweils eingeprägte Organisationskultur (die in beiden Fällen nicht mit der Kirche selbst zu verwechseln ist) modernitätstauglich machen, das heißt sich in „fluide“ Organisationen verwandeln, die von einer Vielzahl von konkurrierenden Gruppen geprägt werden. Und danach stellt sich die Frage nach einer gemeinsamen Identität von Protestantismus und Katholizismus. Die von Bock bemerkten Tendenzen der Zersplitterung der katholischen Kirche lassen sich ja analog auch im Protestantismus finden, etwa im Gegenüber von Kirchentags- und evangelikaler Bewegung.
Genau diesen katholischen Diskussionsstrang kann man auf die protestantische Kirche übertragen. Weil Georg Essen meinte, die große Pathologie des Protestantismus sei die Partikularisierung des Christentums, so ist doch für beide Kirchen die Frage, wie sie die jeweils eingeprägte Organisationskultur (die in beiden Fällen nicht mit der Kirche selbst zu verwechseln ist) modernitätstauglich machen, das heißt sich in „fluide“ Organisationen verwandeln, die von einer Vielzahl von konkurrierenden Gruppen geprägt werden. Und danach stellt sich die Frage nach einer gemeinsamen Identität von Protestantismus und Katholizismus. Die von Bock bemerkten Tendenzen der Zersplitterung der katholischen Kirche lassen sich ja analog auch im Protestantismus finden, etwa im Gegenüber von Kirchentags- und evangelikaler Bewegung.
Es ist hier nicht der Ort, die weiteren Referate wiederzugeben. Aber es war interessant zu hören, wie das Judentum des 19. Jahrhundert nach einem „jüdischen Luther“ gesucht hat, um eigene Reformbemühungen zu verstetigen. Es war genauso interessant, etwas über die viel diskutierten, gegenwärtigen Reformbewegungen im Islam zu erfahren (Aladdin Sarhan, Marwan Abou Taam, Mouhanad Khorchide).
 Den Abschlussvortrag hielt der Münchener Systematische Theologie Friedrich Wilhelm Graf. Hilfreich war seine Unterscheidung zwischen Geschichtspolitik, Geschichtsdeutung und -forschung. Denn nur mit Hilfe solcher Unterscheidungen lässt sich die bereits markierte Differenz zwischen der Historisierung Luthers und der Reformation auf der einen und der Selbstverständigungsdebatte des Protestantismus weiter ausarbeiten. Wobei zur Überraschung vieler die kirchliche Deutung der Reformation bei Graf kaum eine Rolle mehr spielte. Und im Grunde nahm Graf in seinem Schlusssatz den Ball auf, den die Katholiken mit ihren Reflexionen über den seit dem 2.Vatikanum immer mehr gespaltenen Katholizismus ihm zugespielt hatten. Einer seiner Schlusssätze lautete: „Wer meint, dass Pluralisierung ein Gewinn ist, der hat in der Reformation etwas zu feiern.“ Graf wusste, dass der Philosoph Georg Friedrich Wilhelm Hegel am Reformationstag stets schon vormittags eine Flasche Rotwein öffnete. Aber es macht doch einen Unterschied, ob man den Weltgeist feiert, der in Martin Luther Gestalt annahm, oder die pluralistische Religionskultur der Gegenwart.
Den Abschlussvortrag hielt der Münchener Systematische Theologie Friedrich Wilhelm Graf. Hilfreich war seine Unterscheidung zwischen Geschichtspolitik, Geschichtsdeutung und -forschung. Denn nur mit Hilfe solcher Unterscheidungen lässt sich die bereits markierte Differenz zwischen der Historisierung Luthers und der Reformation auf der einen und der Selbstverständigungsdebatte des Protestantismus weiter ausarbeiten. Wobei zur Überraschung vieler die kirchliche Deutung der Reformation bei Graf kaum eine Rolle mehr spielte. Und im Grunde nahm Graf in seinem Schlusssatz den Ball auf, den die Katholiken mit ihren Reflexionen über den seit dem 2.Vatikanum immer mehr gespaltenen Katholizismus ihm zugespielt hatten. Einer seiner Schlusssätze lautete: „Wer meint, dass Pluralisierung ein Gewinn ist, der hat in der Reformation etwas zu feiern.“ Graf wusste, dass der Philosoph Georg Friedrich Wilhelm Hegel am Reformationstag stets schon vormittags eine Flasche Rotwein öffnete. Aber es macht doch einen Unterschied, ob man den Weltgeist feiert, der in Martin Luther Gestalt annahm, oder die pluralistische Religionskultur der Gegenwart.
Grafs protestantische Pluralismusfreunde und die romfreien Individualkatholiken würden bestimmt miteinander das Abendmahl feiern, wenn sie sich denn, beide befreit von ihren fluiden Institutionen, in ihrem Individualismus auf solch eine gesellig-kommunikative Veranstaltung einlassen könnten.
10.
 Bleibt noch etwas zu sagen über das Playmobilmännchen, das Martin Luther darstellen soll. Anekdoten darüber werden ja stets mit einer gewissen protestantischen Koketterie erzählt. Das 19. Jahrhundert machte aus Martin Luther einen deutschnationalen Heros, einen Kämpfer für Freiheit und Vaterland, den man sich vor die Kirche auf den monumentalen Denkmalsockel stellte. Das 20. Jahrhundert machte aus Luther einen Frühsozialisten, der nicht richtig mit Thomas Müntzer klargekommen war und irgendwo im Niemandsland zwischen Bundesrepublik und der DDR lebte, als ein Früheuropäer mit starkem Hang zu neuen (Druck-)Medien. Der Luther des 21. Jahrhunderts ist ein winziges Playmobilmännchen, keine Denkmalsfigur. Statt deutschmonumental mit Bismarck, Goethe und Schiller oder früheuropäisch mit Bucer, Calvin und Bugenhagen konkurriert er nun mit Darth Vader, Luke Skywalker, Superman und Elvis Presley.
Bleibt noch etwas zu sagen über das Playmobilmännchen, das Martin Luther darstellen soll. Anekdoten darüber werden ja stets mit einer gewissen protestantischen Koketterie erzählt. Das 19. Jahrhundert machte aus Martin Luther einen deutschnationalen Heros, einen Kämpfer für Freiheit und Vaterland, den man sich vor die Kirche auf den monumentalen Denkmalsockel stellte. Das 20. Jahrhundert machte aus Luther einen Frühsozialisten, der nicht richtig mit Thomas Müntzer klargekommen war und irgendwo im Niemandsland zwischen Bundesrepublik und der DDR lebte, als ein Früheuropäer mit starkem Hang zu neuen (Druck-)Medien. Der Luther des 21. Jahrhunderts ist ein winziges Playmobilmännchen, keine Denkmalsfigur. Statt deutschmonumental mit Bismarck, Goethe und Schiller oder früheuropäisch mit Bucer, Calvin und Bugenhagen konkurriert er nun mit Darth Vader, Luke Skywalker, Superman und Elvis Presley.
Und ich nehme Liljes Lutherbuch, das mich seit zig Umzügen begleitet, wieder aus dem Regal.
Anmerkungen
[1] Hanns Lilje, Martin Luther. Eine Bildmonographie, Stuttgart 1967.
[2] Wolfgang Vögele (Hg.), Die Bekenntnisschriften der Badischen Landeskirche, Bd.1, Textsammlung, Bd. 2 Kommentar, Karlsruhe 2015.
[3] Wolfgang Vögele, Sono auribus viventium. Sono auribus viventium. Kultur und Theologie des Glockenläutens in Reformation und Moderne, Ästhetik – Theologie – Liturgik 68, Münster u.a. 2017.
[4] Heinrich Bedford-Strohm, Interview, Süddeutsche Zeitung 28.-29.10. 2017.
[5] Vgl. Wolfgang Vögele, Das Abendmahl der Aktenordner. Bemerkungen zum Verhältnis von Theologie und Kirchenleitung, Ta Katoptrizómena. Magazin für Kunst, Kultur, Theologie, Ästhetik, H.90, 2014, http://www.theomag.de/90/wv12.htm.
[7] Dazu Wolfgang Vögele, Brot und Wein. Brot und Wein. Gegenwärtige Abendmahlspraxis und ihre theologische Deutung, tà katoptrizómena, Heft 110, Oktober 2017, https://theomag.de/109/wv036.htm.
[8] Lyndal Roper, Der Mensch Martin Luther, Frankfurt 2016.
[9] Michael Beintker, Albert de Lange, Michael Welker (Hg.), Europa reformata: Reformationsstädte Europas und ihre Reformatoren, Leipzig 2016.
[10] John Eliot Gardiner, Bach. Musik für die Himmelsburg, München 2016; vgl dazu Wolfgang Vögele, Werde munter, mein Gemüte. Über den musikalisch-theologischen Dialog und die Bach-Biographie von John Eliot Gardiner, tà katoptrizómena, Heft 107, Juni 2017, https://www.theomag.de/107/wv035.htm.

 Mein erstes persönliches Luther-Jahr feierte ich 1973 oder 1974, die genaue Jahreszahl lässt sich nicht mehr ermitteln. Jedenfalls war ich zwölf oder dreizehn Jahre alt. Ich hatte einen Großonkel, der als Pfarrer in einer Gemeinde im Siegerland arbeitete. Alle halbe Jahre schickte er mir ein Paket mit Büchern und Traktaten, denn er stand dem Siegerländer Pietismus nahe. Die Pakete enthielten Bekehrungstraktate, denen ich wenig Beachtung schenkte. Darunter fanden sich die Romane Jörg Erbs, Geschichten von Landsknechten aus dem Dreißigjährigen Krieg, in denen König Gustav Adolf, seine schwedischen Kompanien und andere Lutheraner gegen die bösen Katholiken kämpften. Das fand ich zwar nicht ganz so spannend wie Sir Francis Drake, Lord Hornblower oder Robin Hood, aber doch spannend genug, um diese Bücher nachts unter der Bettdecke zu lesen.
Mein erstes persönliches Luther-Jahr feierte ich 1973 oder 1974, die genaue Jahreszahl lässt sich nicht mehr ermitteln. Jedenfalls war ich zwölf oder dreizehn Jahre alt. Ich hatte einen Großonkel, der als Pfarrer in einer Gemeinde im Siegerland arbeitete. Alle halbe Jahre schickte er mir ein Paket mit Büchern und Traktaten, denn er stand dem Siegerländer Pietismus nahe. Die Pakete enthielten Bekehrungstraktate, denen ich wenig Beachtung schenkte. Darunter fanden sich die Romane Jörg Erbs, Geschichten von Landsknechten aus dem Dreißigjährigen Krieg, in denen König Gustav Adolf, seine schwedischen Kompanien und andere Lutheraner gegen die bösen Katholiken kämpften. Das fand ich zwar nicht ganz so spannend wie Sir Francis Drake, Lord Hornblower oder Robin Hood, aber doch spannend genug, um diese Bücher nachts unter der Bettdecke zu lesen. Ich habe mit dieser autobiographischen Erinnerung begonnen, um die subjektive Perspektive dieses Essays deutlich zu machen. In jedem Fall wollte ich die Feldherrnpose des Jubiläumsstrategen und die Beobachtungspose des theologischen Großkritikers zu vermeiden, wobei aber nicht gesagt sein soll, dass sich mit einer subjektiven Betrachtungsweise alle Kritik an Kitsch und Banalität des Reformationsjubiläums auflöst. Viele Protestanten haben ein merkwürdig masochistisches Verhältnis zur Kritik: Entweder sie nehmen sie nicht wahr, um sie dann unausgesprochen umso größer werden zu lassen. Oder sie tun so, als nähmen sie sie nicht ernst, weil sie sie in Wahrheit näher an sich herangelassen haben als ihnen gut tut. Im allerschlimmsten Fall wird Kritik als „Wertschätzung“ schön geredet. Die zynische Nebenbedeutung dieses Begriffs als Taxieren, Untersuchen, als Abschätzen des (Gebrauchs-)Wertes einer Person bleibt in jedem Fall unberücksichtigt.
Ich habe mit dieser autobiographischen Erinnerung begonnen, um die subjektive Perspektive dieses Essays deutlich zu machen. In jedem Fall wollte ich die Feldherrnpose des Jubiläumsstrategen und die Beobachtungspose des theologischen Großkritikers zu vermeiden, wobei aber nicht gesagt sein soll, dass sich mit einer subjektiven Betrachtungsweise alle Kritik an Kitsch und Banalität des Reformationsjubiläums auflöst. Viele Protestanten haben ein merkwürdig masochistisches Verhältnis zur Kritik: Entweder sie nehmen sie nicht wahr, um sie dann unausgesprochen umso größer werden zu lassen. Oder sie tun so, als nähmen sie sie nicht ernst, weil sie sie in Wahrheit näher an sich herangelassen haben als ihnen gut tut. Im allerschlimmsten Fall wird Kritik als „Wertschätzung“ schön geredet. Die zynische Nebenbedeutung dieses Begriffs als Taxieren, Untersuchen, als Abschätzen des (Gebrauchs-)Wertes einer Person bleibt in jedem Fall unberücksichtigt. Im Jubiläumsjahr 2017 haben Protestantismus, Politik, Kunst und Kultur Luther gefeiert, und ich will gar nicht erst den Versuch machen, den ganzen Wust aus Luther-Büchern, Luther-Oratorien, Luther-Devotionalien, Luther-Ausstellungen und Luther-Denkschriften im Überblick abzuschreiten. Es ist einfach nicht möglich, und deswegen werde ich mich auf persönliche Beobachtungen und Erfahrungen beschränken. Kritiker, Gegner, Befürworter, Fans tragen im Moment alle ihre Indizien zusammen, und in der unübersichtlichen Menge von Gelegenheiten finden alle diejenigen Details, die sie für ihre Argumente benötigen. Luther ist Projektionsfläche, und jedem steht es frei, ihn zum wiederholten Mal mit Argumenten zu verbrennen oder ihn zum wiederholten Mal auf den Denkmalsockel zu stellen und ins Monumentale zu vergrößern. Noch fünfhundert Jahre nach dem Thesenanschlag löst der Reformator eine ganze Menge von Emotionen aus, die ein ausgewogenes, abwägendes Urteil eher behindern als fördern.
Im Jubiläumsjahr 2017 haben Protestantismus, Politik, Kunst und Kultur Luther gefeiert, und ich will gar nicht erst den Versuch machen, den ganzen Wust aus Luther-Büchern, Luther-Oratorien, Luther-Devotionalien, Luther-Ausstellungen und Luther-Denkschriften im Überblick abzuschreiten. Es ist einfach nicht möglich, und deswegen werde ich mich auf persönliche Beobachtungen und Erfahrungen beschränken. Kritiker, Gegner, Befürworter, Fans tragen im Moment alle ihre Indizien zusammen, und in der unübersichtlichen Menge von Gelegenheiten finden alle diejenigen Details, die sie für ihre Argumente benötigen. Luther ist Projektionsfläche, und jedem steht es frei, ihn zum wiederholten Mal mit Argumenten zu verbrennen oder ihn zum wiederholten Mal auf den Denkmalsockel zu stellen und ins Monumentale zu vergrößern. Noch fünfhundert Jahre nach dem Thesenanschlag löst der Reformator eine ganze Menge von Emotionen aus, die ein ausgewogenes, abwägendes Urteil eher behindern als fördern. Auf sehr viel mehr Interesse stießen dagegen Vorträge, die anknüpften an den – horribile dictu – touristischen Orten, an denen Reformation sichtbar wird. Allein in Baden-Württemberg sind die Tourismusbehörden mit solchen Orten und Stätten nicht gesegnet. Von der wichtigen Heidelberger Disputation 1518 ist nicht viel mehr geblieben als eine runde Bodenplatte, die doch eher an einen Gullydeckel erinnert. Heidelberger Theologiestudenten, denen die kirchengeschichtliche Bedeutung vertraut sein müsste, laufen achtlos über die Platte hinweg. Die Reformation war eher intellektuelles als architektonisches Ereignis, und die Luther-Denkmäler gehören ins 19. Jahrhundert mit seinem monumentalen, heroischen und auch deutschnationalen Lutherbild. Sieht man einmal von den Wittenberger, Eisenacher biographischen Gedenkstätten ab, so bleibt vieles an der Reformation in unserer Gegenwart architektonisch unsichtbar. Wer zum Beispiel in Basel nach den Spuren Erasmus von Rotterdams sucht, der wird feststellen, dass die Häuser, in denen er wohnte, und die Verlagshäuser und Druckereien, denen er seine Werke lieferte, zumeist bei Bränden oder anderen Katastrophen zerstört worden sind. Trotzdem waren in Basel zwei außerordentlich originelle Ausstellungen zu sehen, die eine im Münster, die andere in der Barfüßerkirche, dem Stadtmuseum Basels. Die zweite Ausstellung arbeitete sehr überzeugend nicht mit Ausstellungsräumen, sondern mit Exponaten, die über die Standardsammlung des Museums verteilt waren. Insofern wurde Erasmus‘ Lebensgeschichte in die Baseler Stadtgeschichte integriert. Die Besucher erhielten einen Tabletcomputer, auf dem sie sich die entsprechenden biographischen Zusammenhänge anschaulich machen konnten.
Auf sehr viel mehr Interesse stießen dagegen Vorträge, die anknüpften an den – horribile dictu – touristischen Orten, an denen Reformation sichtbar wird. Allein in Baden-Württemberg sind die Tourismusbehörden mit solchen Orten und Stätten nicht gesegnet. Von der wichtigen Heidelberger Disputation 1518 ist nicht viel mehr geblieben als eine runde Bodenplatte, die doch eher an einen Gullydeckel erinnert. Heidelberger Theologiestudenten, denen die kirchengeschichtliche Bedeutung vertraut sein müsste, laufen achtlos über die Platte hinweg. Die Reformation war eher intellektuelles als architektonisches Ereignis, und die Luther-Denkmäler gehören ins 19. Jahrhundert mit seinem monumentalen, heroischen und auch deutschnationalen Lutherbild. Sieht man einmal von den Wittenberger, Eisenacher biographischen Gedenkstätten ab, so bleibt vieles an der Reformation in unserer Gegenwart architektonisch unsichtbar. Wer zum Beispiel in Basel nach den Spuren Erasmus von Rotterdams sucht, der wird feststellen, dass die Häuser, in denen er wohnte, und die Verlagshäuser und Druckereien, denen er seine Werke lieferte, zumeist bei Bränden oder anderen Katastrophen zerstört worden sind. Trotzdem waren in Basel zwei außerordentlich originelle Ausstellungen zu sehen, die eine im Münster, die andere in der Barfüßerkirche, dem Stadtmuseum Basels. Die zweite Ausstellung arbeitete sehr überzeugend nicht mit Ausstellungsräumen, sondern mit Exponaten, die über die Standardsammlung des Museums verteilt waren. Insofern wurde Erasmus‘ Lebensgeschichte in die Baseler Stadtgeschichte integriert. Die Besucher erhielten einen Tabletcomputer, auf dem sie sich die entsprechenden biographischen Zusammenhänge anschaulich machen konnten. Auf das größte Interesse stießen Vorträge zum Thema des Glockenläutens in der Reformation und in der Gegenwart
Auf das größte Interesse stießen Vorträge zum Thema des Glockenläutens in der Reformation und in der Gegenwart Dieser Abstand zwischen damals und heute scheint mir ein entscheidender Punkt. Wer ihn einfach überspringt (siehe Luther-Oratorium, siehe Luther-Socken etc. pp.), der landet hart auf dem Boden der Banalität. Der historische und der gegenwärtige Martin Luther driften auseinander.
Dieser Abstand zwischen damals und heute scheint mir ein entscheidender Punkt. Wer ihn einfach überspringt (siehe Luther-Oratorium, siehe Luther-Socken etc. pp.), der landet hart auf dem Boden der Banalität. Der historische und der gegenwärtige Martin Luther driften auseinander. Der historische Luther, der der Moderne in seinen antijüdischen und antiislamischen Tiraden, auch in seinem Grobianismus fremd geworden ist, und die Aufgabe einer lutherischen, gegenwartstauglichen Theologie sind auseinanderzuhalten. Lutherische Theologie ist nicht einfach die antimoderne Revitalisierung der Theologie Martin Luthers. Insofern sind – trotz Jubiläum – zwei Dinge auseinanderzuhalten, nämlich die Frage nach der historischen und theologiehistorischen Bedeutung Martin Luthers und deren Kontextualisierung sowie die Frage nach dem Selbstverständnis des nicht deutschen, sondern europäischen Protestantismus in der Gegenwart. Letzteres scheint mir doch das zu sein, was die meisten Kritiker und Befürworter des Jubiläums eigentlich beschäftigt. Der deutsche Protestantismus hält den Vergleich mit der katholischen Weltkirche, so problematisch diese sein mag, nicht aus. Man hat sich zu lange mit den volkskirchlichen Verhältnissen der siebziger und achtziger Jahre zufrieden gegeben, hielt diese für den klügsten Schluss ekklesiologischer Glaubensweisheit und wundert sich nun, dass auch das gefeierte, kirchen- und staatstragende Jubiläum die Renovationsbedürftigkeit der Landeskirchen nicht überdecken kann. Man weiß, dass man längst den praktisch-theologischen TÜV hätte aufsuchen sollen. In den fünfziger Jahren suchte man Hilfe bei einer strengen Wort-Gottes-Theologie, die allen Kulturprotestantismus ausmerzen wollte, danach kamen ab den Sechzigern die Religionssoziologen mit ihren Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen an die Reihe, schließlich in den Neunzigern die Journalisten, welche die evangelische Botschaft ohne die Sprache Kanaans „rüber“ bringen wollten und schließlich in der jüngsten Zeit die Marketingleute, deren Plakate, Gimmicks, Apps und Hochglanzbroschüren sich nicht lange mit Theologie und Kirchengeschichte aufhalten. Alle diese Reparaturanstrengungen führten zu keinem positiven Ergebnis, und das Fehlen davon sorgte und sorgt uneingestanden bei den Funktionären der Landeskirchen für erhebliche Verunsicherung. Die Konsistorien und Oberkirchenräte finden sich in der Rolle von austherapierten, schwerkranken Patienten, die nach dem vergeblichen Versuch, die Schulmedizin zu konsultieren, nun mit alternativen Heilungsmethoden liebäugeln.
Der historische Luther, der der Moderne in seinen antijüdischen und antiislamischen Tiraden, auch in seinem Grobianismus fremd geworden ist, und die Aufgabe einer lutherischen, gegenwartstauglichen Theologie sind auseinanderzuhalten. Lutherische Theologie ist nicht einfach die antimoderne Revitalisierung der Theologie Martin Luthers. Insofern sind – trotz Jubiläum – zwei Dinge auseinanderzuhalten, nämlich die Frage nach der historischen und theologiehistorischen Bedeutung Martin Luthers und deren Kontextualisierung sowie die Frage nach dem Selbstverständnis des nicht deutschen, sondern europäischen Protestantismus in der Gegenwart. Letzteres scheint mir doch das zu sein, was die meisten Kritiker und Befürworter des Jubiläums eigentlich beschäftigt. Der deutsche Protestantismus hält den Vergleich mit der katholischen Weltkirche, so problematisch diese sein mag, nicht aus. Man hat sich zu lange mit den volkskirchlichen Verhältnissen der siebziger und achtziger Jahre zufrieden gegeben, hielt diese für den klügsten Schluss ekklesiologischer Glaubensweisheit und wundert sich nun, dass auch das gefeierte, kirchen- und staatstragende Jubiläum die Renovationsbedürftigkeit der Landeskirchen nicht überdecken kann. Man weiß, dass man längst den praktisch-theologischen TÜV hätte aufsuchen sollen. In den fünfziger Jahren suchte man Hilfe bei einer strengen Wort-Gottes-Theologie, die allen Kulturprotestantismus ausmerzen wollte, danach kamen ab den Sechzigern die Religionssoziologen mit ihren Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen an die Reihe, schließlich in den Neunzigern die Journalisten, welche die evangelische Botschaft ohne die Sprache Kanaans „rüber“ bringen wollten und schließlich in der jüngsten Zeit die Marketingleute, deren Plakate, Gimmicks, Apps und Hochglanzbroschüren sich nicht lange mit Theologie und Kirchengeschichte aufhalten. Alle diese Reparaturanstrengungen führten zu keinem positiven Ergebnis, und das Fehlen davon sorgte und sorgt uneingestanden bei den Funktionären der Landeskirchen für erhebliche Verunsicherung. Die Konsistorien und Oberkirchenräte finden sich in der Rolle von austherapierten, schwerkranken Patienten, die nach dem vergeblichen Versuch, die Schulmedizin zu konsultieren, nun mit alternativen Heilungsmethoden liebäugeln. Sehr deutlich wurde dieser Gegensatz zwischen historischer Werkstatt und Identitätsfindung an der Kabale, die sich die Leitung der EKD mit einigen systematischen Theologen und Kirchenhistorikern lieferte. Aber dieser (Kirchen-)Historikerstreit, der schnell aufgebauscht wurde, versandete auch genauso schnell wieder, ohne dass die notwendigen Differenzierungsleistungen in die Debatte eingebracht worden wären. Man hatte den offensichtlichen Eindruck, hier wurden persönliche Animositäten ausgetragen, und die sachliche Klärung des schwierigen Verhältnisses von Theologie und Kirchenleitung
Sehr deutlich wurde dieser Gegensatz zwischen historischer Werkstatt und Identitätsfindung an der Kabale, die sich die Leitung der EKD mit einigen systematischen Theologen und Kirchenhistorikern lieferte. Aber dieser (Kirchen-)Historikerstreit, der schnell aufgebauscht wurde, versandete auch genauso schnell wieder, ohne dass die notwendigen Differenzierungsleistungen in die Debatte eingebracht worden wären. Man hatte den offensichtlichen Eindruck, hier wurden persönliche Animositäten ausgetragen, und die sachliche Klärung des schwierigen Verhältnisses von Theologie und Kirchenleitung Es ist auch ein Wort zu sagen über die Ökumene und den großen Wunsch mindestens nach ökumenischer Gastfreundschaft beim Abendmahl
Es ist auch ein Wort zu sagen über die Ökumene und den großen Wunsch mindestens nach ökumenischer Gastfreundschaft beim Abendmahl Zweite Bemerkung: Zwar versichern mittlerweile katholische wie evangelische Ökumeniker, dass die theologischen Differenzen in der Abendmahlsfrage wie Opferverständnis, Realpräsenz, Abendmahl in beiderlei Gestalt, Amtsfrage und apostolische Sukzession ausgeräumt seien. Und dafür können sie einige überzeugende Argumente anführen. Aber es ist die Frage zu stellen, ob zum Beispiel ein strenges und nicht ökumenisch ermäßigtes Verständnis der Voraussetzung der Priesterweihe wirklich mit dem evangelischen Theorem vom Priestertum aller Gläubigen vereinbar ist. Das verbindet sich damit, dass in der offiziellen evangelischen Kirche über das theologische Verständnis des Abendmahls vorsichtig formuliert eine gewisse Unklarheit herrscht. Was die evangelische-katholische Ökumene angeht, so lehrt hier ein weiteres Mal die Leuenberger Erklärung den Umgang mit alten Streitigkeiten aus der Vergangenheit. Differenzen müssen theologisch neu bewertet werden, auch in den wichtigen Abendmahlsfragen.
Zweite Bemerkung: Zwar versichern mittlerweile katholische wie evangelische Ökumeniker, dass die theologischen Differenzen in der Abendmahlsfrage wie Opferverständnis, Realpräsenz, Abendmahl in beiderlei Gestalt, Amtsfrage und apostolische Sukzession ausgeräumt seien. Und dafür können sie einige überzeugende Argumente anführen. Aber es ist die Frage zu stellen, ob zum Beispiel ein strenges und nicht ökumenisch ermäßigtes Verständnis der Voraussetzung der Priesterweihe wirklich mit dem evangelischen Theorem vom Priestertum aller Gläubigen vereinbar ist. Das verbindet sich damit, dass in der offiziellen evangelischen Kirche über das theologische Verständnis des Abendmahls vorsichtig formuliert eine gewisse Unklarheit herrscht. Was die evangelische-katholische Ökumene angeht, so lehrt hier ein weiteres Mal die Leuenberger Erklärung den Umgang mit alten Streitigkeiten aus der Vergangenheit. Differenzen müssen theologisch neu bewertet werden, auch in den wichtigen Abendmahlsfragen. Abseits von diesen offiziellen Debatten war das Jahr 2017 begleitet von der Publikation wunderbarer Bücher, aus denen ich außerordentlich viel gelernt habe. Ich zähle dazu, als Gegenentwurf zu Liljes Porträt des protestantisch-heroischen Luther die Biographie, welche die Kirchenhistorikern Lyndal Roper aus Cambridge verfasst hat
Abseits von diesen offiziellen Debatten war das Jahr 2017 begleitet von der Publikation wunderbarer Bücher, aus denen ich außerordentlich viel gelernt habe. Ich zähle dazu, als Gegenentwurf zu Liljes Porträt des protestantisch-heroischen Luther die Biographie, welche die Kirchenhistorikern Lyndal Roper aus Cambridge verfasst hat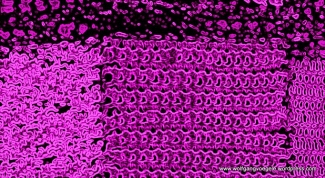 Und man nimmt manche Kritik besser nicht zur Kenntnis, zum Beispiel diejenige der beiden Bürgerrechtler Friedrich Schorlemmer und Christian Wolff, deren früh veröffentlichtes Papier
Und man nimmt manche Kritik besser nicht zur Kenntnis, zum Beispiel diejenige der beiden Bürgerrechtler Friedrich Schorlemmer und Christian Wolff, deren früh veröffentlichtes Papier Ich sagte, es sei gut, wenn man einige Konferenzen nicht besucht habe. Für eine Konferenz gilt das definitiv nicht. Sie fand in Gladbeck statt, gerade kein Zentrum des Reformationstourismus. Schon der Ort war sehr gut gewählt, ein von der evangelischen Kirche aufgegebenes Gemeindezentrum, das in der Folge von einem Verein zum Martin-Luther-Forum mit Ausstellung, Vortragsraum und Konferenzsälen umgenutzt worden war. Die Tagung „Luther reloaded. Brauchen wir eine neue Reformation?“
Ich sagte, es sei gut, wenn man einige Konferenzen nicht besucht habe. Für eine Konferenz gilt das definitiv nicht. Sie fand in Gladbeck statt, gerade kein Zentrum des Reformationstourismus. Schon der Ort war sehr gut gewählt, ein von der evangelischen Kirche aufgegebenes Gemeindezentrum, das in der Folge von einem Verein zum Martin-Luther-Forum mit Ausstellung, Vortragsraum und Konferenzsälen umgenutzt worden war. Die Tagung „Luther reloaded. Brauchen wir eine neue Reformation?“ Am Anfang beschrieb der Historiker Jörn Rüsen (Essen) die Transformationen, welche die Moderne seit den sechziger Jahren durchgemacht hat. Das politische Projekt, mehr Demokratie zu wagen (Willy Brandt) wird abgelöst von Bewegungen des Transhumanen und des human enhancement. Im Fragwürdig werden der universalen, aufgeklärten Moderne, die das Ende der Geschichte ausgerufen hat, sind Fehlbarkeit, Fragilität und Verwundbarkeit des Menschen neu in den Blick gerückt. Entgegen den Unkenrufen der Säkularisierungspropheten hat sich Religion nicht aufgelöst. Auch in der modernen Gesellschaft besteht Bedarf nach Religion und Transzendenz. Rüsen meint nun, dem sei nicht mehr mit einer Unterscheidung zwischen wahrer und falscher Religion beizukommen, sondern nur mit einem humanistischen Koexistenzmodell, das in manchen Punkten der von John Hick und anderen entwickelten Theologie der Religionen nahekommt. Religionen müssen sich mit dem Problem auseinandersetzen, einerseits absolute Wahrheitsansprüche für den eigenen Glauben aufzustellen, andererseits aber mit anderen Religionen konfrontiert zu werden, die diese Absolutheitsansprüche in gleicher Weise stellen.
Am Anfang beschrieb der Historiker Jörn Rüsen (Essen) die Transformationen, welche die Moderne seit den sechziger Jahren durchgemacht hat. Das politische Projekt, mehr Demokratie zu wagen (Willy Brandt) wird abgelöst von Bewegungen des Transhumanen und des human enhancement. Im Fragwürdig werden der universalen, aufgeklärten Moderne, die das Ende der Geschichte ausgerufen hat, sind Fehlbarkeit, Fragilität und Verwundbarkeit des Menschen neu in den Blick gerückt. Entgegen den Unkenrufen der Säkularisierungspropheten hat sich Religion nicht aufgelöst. Auch in der modernen Gesellschaft besteht Bedarf nach Religion und Transzendenz. Rüsen meint nun, dem sei nicht mehr mit einer Unterscheidung zwischen wahrer und falscher Religion beizukommen, sondern nur mit einem humanistischen Koexistenzmodell, das in manchen Punkten der von John Hick und anderen entwickelten Theologie der Religionen nahekommt. Religionen müssen sich mit dem Problem auseinandersetzen, einerseits absolute Wahrheitsansprüche für den eigenen Glauben aufzustellen, andererseits aber mit anderen Religionen konfrontiert zu werden, die diese Absolutheitsansprüche in gleicher Weise stellen. Solche Fragen wurden in der Tagung für verschiedene Religionen durchgespielt. Georg Essen (Bochum) problematisierte für die katholische Kirche zwei Formeln, die Papst Benedikt XVI. in die Diskussion eingebracht hatte. Benedikt hatte bei seinem Deutschlandbesuch in Freiburg die „Entweltlichung“ der Kirche und später ein „Ende der Diktatur des Pluralismus“ gefordert. Beide Formeln kritisierte Essen und legte sie aus als Resignation und Kapitulation vor den Problemen der Moderne. Was das kanonische Recht angeht, so bedarf es einer Revision des (katholischen) Naturrechts und dessen substantialistisch-normativer Setzungen (so Judith Hahn, Bochum). Und der Tübinger Kirchenhistoriker Florian Bock konnte zeigen, wie nach dem großen Reformschritt des 2.Vatikanum die katholische Kirche sich in inhomogene Gruppen von Progressiven und Konservativen aufspaltete. Die Progressiven versammeln sich in gemeindenahen Laienbewegungen, während die Konservativen die Tradition verherrlichen und das vorkonziliare Dogma absolut setzen. Die katholische Kirche ist demnach einem Polarisierungsprozess ausgesetzt, mit dem sie sich langfristig selbst gefährdet. In fünfzig Jahren, so Bock, werde es „romfreie Individualkatholiken“ geben, die sich von einer kleiner gewordenen und weniger universalistischen Papstkirche absetzen.
Solche Fragen wurden in der Tagung für verschiedene Religionen durchgespielt. Georg Essen (Bochum) problematisierte für die katholische Kirche zwei Formeln, die Papst Benedikt XVI. in die Diskussion eingebracht hatte. Benedikt hatte bei seinem Deutschlandbesuch in Freiburg die „Entweltlichung“ der Kirche und später ein „Ende der Diktatur des Pluralismus“ gefordert. Beide Formeln kritisierte Essen und legte sie aus als Resignation und Kapitulation vor den Problemen der Moderne. Was das kanonische Recht angeht, so bedarf es einer Revision des (katholischen) Naturrechts und dessen substantialistisch-normativer Setzungen (so Judith Hahn, Bochum). Und der Tübinger Kirchenhistoriker Florian Bock konnte zeigen, wie nach dem großen Reformschritt des 2.Vatikanum die katholische Kirche sich in inhomogene Gruppen von Progressiven und Konservativen aufspaltete. Die Progressiven versammeln sich in gemeindenahen Laienbewegungen, während die Konservativen die Tradition verherrlichen und das vorkonziliare Dogma absolut setzen. Die katholische Kirche ist demnach einem Polarisierungsprozess ausgesetzt, mit dem sie sich langfristig selbst gefährdet. In fünfzig Jahren, so Bock, werde es „romfreie Individualkatholiken“ geben, die sich von einer kleiner gewordenen und weniger universalistischen Papstkirche absetzen. Genau diesen katholischen Diskussionsstrang kann man auf die protestantische Kirche übertragen. Weil Georg Essen meinte, die große Pathologie des Protestantismus sei die Partikularisierung des Christentums, so ist doch für beide Kirchen die Frage, wie sie die jeweils eingeprägte Organisationskultur (die in beiden Fällen nicht mit der Kirche selbst zu verwechseln ist) modernitätstauglich machen, das heißt sich in „fluide“ Organisationen verwandeln, die von einer Vielzahl von konkurrierenden Gruppen geprägt werden. Und danach stellt sich die Frage nach einer gemeinsamen Identität von Protestantismus und Katholizismus. Die von Bock bemerkten Tendenzen der Zersplitterung der katholischen Kirche lassen sich ja analog auch im Protestantismus finden, etwa im Gegenüber von Kirchentags- und evangelikaler Bewegung.
Genau diesen katholischen Diskussionsstrang kann man auf die protestantische Kirche übertragen. Weil Georg Essen meinte, die große Pathologie des Protestantismus sei die Partikularisierung des Christentums, so ist doch für beide Kirchen die Frage, wie sie die jeweils eingeprägte Organisationskultur (die in beiden Fällen nicht mit der Kirche selbst zu verwechseln ist) modernitätstauglich machen, das heißt sich in „fluide“ Organisationen verwandeln, die von einer Vielzahl von konkurrierenden Gruppen geprägt werden. Und danach stellt sich die Frage nach einer gemeinsamen Identität von Protestantismus und Katholizismus. Die von Bock bemerkten Tendenzen der Zersplitterung der katholischen Kirche lassen sich ja analog auch im Protestantismus finden, etwa im Gegenüber von Kirchentags- und evangelikaler Bewegung. Den Abschlussvortrag hielt der Münchener Systematische Theologie Friedrich Wilhelm Graf. Hilfreich war seine Unterscheidung zwischen Geschichtspolitik, Geschichtsdeutung und -forschung. Denn nur mit Hilfe solcher Unterscheidungen lässt sich die bereits markierte Differenz zwischen der Historisierung Luthers und der Reformation auf der einen und der Selbstverständigungsdebatte des Protestantismus weiter ausarbeiten. Wobei zur Überraschung vieler die kirchliche Deutung der Reformation bei Graf kaum eine Rolle mehr spielte. Und im Grunde nahm Graf in seinem Schlusssatz den Ball auf, den die Katholiken mit ihren Reflexionen über den seit dem 2.Vatikanum immer mehr gespaltenen Katholizismus ihm zugespielt hatten. Einer seiner Schlusssätze lautete: „Wer meint, dass Pluralisierung ein Gewinn ist, der hat in der Reformation etwas zu feiern.“ Graf wusste, dass der Philosoph Georg Friedrich Wilhelm Hegel am Reformationstag stets schon vormittags eine Flasche Rotwein öffnete. Aber es macht doch einen Unterschied, ob man den Weltgeist feiert, der in Martin Luther Gestalt annahm, oder die pluralistische Religionskultur der Gegenwart.
Den Abschlussvortrag hielt der Münchener Systematische Theologie Friedrich Wilhelm Graf. Hilfreich war seine Unterscheidung zwischen Geschichtspolitik, Geschichtsdeutung und -forschung. Denn nur mit Hilfe solcher Unterscheidungen lässt sich die bereits markierte Differenz zwischen der Historisierung Luthers und der Reformation auf der einen und der Selbstverständigungsdebatte des Protestantismus weiter ausarbeiten. Wobei zur Überraschung vieler die kirchliche Deutung der Reformation bei Graf kaum eine Rolle mehr spielte. Und im Grunde nahm Graf in seinem Schlusssatz den Ball auf, den die Katholiken mit ihren Reflexionen über den seit dem 2.Vatikanum immer mehr gespaltenen Katholizismus ihm zugespielt hatten. Einer seiner Schlusssätze lautete: „Wer meint, dass Pluralisierung ein Gewinn ist, der hat in der Reformation etwas zu feiern.“ Graf wusste, dass der Philosoph Georg Friedrich Wilhelm Hegel am Reformationstag stets schon vormittags eine Flasche Rotwein öffnete. Aber es macht doch einen Unterschied, ob man den Weltgeist feiert, der in Martin Luther Gestalt annahm, oder die pluralistische Religionskultur der Gegenwart. Bleibt noch etwas zu sagen über das Playmobilmännchen, das Martin Luther darstellen soll. Anekdoten darüber werden ja stets mit einer gewissen protestantischen Koketterie erzählt. Das 19. Jahrhundert machte aus Martin Luther einen deutschnationalen Heros, einen Kämpfer für Freiheit und Vaterland, den man sich vor die Kirche auf den monumentalen Denkmalsockel stellte. Das 20. Jahrhundert machte aus Luther einen Frühsozialisten, der nicht richtig mit Thomas Müntzer klargekommen war und irgendwo im Niemandsland zwischen Bundesrepublik und der DDR lebte, als ein Früheuropäer mit starkem Hang zu neuen (Druck-)Medien. Der Luther des 21. Jahrhunderts ist ein winziges Playmobilmännchen, keine Denkmalsfigur. Statt deutschmonumental mit Bismarck, Goethe und Schiller oder früheuropäisch mit Bucer, Calvin und Bugenhagen konkurriert er nun mit Darth Vader, Luke Skywalker, Superman und Elvis Presley.
Bleibt noch etwas zu sagen über das Playmobilmännchen, das Martin Luther darstellen soll. Anekdoten darüber werden ja stets mit einer gewissen protestantischen Koketterie erzählt. Das 19. Jahrhundert machte aus Martin Luther einen deutschnationalen Heros, einen Kämpfer für Freiheit und Vaterland, den man sich vor die Kirche auf den monumentalen Denkmalsockel stellte. Das 20. Jahrhundert machte aus Luther einen Frühsozialisten, der nicht richtig mit Thomas Müntzer klargekommen war und irgendwo im Niemandsland zwischen Bundesrepublik und der DDR lebte, als ein Früheuropäer mit starkem Hang zu neuen (Druck-)Medien. Der Luther des 21. Jahrhunderts ist ein winziges Playmobilmännchen, keine Denkmalsfigur. Statt deutschmonumental mit Bismarck, Goethe und Schiller oder früheuropäisch mit Bucer, Calvin und Bugenhagen konkurriert er nun mit Darth Vader, Luke Skywalker, Superman und Elvis Presley.