
Outsider |
„Wir müssen die Ambivalenzen stehen lassen ...“Ein Interview mit Daniel BaumannKarin Wendt
Wendt: Bis vor kurzem waren Sie Kurator der Adolf Wölfli-Stiftung am Kunstmuseum Bern, die das Werk dieses Künstlerpioniers auf dem Gebiet der Outsider Art betreut; seit zwei Jahren leiten Sie die Kunsthalle Zürich, und Sie gehören international zu den innovativsten Ausstellungsmachern der Gegenwart. Mich interessiert zunächst, hat die Beschäftigung mit dem Werk von Adolf Wölfli Ihre kunsthistorische Sicht, Ihr ästhetisches Denken beeinflusst, und umgekehrt, hat die kuratorische Arbeit mit zeitgenössischer Kunst Ihre Haltung zur Outsider Art geprägt, ihr vielleicht einen bestimmten Fokus, einen bestimmten Drive gegeben? Baumann: Genau so ist es. Ich habe in Genf ganz klassisch Kunstgeschichte und Deutsche Literatur studiert und parallel zum Studium in der Adolf Wölfli-Stiftung zu arbeiten begonnen. Das war ein regelmäßiger, interessanter Seitenschritt, heraus aus der Akademie, der Universität, der Kunstwelt, hinein in dieses Werk von Adolf Wölfli, welches mir für vieles den Blick geschärft hat, insbesondere für die Denkweise der Kunstgeschichte, der Universität und eben auch der Kunstwelt; und das hat dann zu einem doch viel kritischeren Blick auf diese Gebiete geführt. Von meinen Fachkollegen wurde ich natürlich ein bisschen belächelt, dass ich mich für so etwas interessiere und auch, dass ich daran fast fünfundzwanzig Jahre festhalte. Es war mir all die Jahre aber ein guter Ausgleich, weil ich sonst fast ausschließlich in der zeitgenössischen Kunst tätig war. Wölfli zwang mich zu Distanz, sein Werk war nicht Teil des Kanons, und man wusste nicht genau, in welchem Verhältnis es dazu stand. Ich war und bin überzeugt, dass sein Werk künstlerisch qualitativ hochstehend ist, ja, es wurde mir zu einer Benchmark. Bis heute vergleiche ich die Arbeit von Künstlern mit jener von Wölfli und finde dann, selbst wenn sie vielleicht schon viel diskutiert sind, dass sie nicht mal zur Hälfte an Wölfli heranreichen. Sein Werk ist mir also immer auch ein guter Reality-Check. So verdanke ich Wölfli wahrscheinlich mehr, als ich ihm je geben konnte. Da ich das zweite Bein in der zeitgenössischen Kunst hatte, gab es mir dann umgekehrt aber auch einen Außenseiterblick auf die Außenseiter-Szene, auf die Outsider Art, und da war mein Eindruck, dass auch die Outsider Art, die Art Brut, genau wie die Universität und die zeitgenössische Kunstwelt ihre eigenen Akademismen entwickelt hat. Das hat mich dann ebenso sehr gestört wie das andere, so dass ich angefangen habe, auch diese zu kritisieren oder in Frage zu stellen. Beides hat sich also irgendwie gegenseitig gut befruchtet – als Position war es natürlich ein bisschen schwierig, weil ich in beiden Feldern sozusagen ein Außenseiter war. Wendt: Aus dem was Sie schildern, wird deutlich, dass sich mit Blick auf die Outsider Art bestimmte Konflikte ergeben, weil wir hier Arbeiten begegnen, die nicht Teil des Kanons (geworden) sind, mit denen wir uns aber gleichwohl auf der Höhe der Kunst auseinandersetzen wollen – aber wie? Eine zentrale Rolle spielt dabei ja der Stellenwert der Biografie des Künstlers. Sie sagen, dass sich da im Umgang im Umgang mit Outsider Art eine Art Dilemma ergibt. Könnten Sie das skizzieren? Baumann: Es hat damit zu tun, wie sich im 20. Jahrhundert die Kunstbetrachtung, die Kunstgeschichte, aber auch die Literaturgeschichte entwickelt haben, dass nämlich – besonders ab den 50er Jahren – darauf insistiert wurde, Werk und Person strikter zu trennen, bis hin zum Degré zéro de l‘écriture[1]. Es war dieser Traum, dass ein Kunstwerk vollständig autonom funktioniert, unabhängig seines Autors und des Menschen hinter dem Autor. Das war ein wichtiger Schritt, denn damit rückte das Werk in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, nicht die Biografie. Die Betrachterinnen und Betrachter wurden somit ermächtigt, ohne Wissen zu Grund und Herkunft ein Kunstwerk zu lesen, zu debattieren und es sich dadurch anzueignen. Das heißt aber auch, dass sie für ihre Rezeption die Verantwortung übernehmen mussten. Im Falle der Art Brut schien mir aber, dass die enge Verknüpfung von Biografie und Werk durch die Hintertür wieder eingeführt wurde. Dagegen habe ich mich gewehrt, weil es die Kunst zu einem Symptom reduzierte, also „Kunst von Außenseitern“, „rohe Kunst“, „zustandsgebundene Kunst“ usw. Ich sah darin einen Biografie-Voyeurismus, der mir reaktionär erschien, aber in der Art-Brut-Szene durchaus Standard war. Bis heute bin ich der festen Überzeugung, dass Kunst viel mehr ist als der Spiegel einer Lebensgeschichte, dass genau in diesem Mehr ihre eigentliche Kraft liegt. Gleichzeitig habe ich beim Studium von Wölfli gesehen, dass man auf unglaubliche soziale Realitäten trifft, die auf keinen Fall verschwiegen werden dürfen. Da aber ergab sich dieses Dilemma, dass, wenn ich jetzt Wölflis Biografie unterschlage, ich gleichzeitig gravierende gesellschaftliche Missstände verschweige. Die Frage war dann also, wie kriegt man das hin? Ich fragte mich dann auch, ob es sich mit diesen beiden Polen Biografie und Werk analog verhielt wie mit der großen, das 20. Jahrhundert prägenden Antinomie zwischen Abstraktion und Figuration.
Baumann: Auf jeden Fall. Aber da entsteht nun ein zweites Dilemma – nehmen wir das Beispiel der Dadaisten: Ja, ihre Werke haben zu Lesarten geführt, die uns wiederum ermöglicht haben, Wölfli zu schätzen. Das Dilemma ist aber, dass das nichts erklärt. Wendt: Aber denken Sie nicht, dass wir erst heute frei auf Kunst wie die von Wölfli blicken, indem wir sie nicht nur als Ausdruck einer innerpsychischen Verfassung, sondern als Bearbeitung von Wirklichkeit verstehen, weil wir den Eigenwert ästhetischer Erfahrung anerkennen? Baumann: Ja, es gibt einem die Instrumente zur Hand, um es überhaupt als relevant zu erkennen, aber es erklärt das Werk nicht. Das finde ich gerade das Interessante daran, es ermöglicht Wertschätzung, aber noch nicht Lesbarkeit; es gibt Lautgedichte, die ich dank Dada als Auflösung der Sprache verstehe, und es gibt zur gleichen Zeit Lautgedichte bei Wölfli, die gleich funktionieren, das Gleiche mit Sprache machen – und trotzdem etwas ganz anderes sind. Was aber genau passiert da? Das ist das Komische, man bekommt Werkzeuge, die es einem sozusagen erlauben, die Tür zu öffnen, aber noch nicht einzutreten. Oder anders gesagt: Wölfli kannte die Dadaisten nicht, hätte sich aber auch nicht für sie interessiert, weil er an etwas anderem arbeitete. Dass Menschen zur gleichen Zeit unweit voneinander aus verschiedenen Gründen zum gleichen Resultat kommen, ist erstaunlich. Die Geschichte hat dafür kaum Erklärungsmodelle, das hat mich immer fasziniert. Wendt: Offenbar baut das Phänomen Outsider Art eine bestimmte Spannung auf. Ich muss dabei unter anderem auch an Arbeiten von Artur Žmijewski denken, etwa Glucky Bach, wo er mit gehörlosen Menschen Kantaten von Bach einspielt oder Blindly, wo er mit blinden Menschen malt. Es sind Arbeiten, bei denen der Widerstreit von Ethik und Ästhetik ausgehalten werden muss, er wird nicht vermittelt. Liegt vielleicht in dem Phänomen Outsider Art auch so ein Potenzial, uns mit den Voraussetzungen unserer eigenen Kriterien zu konfrontieren? Baumann: Davon bin ich überzeugt. Ein Ziel der Adolf Wölfli-Stiftung war es ja, diesen Menschen und Künstler einerseits aus der Psychiatrie herauszuholen, ganz buchstäblich, das Werk von der psychiatrischen Klinik Waldau ins Museum zu transferieren, ihn aber eben auch aus der Ecke der Volkskunst und des Dekorativen wie auch aus der Ecke der Naiven zu holen. Mit der Entscheidung, die Stiftung im Kunstmuseum anzusiedeln, hat man sich der Frage ausgesetzt, in welchem Verhältnis er zum Rest der Kunst steht. Es war von Elka Spoerri, der Mitbegründerin der Adolf Wölfli-Stiftung, von Harald Szeemann und vielen anderen wirklich der Versuch, Wölfli als zeitgenössischen Künstler zu etablieren, manchmal im Konflikt mit dem Musée de l’art brut in Lausanne. Das haben wir, glaube ich, mit viel Engagement verfolgt. Ich habe dann in den letzten zehn Jahren aber auch erkennen müssen, dass das trotz aller kuratorischen Anstrengungen nicht so ganz klappt. Vielleicht war es auch etwas naiv, wie wir uns das vorgestellt haben, denn heute scheint mir, dass genau darin, dass Wölflis Werk letztlich nicht ganz in den Kanon integrierbar ist, ein wichtiger Teil seiner Qualität liegt. Er ist und bleibt ein Fremdkörper, er gehört dazu und doch wieder nicht. Wir haben uns alle die Zähne ausgebissen an der Widerständigkeit dieses Werks, das so viele spannungsreiche Fragen zu Geschichte, zu Biografie, zu unserem Denken und unseren Beurteilungskriterien stellt. Kunst wie die von Wölfli erscheint uns hoch modern, im Grunde ist sie aber ein Affront gegenüber der Ideologie der Moderne, die ja versucht hat, der Kunst einen weitest möglichen Autonomiestatuts zu verleihen. Dem hat dann aber eine Kunst wie die von Wölfli widersprochen, denn sie hat sich abseits dieses Autonomiestrebens entwickelt. Auf der einen Seite lief sie der bürgerlichen Kunstauffassung von gesunder Kunst, Meisterwerk, Geistesgegenwart und Vernunft entgegen, auf der anderen Seite wurde sie von der Avantgarde verehrt, widerlegte aber alle ihre Ideen. Oberflächlich sah Wölflis Kunst tatsächlich wie Avantgarde aus, also Collage, Lautgedicht, Vermischung von Text und Bild usw., aber in der Tiefe ging es um etwas anderes. Denn obschon sich Klee und viele andere auf Kunst wie die von Wölfli berufen und gestützt haben, stand sie im Grunde im Widerspruch zu deren Kunstvorstellung, die dann ab den 50er Jahren die Kunstgeschichte und die Institutionen der Nachkriegszeit so grundlegend bis heute geprägt hat: die Idee der Autonomie, wie sie vom abstrakten Gemälde und von der abstrakten Skulptur so exemplarisch vertreten wurde. Ein Werk aber wie das von Wölfli ist ein un-autonomes Werk, das sich zwischen Stuhl und Bank entwickelt. Wendt: Meinen Sie damit, dass die Idee der Autonomie, wenn man sie auf Outsider Art überträgt, diese in ideologischer Absicht idealisiert?
Wendt: Bei all dem geht es ja auch um unseren Blick auf die Menschen, die Urheber dieser Kunst. Der Künstler und Theologe Thomas Lehnerer hat einmal gesagt, Kunst ist eine Methode aus Freiheit. Kann es sein, dass wir die Freiheit der Menschen, die ihre Arbeit nicht mit den uns vertrauten ästhetischen oder kulturellen Kategorien reflektieren, nicht im vollen Sinne annehmen und ihren Arbeiten deshalb die ästhetische Souveränität absprechen? Baumann: Ja, obschon die Rede von der ästhetischen Souveränität natürlich letztlich analog ist zur Idee der Autonomie. Der Postkolonialismus und der Feminismus haben solche Kategorien und Wertvorstellungen grundsätzlich hinterfragt, auch als nicht unschuldigen Idealismus entlarvt, und über Geschichte und Geschlecht einen Biografiebegriff wieder ins Spiel gebracht, der vieles aufgebrochen hat. Da passierte etwas, wovon dieses Feld, in dem wir mit Wölfli und anderen Künstlern arbeiten, eigentlich hätte profitieren können – es wurde aber nicht genutzt. Im Fall von Feminismus und Postkolonialismus haben die Betroffenen sich formiert, das Wort ergriffen, neue Lesarten gefordert und auch durchgesetzt. Im Falle von Künstlern wie Wölfli ist das Problem jedoch, dass sie so etwas nicht tun können, weil sie völlig vereinzelt sind, keine Lobby bilden können, nicht gemeinsam das Wort ergreifen. So etwas wie grassroots (Graswurzelbewegung) findet hier eben nicht statt, der Diskurs bleibt immer ein von außen implementierter. Das ist denn auch die große Fragilität dieser Werke. Wendt: Neue Lesarten zu entwickeln, wäre also im Fall von Menschen, die das selbst nicht können, Aufgabe derjenigen, die sie begleiten und fördern. Mein Eindruck ist, dass es aber eher so etwas wie eine Selbstghettoisierung der Outsider-Szene gibt, die auf Wiedererkennungsmerkmale setzt und alten Deutungsmustern verhaftet bleibt?
Aber auch diesem Vorgehen kann man vorwerfen, dass es letztlich gut gemeinte Krücken sind, um Inklusion zu forcieren. Aber brauchen das diese Werke überhaupt? Ich behaupte nein. Für die 2013 Carnegie International in Pittsburgh sind wir dann einen Schritt weiter gegangen. Die Carnegie International ist eine der ältesten Biennalen für zeitgenössische Kunst, sie fand ursprünglich jährlich statt, mittlerweile alle fünf Jahre. Ich habe sie 2013 zusammen mit Dan Byers und Tina Kukielski kuratiert und wir haben 35 Künstler aus rund 20 Ländern gezeigt, unter ihnen den amerikanischen Künstler Joseph Yoakum (1889-1972) und die chinesische Zeichnerin Guo Fengyi (1942-2010). Ihre Werke werden hauptsächlich im Feld der Outsider Art rezipiert, wir haben sie aber gleich wie Frances Stark, Wade Guyton, Nicole Eisenman usw. behandelt. Ich habe darauf geachtet, dass sie nicht als Outsider gelabelt werden und der Presseabteilung dementsprechend Anweisungen gegeben. Natürlich wurde das bedauert, weil uns damit ein spektakuläres Marketinginstrument entglitt. Es hat aber den Blick auf das Werk geöffnet und uns gezwungen, andere Worte, eine andere Vermittlung zu finden: nämlich zu erklären, worum es in dieser Kunst tatsächlich geht, worauf sie sich bezieht und was sie anderes in unser Leben bringt. Bezüglich der Selbstghettoisierung der Außenseiter-Kunst ist festzuhalten, dass mittlerweile die Outsider Art World die Insider Art World weitgehend repliziert hat. Es gibt hier wie dort Zeitschriften, Messen, Ausstellungen, Auktionen, Theoretiker und sie sprechen mehrheitlich dieselbe Sprache. In den 60er und 70er Jahren war das vielleicht noch offener, interdisziplinärer, inzwischen hat sich aber ein Outsider-Art-Establishment gebildet mit den dazugehörigen Insignien – eine ehemalige Subkultur, die sich kaum noch von der Mainstream-Kultur unterscheidet. Wäre das als Ausdruck eines Manierismus zu deuten, also als Hinweis, dass die Aufteilung nicht mehr relevant ist? Wenn es so wäre, müsste das eine Feld im anderen aufgehen. Kommt mit der zunehmenden Akzeptanz der Verlust der Andersartigkeit, welche dieses Feld geradezu kultisch verehrt? Handelt es sich um eine einfache ökonomische Entwicklung, d.h. dass die Art Brut mittlerweile genügend Marktbreite hat, finanzierbar ist usw.? Wendt: Vielleicht auch geschuldet der Politik, die ja nicht unbedingt die Freiheit im Blick hat und mit dem Stichwort Inklusion für alles und nichts das Potenzial dieser Kunst weiter zähmen will? Baumann: Und von daher hat diese letztendliche Nichtintegrierbarkeit von Wölfli und anderen ihr Positives. Was uns aber schon damals geärgert hat, ist, wenn Nichtintegrierbarkeit als idealistische Vorstellung einer Freiheit verstanden und verkauft wird, halt diese Aussteiger-Idee. Das fanden wir viel zu romantisch. Es geht vielmehr um die Fremdkörper in einem System, die wichtig sind, weil sie die Wände dehnen und unser Denken herausfordern. Darin liegt ihre Bedeutung. Eine vergleichbare Problematik lag Il Palazzo Enciclopedico, dem Venedig Biennale-Projekt von Massimiliano Gioni, zu Grunde. Ich habe die Ausstellung genossen, sehr viel interessante Kunst, bleibe aber gegenüber seiner Metapher vom Palazzo Enciclopedico kritisch, weil es sich um einen Rückgriff auf eine ahistorische Vorstellung von Kunst handelt, eine Art Palast des Universellen, der alles vereint, wo alles möglich ist, Differenzen keine Rolle spielen und ein enzyklopädisches ABC eine geschichtliche Betrachtung ersetzt bzw. verhindert. Wo wir doch heute wissen, dass gerade das Enzyklopädische ein ideologisches Konstrukt zur Behauptung und Beherrschung von Welt ist. Da gab es eine Naivität oder Coolness, die reaktionäre Züge trug. Wendt: Über das kuratorische Konzept von Gioni für die Venedig Biennale 2013 haben Sie ja unter anderen mit Peter Fischli diskutiert zu Doing the Things Which are Missing im Salon of Everything. Ich hatte einen ähnlichen Vorbehalt, dass durch die Rahmenmetapher, aber auch durch Exponate wie das Buch von C.G. Jung wieder der erwartbare Kontext aufgerufen wurde, ‚Kunst und Wahn‘, ‚Kunst und Psychoanalyse‘. Man konnte den bildnerischen Argumenten nicht nachgehen. Baumann: … weil sie überstülpt wurden durch das Universale, das alles andere überdeckte und nivellierte. Wendt: Interessant war aber ja, dass Gioni weitgehend positiv gewürdigt wurde, während etwa die Ausstellung „Inner Worlds Outside“[4] 2006 in der White Chapel Gallery eher verrissen wurde. Hier hat man gesagt, Werke der Outsider und der zeitgenössischen Kunst hätten sich gegenseitig ruiniert. Baumann: Ich habe die Ausstellung nicht gesehen, aber der Fehler damals war vielleicht der Versuch, die Outsider Artists auf die Ebene etwa von Paul Klee oder anderen hochzuheben. Also zu sagen: hier die Meister, da die Meister, und ich bringe sie beide zusammen; aber die beiden Meistergruppen blieben unvereint – und das hat Gioni nicht gemacht. Er hat ein bisschen wie im Internet alles zusammengesurft mit einem Rückgriff auf ein humanistisches Ideal, von dem wir wissen, dass es eigentlich nur noch von Verrückten eingefordert werden kann. Dieses hat er dann mit einer coolen Cloud-Ästhetik verbunden, wo alles mit allem kombiniert werden kann. Aber worum genau ging es da eigentlich? Das wurde nicht klar. Wendt: Gut gezaubert …
Wendt: Jetzt sind wir mitten in der Diskussion darum, wie man Werke der Outsider Art heute kuratiert. Geht es darum, das Magazin der einen kunsthistorischen Erzählung (weiter) zu öffnen, um endlich auch die Ränder der Moderne, ihre Randgänge neu zu erschließen? Baumann: Immer wieder. Im Folkwang Museum gab es ja zuletzt mit der Ausstellung „Der Schatten der Avantgarde“[6] einen neuen Vorschlag, die Narrative neu zu denken. Die Ausstellung „Künstler und Propheten“[7] (7), die 2015 in der Schirn in Frankfurt gezeigt wurde, leistete genau das.
Es gab im deutschen Sprachraum diese Mischung aus Lebensreform und Aufbruch, Theosophie, Kunst und Ästhetik, und dann gab es diese Figuren, die selbsternannten Propheten, die genau in diesem Zwischenbereich anzusiedeln sind. Manche von denen hatten Gefolgschaft, manche könnten aber auch als Outsider bezeichnet werden. Pamela Kort, die Kuratorin der Ausstellung, hat da einen Bereich geöffnet, wo Dinge viel weniger definiert sind und plötzlich eine Ambivalenz sichtbar wurde, die dann stellenweise in die Katastrophe der 1930er Jahre führte. Das war eine wirklich interessante Ausstellung, weil sie den Zugang anders gesucht hat, weil sie ein ambivalentes Künstlerbild herausgearbeitet und hat stehen lassen, womit wir gezwungen waren, Position zu beziehen. Wendt: Wir müssen also weiter versuchen, Werke wie die von Wölfli oder zeitgenössische Arbeiten wie die Healing Machines von Emery Blagdon besser zu verstehen …? Baumann: … ästhetisch, aber auch inhaltlich. Da liegt vielleicht ein weiteres Problem, weil es eine Inhaltlichkeit ist, die oft heikel bleibt. Bei Künstlern der Outsider Art begegnet man einer Ausweitung des Geistes und tritt schnell mal in dieses weite Feld des Unverständlichen, Problematischen und Esoterischen – ein Minenfeld. Wie kann man diesen Denkformen gerecht werden, ohne sie zu verkitschen, sie abzulehnen oder misszuverstehen? Das ist, nach der Biografie mit all den komplizierten Implikationen und einem Werk, das eine eigene Form von Autonomie behauptet, indem es mit allen Konventionen bricht, das dritte Problem: die manchmal irrationalen Vorstellungen oder auch magischen Sichtweisen, denen man gegenüber tritt. Aber genau das macht den Spaß aus, sich Dingen zu stellen, die man nicht versteht, die aber wichtig erscheinen, also immer wieder dieses Vergnügen, Wege zu finden und die Welt besser zu verstehen ... Klingt jetzt recht banal, ist doch aber so, oder? (lacht).
Anmerkungen[1] Roland Barthes: Le Degré zéro de l‘écriture, Paris 1953. [2] Albert Anker – Adolf Wölfli. Parallele Welten. Mit Beiträgen von Daniel Baumann, Therese Bhattacharya, Renate Böschenstein und Toni Stooss, Kunstmuseum Bern 1999. [3] Daniel Baumann/Monika Brunner: Kopfreisen: Jules Verne, Adolf Wölfli und andere Grenzgänger, Frankfurt 2002 [4] Inner Worlds Outside. Mit Beiträgen von Felix Andrada/Eimear Martin/Anthony Spira, Whitechapel Gallery / Irish Museum of Modern Art, 2006. [5] Harald Szeemann (Hrsg.): Der Hang zum Gesamtkunstwerk, Kunsthalle Zürich u.a., Aarau und Frankfurt/M. 1983 [6] Kasper König/Falk Wolf: Der Schatten der Avantgarde. Rousseau und die vergessenen Meister, Folkwang Museum, Essen 2015. [7] Max Hollein/Pamela Kort (Hrsg.): Künstler und Propheten. Eine geheime Geschichte der Moderne 1872-1972, Schirn Kunsthalle, Frankfurt/M. 2015. |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/106/kw75.htm |

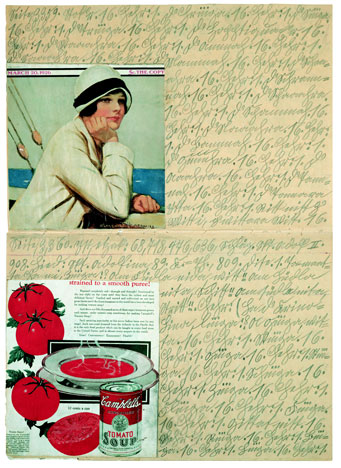 Wendt: Ich habe mich gefragt, ob das wirklich ein Dilemma ist oder nicht vielleicht der Anfang von Aufklärung? Mein Gedanke ist folgender: Wir haben doch erst, nachdem wir verstanden hatten, worin etwa die Leistung der
Wendt: Ich habe mich gefragt, ob das wirklich ein Dilemma ist oder nicht vielleicht der Anfang von Aufklärung? Mein Gedanke ist folgender: Wir haben doch erst, nachdem wir verstanden hatten, worin etwa die Leistung der  Baumann: Das ist tatsächlich eines der Probleme. Wenn man sie so rezipiert wie den Rest der Kunst des 20. Jahrhunderts, nämlich bei aller Verschiedenheit der Konzepte davon ausgeht, dass das Werk eine autonome Einheit ist, die unabhängig vom Autor über unsere Rezeption sozusagen vollendet wird, wird ganz vieles nicht erfasst. Es ist, als würde man einen Raum voller Picassos in Rot ausleuchten. Ein Werk wie jenes von Wölfli stellt eine Reihe unserer Grundüberzeugungen in Frage, durchaus auch explosiv. Allein schon die Tatsache, dass ein Vollwaise, Pflegekind, Knecht und Psychiatrieinsasse überhaupt eigenständige Kunst macht. Das hat natürlich jemand wie Dubuffet früh gemerkt und dieses unglaubliche Potenzial innerhalb seines Anti-Akademismus- und Anti-Institutions-Programms genutzt. Die Avantgarde wiederum musste ein Werk wie jenes von Wölfli verehren, weil dort gewisse Prinzipien, die sie ablehnten, ebenfalls keine Bedeutung hatten. Die Überzeugungen dieser Avantgarde, auf welcher letztendlich dann aber die Institutionen und die Kunstgeschichte aufbauen, wurde durch Wölflis Werk auf anderer Ebene gleichzeitig widerlegt. Wenn auch die Faszination groß war, so passte er in Wirklichkeit doch nicht in ihre große Erzählung hinein, oder eben nur als Außenseiter. Böse gesagt diente er letztlich dazu, die Grenzen der Institution und ihrer Kunstauffassung klarer abzustecken. Positiv gedreht können wir im Werk von Wölfli aber eine doppelte Widerständigkeit erkennen, die höchst selten ist und durchaus mit künstlerischer Qualität zu tun hat. Wölflis Kunst beweist nicht nur Widerständigkeit gegen die Kunstgeschichte als Institution, sondern sie zeigt sich auch widerständig gegenüber der Avantgarde und ihrer Idee des autonomen Kunstwerks, eine Vorstellung, die bekanntlich dann ab den 1960er Jahren von Feminismus und Postkolonialismus mit Recht als Ideologie entlarvt wurde. Die Auseinandersetzung mit Wölflis Weltentwurf hat meinen Blick auf solche Abhängigkeiten und Zustände bedeutend geschärft.
Baumann: Das ist tatsächlich eines der Probleme. Wenn man sie so rezipiert wie den Rest der Kunst des 20. Jahrhunderts, nämlich bei aller Verschiedenheit der Konzepte davon ausgeht, dass das Werk eine autonome Einheit ist, die unabhängig vom Autor über unsere Rezeption sozusagen vollendet wird, wird ganz vieles nicht erfasst. Es ist, als würde man einen Raum voller Picassos in Rot ausleuchten. Ein Werk wie jenes von Wölfli stellt eine Reihe unserer Grundüberzeugungen in Frage, durchaus auch explosiv. Allein schon die Tatsache, dass ein Vollwaise, Pflegekind, Knecht und Psychiatrieinsasse überhaupt eigenständige Kunst macht. Das hat natürlich jemand wie Dubuffet früh gemerkt und dieses unglaubliche Potenzial innerhalb seines Anti-Akademismus- und Anti-Institutions-Programms genutzt. Die Avantgarde wiederum musste ein Werk wie jenes von Wölfli verehren, weil dort gewisse Prinzipien, die sie ablehnten, ebenfalls keine Bedeutung hatten. Die Überzeugungen dieser Avantgarde, auf welcher letztendlich dann aber die Institutionen und die Kunstgeschichte aufbauen, wurde durch Wölflis Werk auf anderer Ebene gleichzeitig widerlegt. Wenn auch die Faszination groß war, so passte er in Wirklichkeit doch nicht in ihre große Erzählung hinein, oder eben nur als Außenseiter. Böse gesagt diente er letztlich dazu, die Grenzen der Institution und ihrer Kunstauffassung klarer abzustecken. Positiv gedreht können wir im Werk von Wölfli aber eine doppelte Widerständigkeit erkennen, die höchst selten ist und durchaus mit künstlerischer Qualität zu tun hat. Wölflis Kunst beweist nicht nur Widerständigkeit gegen die Kunstgeschichte als Institution, sondern sie zeigt sich auch widerständig gegenüber der Avantgarde und ihrer Idee des autonomen Kunstwerks, eine Vorstellung, die bekanntlich dann ab den 1960er Jahren von Feminismus und Postkolonialismus mit Recht als Ideologie entlarvt wurde. Die Auseinandersetzung mit Wölflis Weltentwurf hat meinen Blick auf solche Abhängigkeiten und Zustände bedeutend geschärft.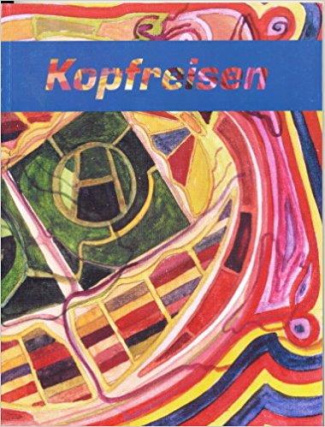 Baumann: Ich habe mehrere Versuche unternommen, das Werk von Wölfli anders zu kontextualisieren, neue Deutungsmuster zu erproben. 1999 organisierte ich zusammen mit der Kunsthistorikerin Therese Bhattacharya die Ausstellung „Albert Anker – Adolf Wölfli. Parallele Welten“.
Baumann: Ich habe mehrere Versuche unternommen, das Werk von Wölfli anders zu kontextualisieren, neue Deutungsmuster zu erproben. 1999 organisierte ich zusammen mit der Kunsthistorikerin Therese Bhattacharya die Ausstellung „Albert Anker – Adolf Wölfli. Parallele Welten“.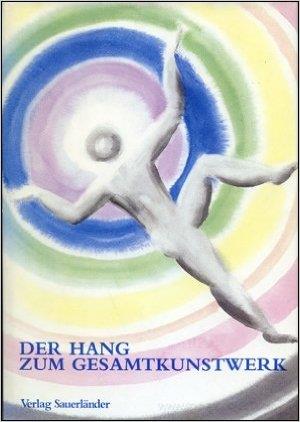 Baumann: Ja, gut gezaubert. Ich hab auch Leute getroffen, die sofort allergisch reagiert haben, weil sie das Gefühl hatten, sie würden verführt und hintergangen. Jemand meinte, es sei wie wenn man bei jemandem zu Hause eingeladen ist, bei dem die besten Bücher im Schrank stehen, aber man bald merkt, dass er sie nicht gelesen hat. Was fehlte, war, dass diese Biennale keinen neuen Narrativ auf die Beine gestellt hat. Was die Museen, die Biennalen und die Kunstgeschichte meines Erachtens jedoch leisten müssen, d.h. Narrative öffnen, neue erproben. So wie es Szeemann 1983 in seiner Ausstellung „Der Hang zum Gesamtkunstwerk“
Baumann: Ja, gut gezaubert. Ich hab auch Leute getroffen, die sofort allergisch reagiert haben, weil sie das Gefühl hatten, sie würden verführt und hintergangen. Jemand meinte, es sei wie wenn man bei jemandem zu Hause eingeladen ist, bei dem die besten Bücher im Schrank stehen, aber man bald merkt, dass er sie nicht gelesen hat. Was fehlte, war, dass diese Biennale keinen neuen Narrativ auf die Beine gestellt hat. Was die Museen, die Biennalen und die Kunstgeschichte meines Erachtens jedoch leisten müssen, d.h. Narrative öffnen, neue erproben. So wie es Szeemann 1983 in seiner Ausstellung „Der Hang zum Gesamtkunstwerk“

 Das Interview wurde zuerst veröffentlicht in: Lisa Inckmann / Karin Wendt: Das Kunsthaus Kannen Buch. Kunst der Gegenwart – Art Brut und Outsider Art, Alexianer GmbH (Hg.), Bielefeld: Kerber 2016, S. 43-51.
Das Interview wurde zuerst veröffentlicht in: Lisa Inckmann / Karin Wendt: Das Kunsthaus Kannen Buch. Kunst der Gegenwart – Art Brut und Outsider Art, Alexianer GmbH (Hg.), Bielefeld: Kerber 2016, S. 43-51.