Horst Schwebel
|
Der folgende Text stammt aus dem Buch von
Horst Schwebel (1979): Glaubwürdig. Fünf Gespräche über heutige Kunst und Religion mit Joseph Beuys, Heinrich Böll, Herbert Falken, Kurt Marti, Dieter Wellershoff. München: Kaiser (Kaiser-Traktate, 40), S. 97-125.
Wir publizieren ihn in Erinnerung an Kurt Marti, der am 11. Februar 2017 im Alter von 96 Jahren in Bern gestorben ist.
|

|
In Ihrem Buch »Grenzverkehr« führen Sie aus, dass die Kunst für Theologie und Christentum wichtig werden kann, so wie umgekehrt die Kunst von der Religion wesentliche Impulse erhalten könnte. Mit dem Grenzbereich zwischen Literatur und Kunst auf der einen Seite und Christentum und Theologie auf der anderen Seite sind Sie ja vertraut. Ich möchte Sie nun auf Ihre Erfahrungen ansprechen. Haben Sie diese Rolle, dazwischen zu sein, als angenehm empfunden, oder haben Sie's gar bedauert, dass Sie zwischen diesen beiden Polen existieren?
Es war weder angenehm, noch habe ich's bedauert. Das fiel mir einfach zu durch meine Interessen, Begabungen. So bin ich da reingerutscht. Es ist anregend, würde ich sagen, das ist etwas anderes als angenehm.
Kann es sein, dass dann die Kirchenleute sagen: der gehört eigentlich nicht zu uns, der gehört zu den anderen? Oder dass diejenigen, die sich mit Literatur beschäftigen, sagen: das ist ja ein Pfarrer, der gehört nicht richtig zur Literatur dazu? - Kennen Sie diese Haltung, dass man zwischen beiden Stühlen sitzt, nirgendwo fest aufbewahrt, sondern von beiden Seiten beargwöhnt?
Ja, der Ort zwischen den Stühlen ist natürlich gegeben. Nur glaube ich feststellen zu können, dass die Leute in Gemeinde und Kirche, dass Kirchenleitung und Kollegen das jetzt einfach hinnehmen. Sie haben sich daran gewöhnt, dass ich beides mache. Von ihrer Seite bekomme ich hie und da sogar Ermutigung.
War das schon immer so, dass man Sie ermutigte, diese Doppelrolle wahrzunehmen?
 Nein. Am Anfang gab's manche Kritik und Auseinandersetzungen. Es sei verlorene Zeit oder Allotria, von der Kirche her gesehen. Das gibt's - muss ich noch ergänzen - auch heute noch, dass Leute in der Kirche oder Kollegen das, was ich tue, für Unsinn und überflüssig halten. Das gibt's noch immer, nur bekomme ich es weniger zu hören.
Nein. Am Anfang gab's manche Kritik und Auseinandersetzungen. Es sei verlorene Zeit oder Allotria, von der Kirche her gesehen. Das gibt's - muss ich noch ergänzen - auch heute noch, dass Leute in der Kirche oder Kollegen das, was ich tue, für Unsinn und überflüssig halten. Das gibt's noch immer, nur bekomme ich es weniger zu hören.
Lesen Ihre Gemeindeglieder Ihre Bücher?
Es kommt darauf an, was für Bücher. Die »Leichenreden«, die Dialektgedichte sind doch sehr bekannt. Auch das »Politische Tagebuch« ist in der Gemeinde gelesen worden, natürlich nicht von allen. Viele Leute lesen überhaupt nicht.
Im Augenblick ist das für die Kirche, die Kirchenleitung und die Kollegen sehr einfach, Ihre Dinge gutzuheißen, da Sie ein bekannter Autor sind. Das war natürlich nicht immer so, sondern irgendwann mussten Sie ja anfangen. Erinnern Sie sich - außer an den Vorwurf, Allotria zu betreiben — noch an andere Einwände, die man damals erhob?
 Eines der ersten Bücher, die ich publiziert habe, waren die »Republikanischen Gedichte« (1959), Gedichte politischen Inhalts. Da stellte sich manchen die Frage: was soll das, ein Pfarrer, der solche Gedichte macht? Kritische, wenn auch nur mäßig gesellschaftskritische Gedichte, das schickt sich doch nicht! Die Kritik ging bei den ersten Sachen in diese Richtung: Politik hat mit Kirche nichts zu tun.
Eines der ersten Bücher, die ich publiziert habe, waren die »Republikanischen Gedichte« (1959), Gedichte politischen Inhalts. Da stellte sich manchen die Frage: was soll das, ein Pfarrer, der solche Gedichte macht? Kritische, wenn auch nur mäßig gesellschaftskritische Gedichte, das schickt sich doch nicht! Die Kritik ging bei den ersten Sachen in diese Richtung: Politik hat mit Kirche nichts zu tun.
Hat man den Dichter in Frage gestellt oder das politische Engagement?
Es kam hinzu, dass es formal spielerische Versuche waren. Das hat erst recht befremdet. Ich erinnere mich, als ich hierher kam — man wird ja gewählt von der Gemeinde, und es waren soeben diese »Republikanischen Gedichte« erschienen -, da hieß es: Diese komischen Gedichte, politisch also, dazu die visuellen und verbalen Spiele ... Was soll das? Wenn der auch so predigt, wie er Gedichte macht, ist das unzumutbar für die Gemeinde.
War das formale Argument ein mögliches Deckargument, um nicht das Politische beim Namen zu nennen, oder würden Sie sagen, dass es zwei verschiedene Gründe waren?
Es waren zwei verschiedene Gründe, die sich aber oft gedeckt haben, so dass wirklich das formale Argument das Politische verdeckt hat. Dennoch waren es zwei verschiedene Bedenken, die gekommen sind.
Weil wir gerade bei den »Republikanischen Gedichten« sind: mir scheint, Sie wollen wachrütteln, sind politisch engagiert. Gleichzeitig arbeiten Sie formal äußerst diszipliniert. Ein Entweder-Oder zwischen einer art engage und einer freien Kunst wäre bei Ihnen wohl eine falsche Alternative?
Das würde ich auch sagen. Engagierte Kunst halte ich für einen allzu engen Begriff, auch wenn man das, was Sartre dazu geschrieben hat, mitbedenkt. Kunst ist etwas, das mit Form zu tun hat! Mindestens ist die Form, ist der Zwang oder der Trieb zu bestimmten Formen ein konstitutives Element für Kunst überhaupt, ob engagiert oder nicht engagiert.
Kann man ein Engagement nicht auch anders zum Ausdruck bringen, ohne formale Bindung?
Ich kenne viele Menschen, die ihr Engagement überzeugend zum Ausdruck bringen, durch ihr Leben, durch ihre Aktivitäten, durch ihr Leiden-Können - ganz ohne Kunst! Das ist das Primäre. Kunst kann sich bestenfalls in den Dienst dieser Engagierten zu stellen versuchen. Das mag künstlerisch missglücken, in einer konkreten Situation aber dennoch sinnvoll sein, als Formulierungshilfe für andere zum Beispiel. Glückt der Versuch sogar künstlerisch, so beweist das nur, dass Kunst immer auch außerkünstlerische Wurzeln hat, und sehr oft sind das sogar die nahrhaftesten.
Ich denke jetzt an das Gedicht, das mit der Zeile anfängt: »Das könnte den Herren der Welt so passen«. Wäre dieses Gedicht auch anders sagbar, dass Sie diese Mitteilung, die Sie hier bringen, auch prosaisch ausdrücken könnten? Oder ist dieser Inhalt unmittelbar an diese Form gekoppelt?
Man könnte es anders sagen, aber ich muss das Wort »sagen« jetzt wörtlich nehmen: man kann es mündlich sagen, man kann es konkret sagen in einem bestimmten Fall, und dann in Prosa. So hat es seine Bedeutung für diesen Moment, wo mündlich, spontan, direkt und sozusagen formlos geredet wird. Aber hier, in dieser schriftlichen Form glaube ich schon, dass es so und als Gedicht formuliert sein müsste.
Haben Sie denn auch frei mit der Sprache gearbeitet, oder pflegen Sie so etwas zu tun, ohne dass Sie einen Inhalt mitzuteilen wünschen, in Form eines freien Spiels etwa?
Ja, das kommt bei mir recht häufig vor. Oft geht es bei Gedichten so, dass ich mich mit einem Wort oder einer Wendung beschäftige, dass dieses Wort oder diese Wendung mit mir spielt oder ich mit ihnen, und dass sich daraus die Inhalte erst entwickeln, gruppieren.
Aber irgendein Engagement, oder sagen wir, ein ethischer Zug ist doch in Ihrem Schreiben präsent. Man sollte darüber sprechen, wie eng und wie weit Ethik gefasst ist. Ich würde das sonst nicht sagen, aber Sie fassen ja auch den Begriff der Ethik viel weiter, als das gewöhnlich im kirchlichen Bereich geschieht.
Also gut, wir kommen auf das zurück, was ich vorhin gesagt habe. Engagement ist eine grundsätzliche Einstellung des ganzen Lebens und Verhaltens. Wenn ich nun mit der Sprache spiele, so ist das, was herauskommt, natürlich nicht etwas total anderes als das, was ich insgesamt zu leben versuche. Es ist klar, dass aus diesen Spielen, in denen ja mein Ich spielt, stets wieder das herauskommt, was Sie Ethik nennen, oder Theologie oder Glaube oder was politisch in eine bestimmte Richtung geht. Das Spiel eines jeden ist doch durch das bestimmt, was er insgesamt ist, was er befürchtet und hofft, was er will und glaubt. Ich bin nun einmal Theologe aus Leidenschaft, das schlägt immerzu durch.
Sind Sie bei allem, was Sie schreiben, derselbe? Gibt es nicht einen Gegensatz zwischen einem Schreiben, wo Theologisches thematisiert wird, und einem hiervon abgelösten freieren Schreiben? In Ihrem Roman »Die Riesin« kommen doch keine theologischen Inhalte vor.
Das möchte ich bestreiten.
Mir kam es so vor, als ich das las, dass Sie einen bestimmten Bereich hereinholen, der in Ihrer theologischen und sozial engagierten Arbeit möglicherweise nicht abgedeckt ist. Beispielsweise wird der Bereich des Traumes hereingeholt, außerdem bestimmte Alltagserfahrungen, die sich nicht gleich auf irgendein Ziel hin bestimmen lassen: Wenn Sie den Föhn oder ein großes Essen beschreiben, einfach aus Freude an der Sprache oder den Vorgängen selbst, ohne gleich zu fragen, in welche Richtung das gehen soll. Überhaupt, ich hatte den Eindruck, dass Sie den Roman »Die Riesin« geschrieben haben, um Momente hereinzuholen, die in Ihren Predigten oder politischen Stellungnahmen womöglich nicht zu Wort kommen können.
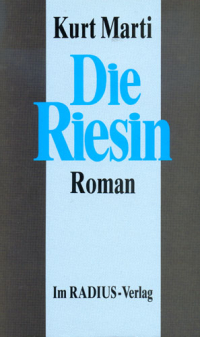 Man kann Theologie nicht einfach als einen abgegrenzten Wissenschaftsbereich nehmen. Theologie sollte auf das Leben eingehen. Wo sonst begegnet man Gott als im Leben? Auf die »Riesin« bezogen: da kommen Traumelemente vor, tatsächlich, das ist so gewollt. Mich interessiert die Frage: Was träumen wir »Berufschristen«, Pfarrer und Theologen, die tagtäglich an Gott denken, von ihm reden, mit ihm argumentieren? Wie spiegelt sich das in unseren Träumen? Das ist ja im Grund die Frage nach der persönlichen Relevanz von Theologie, oder man kann auch sagen: die Frage nach der Ganzheit des Menschen, der eben »Berufschrist« ist. Wenn sich in den Träumen nichts spiegelt von dem, was einer vertritt, öffentlich oder privat, so verrät das eine Art Schizophrenie. Deshalb kommen die Traumsachen vor, die sogleich ein bisschen ins Mythische spielen. Zwischen Traum und Mythos gibt es uralte, elementare Zusammenhänge. Eine nur noch entmythologisierende Theologie droht den Menschen vollends zu funktionalisieren, geht über seine tiefsten Bedürfnisse hinweg. Drum mein Interesse für die Frage: Wie wird Theologie gelebt und rezipiert? Ist das ein Vorgang nur an der Oberfläche, oder wie wirkt sich das aus, bis in die Träume, bis ins Unterbewusstsein, wo sich allerpersönlichste Wünsche und Ängste mit oft uralten und allgemeinen Bildern verbinden?
Man kann Theologie nicht einfach als einen abgegrenzten Wissenschaftsbereich nehmen. Theologie sollte auf das Leben eingehen. Wo sonst begegnet man Gott als im Leben? Auf die »Riesin« bezogen: da kommen Traumelemente vor, tatsächlich, das ist so gewollt. Mich interessiert die Frage: Was träumen wir »Berufschristen«, Pfarrer und Theologen, die tagtäglich an Gott denken, von ihm reden, mit ihm argumentieren? Wie spiegelt sich das in unseren Träumen? Das ist ja im Grund die Frage nach der persönlichen Relevanz von Theologie, oder man kann auch sagen: die Frage nach der Ganzheit des Menschen, der eben »Berufschrist« ist. Wenn sich in den Träumen nichts spiegelt von dem, was einer vertritt, öffentlich oder privat, so verrät das eine Art Schizophrenie. Deshalb kommen die Traumsachen vor, die sogleich ein bisschen ins Mythische spielen. Zwischen Traum und Mythos gibt es uralte, elementare Zusammenhänge. Eine nur noch entmythologisierende Theologie droht den Menschen vollends zu funktionalisieren, geht über seine tiefsten Bedürfnisse hinweg. Drum mein Interesse für die Frage: Wie wird Theologie gelebt und rezipiert? Ist das ein Vorgang nur an der Oberfläche, oder wie wirkt sich das aus, bis in die Träume, bis ins Unterbewusstsein, wo sich allerpersönlichste Wünsche und Ängste mit oft uralten und allgemeinen Bildern verbinden?
Ich verstehe, was Sie meinen. Beim Lesen kam es mir aber anders vor. Ich hätte die »Riesin« nicht als Spiegelung der theologischen Existenz begriffen, sondern sogar umgekehrt, dass das, was in der normalen bürgerlichen Frömmigkeit nicht untergebracht werden kann, was keinen Ort finden kann, das Verdrängte also, dass auch dies einmal zu Wort kommt. Symbol für das Verdrängte, allzeit Bedrohende, wäre dann die Riesin.
Dieser Eindruck ist sicher ebenfalls richtig. Aber, verstehen Sie, Herr Schwebel, ich sehe Theologie nicht beschränkt auf bestimmte Erfahrungsbereiche. Alles, was geschieht, was uns bewegt, ist theologisch relevant. Immer kommt anderes auf uns zu, im eigenen Leben, heute auch aus anderen Religionen, es sind Fragen an die Theologie, die ich als Theologe nicht kurzum beantworten kann, die mich vielleicht als traditionellen Theologen mit einer traditionellen Ausbildung überfordern, aber ich möchte diese Fragen ernst nehmen, sie sind sozusagen provozierende Rätsel, und vielleicht ist die Figur der Riesin eine Art Symbol dafür.
Wie kamen Sie auf die Riesin?
Es wird mit verschiedenen Möglichkeiten gespielt. Ja, da ist die Menschenfresserei unserer Gesellschaft, die Verschlingung, Verwertung, Vergeudung der Menschen. Ob das nun mehr sozialethische Probleme sind, ob es politische oder psychologische Probleme sind, die aber auch theologisch relevant sind, das weiß ich noch nicht. Darum hat das Ganze nicht die Gestalt eines theologischen Traktats, sondern eben eines Romans oder genauer eines Berichts, der Fragen aufwirft, ohne sie gleich lösen zu können. Das Schlimme an der Theologie ist ja oft, dass sie huschhusch mit Antworten kommt und den Mut zur vorerst nicht beantworteten Frage kaum aufbringt. Von vornherein muss alles in das Katechismus-Schema von Frage und Antwort passen, d. h. es wird nur gefragt, worauf man die Antwort bereits zu haben glaubt.
Für mich ist neu, dass Sie auch dieses Buch so stark mit Ihrer theologischen Existenz verknüpfen. Ich hätte vermutet, dass Sie mir jetzt sagen würden: In der »Riesin« bin ich Kurt Marti, der Dichter, ich will das gar nicht so eng mit dem Theologischen in Verbindung bringen. - Denn die »Riesin« hat doch — gemessen an Ihren Tagebüchern, Reden und Gedichten — einen sehr großen Freiraum, überhaupt den größten spielerischen Raum, oder täusche ich mich?
Aber Spiel schließt Theologie oder theologische Existenz doch nicht aus, für mich schließt sie diese ein. Spiel ist etwas sehr Intensives, es engagiert den ganzen Menschen.
Könnte es sein, dass man in der Kirche dem Spiel bisher zu wenig Raum gewährt hat?
Ja, vielleicht. Ich weiß allerdings nicht, was Sie sich vorstellen unter Spiel in der Kirche.
Sie treten für das Spiel dezidiert ein, und zwar aus einer theologischen Notwendigkeit heraus. Es soll also etwas aufgezeigt werden, was in der kirchlichen Praxis in dem Sinne verloren gegangen ist. Oder vielleicht noch gar nicht da war. Ich weiß nicht, wie weit überhaupt spielerische Elemente im Christentum bisher realisiert worden sind.
Ich habe da natürlich auch keine Forschungen getrieben. Jedes Spiel braucht aber bestimmte Regeln. Wenn man heute von Spiel redet, so sieht man darin meist etwas Unverbindliches. Das andere Moment, dass jedes Spiel feste Regeln braucht, wird leicht übersehen. Was uns fehlt, sind einerseits bestimmte - was man mit Regel vergleichen könnte - gemeinsame theologische Überzeugungen in der Kirche. Wenn die gegeben wären, wäre auch mehr Spiel möglich. Da gemeinsame theologische Überzeugungen in der Kirche zur Zeit kaum gegeben sind, gibt es wenig Spiel. Es wimmelt, es brodelt vielleicht, es bewegt sich manches hin und her, aber Spiel ist das nicht, kann es nicht sein. Ich kann das aber nur sagen im Blick auf die Kirche, die ich kenne, die reformierte Kirche in der Schweiz.
Es gibt aber kirchliche Verlautbarungen, die nach außen hin den Eindruck erwecken, als ob es gewisse gemeinsame Überzeugungen gäbe?
 Verlautbarungen? Was wird denn da laut? Doch nur das historische Pathos oder die unverbindliche Leisetreterei einer Hierarchie. Mich bestürzt die enorme Diskrepanz zwischen Kirchenführungen und kirchlicher Basis, aber auch zwischen Theologie und Basis. Im Umgang mit der Basis stoße ich auf eine enorme Konfusion religiöser Bilder und Vorstellungen, ein Chaos im Grunde genommen.
Verlautbarungen? Was wird denn da laut? Doch nur das historische Pathos oder die unverbindliche Leisetreterei einer Hierarchie. Mich bestürzt die enorme Diskrepanz zwischen Kirchenführungen und kirchlicher Basis, aber auch zwischen Theologie und Basis. Im Umgang mit der Basis stoße ich auf eine enorme Konfusion religiöser Bilder und Vorstellungen, ein Chaos im Grunde genommen.
Ist das nicht auch etwas Schönes, ein Stück Pluralismus?
Nichts gegen das Chaos, das schöpferisch sein kann, erst recht nichts gegen Pluralismus. Nur ist in dieser Situation das Moment Spiel fast nicht möglich, weil gemeinsame Grundüberzeugungen fehlen, im Rahmen derer man wirklich frei spielen könnte.
Sie meinen, wenn man Fixpunkte hätte, irgendwelche Spielregeln, dass sich dann leichter spielen ließe?
Das glaube ich schon. Deshalb hat es wahrscheinlich in der mittelalterlichen Kirche mehr Spiel gegeben als bei uns.
Zum andern tadeln wir ja gerade an der katholischen Kirche und an einem ganz bestimmten Bekenntnis-Christentum protestantischer Prägung, dass man dort die Fixpunkte zu eng setzt, so dass das Individuum in seiner Freiheit keinen Platz mehr findet.
Ich möchte gar nicht befürworten, dass man verengen sollte. Aber Theologie hat doch die Aufgabe, ein paar gemeinsame Grundüberzeugungen zu suchen und zu formulieren.
Sie meinen, dass es für die Menschen hilfreich wäre, wenn sie solche Fixpunkte hätten und wüssten: Hier habe ich festen Boden unter den Füßen?
Aus dem Gefühl, dass sie sich an nichts mehr halten können - auch von der Theologie her-, laufen manche Leute davon, zu den Evangelikalen etwa oder zu anderen Gruppen, die trügerische oder verengte Sicherheiten, autoritär dekretierte Fixpunkte anbieten. Aus der Konfusion rettet man sich in die Unterwerfung. Daher die unverminderte Anziehungskraft des rechten, autoritären Flügels sowohl in den protestantischen wie in den katholischen Kirchen. In diese Richtung möchte ich keineswegs denken und gehen!
Ist es denn heutzutage noch möglich, dass Theologie solche Fixpunkte ausformulieren kann? Ich sehe, von meinem Umkreis her, dass man über Auferstehung unterschiedlich denken kann. Es gibt große Unterschiede z. B. zwischen Herbert Braun auf der einen Seite und den Evangelikalen auf der anderen Seite. Wie soll man hier einen Konsens finden? Ich nehme an, dass wir an einen Punkt gekommen sind, mit dem wir leben müssen, dass der feste Halt uns nun mal weggeschubst worden ist und dass die Existenz in einem größeren Freiraum schwebt, notgedrungen freilich, dass wir uns in einer Kierkegaard-ähnlichen Situation befinden, ohne feste Heilsgewissheiten, ohne Dinge, die ein für alle Mal so gegeben sind.
Ja, ich denke, die Kirche muss auch in dieser Beziehung arm werden und arm sein können, arm an Gewissheiten. Es braucht aber ein Existenzminimum, um leben zu können. Auch die christliche Kirche braucht ein Existenzminimum an gemeinsamer Überzeugung. Im Grunde genommen ist es das Geschäft und die Arbeit der Theologie, auf solchen Konsensus, vielleicht nur in einigen wenigen Punkten, hinzuarbeiten. Aber wenn überhaupt über nichts mehr ein Konsensus besteht, so löst sich die Kirche schließlich auf oder wird nur mehr von gesellschaftlichen Traditionen zusammengehalten, was zu einem Übergewicht von Verwaltung und Bürokratie auch in der Kirche führt. Hier in der Stadt Bern haben wir diesen Zustand bereits. Die gemeinsamen Überzeugungen sind kaum noch da, dafür funktioniert der gemeinsame Verwaltungsapparat unerbittlich und lähmt das Leben - und das Spiel! - in den Kirchengemeinden.
Mich wundert es, dass Sie, im Grunde der Vertreter des Spiels und der Spontaneität, der zu kirchlich offiziellen Verlautbarungen eher ein kritisches Verhältnis hat, der immer die zu große Enge getadelt hat, nun zum Vertreter der Regel, des Grundkonsens, des allgemeinen Verbindlichen wird.
 Es kann nicht weit genug sein. Gibt's ein Bild hierfür? Ich sehe die Weite des Meeres besser, wenn ich auf einem Turm stehe und da hinunter blicke, als wenn ich im Meer schwimme, obwohl ich mich dabei ungeheuer bewege. Damit ist nichts gegen das Schwimmen gesagt. Die meiste Zeit schwimmen wir. Aber ich möchte hie und da auf einen Turm steigen können, um auch Ausblick zu haben, um weitere Horizonte zu sehen als dies in der Schwimmperspektive - Augen auf der Höhe des Wasserspiegels - möglich ist.
Es kann nicht weit genug sein. Gibt's ein Bild hierfür? Ich sehe die Weite des Meeres besser, wenn ich auf einem Turm stehe und da hinunter blicke, als wenn ich im Meer schwimme, obwohl ich mich dabei ungeheuer bewege. Damit ist nichts gegen das Schwimmen gesagt. Die meiste Zeit schwimmen wir. Aber ich möchte hie und da auf einen Turm steigen können, um auch Ausblick zu haben, um weitere Horizonte zu sehen als dies in der Schwimmperspektive - Augen auf der Höhe des Wasserspiegels - möglich ist.
Interessant ist, dass Sie den Begriff Spiel niemals mit Chaos in Verbindung bringen, dass Sie Spiel immer mit Ordnung, mit Regeln verbunden wissen wollen.
Das gehört zum Begriff des menschlichen Spieles. Chaos ist vielleicht das Spielfeld Gottes, aber nicht das meine, weil ich seine Dimensionen und Regeln nicht kenne. Darum kann es zum Beispiel keine chaotische Liturgie geben.
Spielt nicht auch die Spontaneität bei Ihnen eine sehr wichtige Rolle? Die Improvisation? Sie haben ja auch über Jazz geschrieben und haben positive Worte dazu gefunden.
Ja, aber die Improvisation geht von einem Thema aus. Etwas muss da sein, über das man improvisieren kann. Sonst wird alles form- und gestaltlos, dadurch nichtssagend, nichts bewegend, irgendwie statisch.
Haben Sie dieses Beharren auf der Regel, auf der Ordnung, haben Sie dies aus dem Theologischen heraus gewonnen oder aus Ihrem Umgang mit Kunst?
Jetzt bin ich überfragt. Ich weiß nicht, woher das kommt. - Wenn Sie sagen »Beharren auf Regel«, dann sind Sie so höflich und fragen mich nicht danach, auf welchen Regeln denn. Die Regel oder der Konsensus ist erst gesucht. Ich habe sie nicht anzubieten. Was ich theologisch oder sonst schreibe, ist erst das Suchen nach möglichen »Regeln«. Insofern gehört natürlich Kritik an dem, was pausbäckig als Gewissheit ausgegeben wird, bei kirchlichen Verlautbarungen etwa, notwendig dazu. Oft sind das doch Scheinübereinstimmungen, die uns ein X für ein U vormachen und die reale Situation verschleiern.
Es gibt auch einen falschen Konsensus.
Ja, und es entspricht ihm keine kirchliche Wirklichkeit. Das meinte ich mit dem Hinweis auf die erschreckende Diskrepanz zwischen Kirchenleitungen und Basis, zwischen Theologie und Basis.
Worin könnte der Konsensus bestehen? Wie ich Sie verstanden habe, treten Sie dafür ein, dass bei allem, was in der Kirche geschieht, der Mensch ins Zentrum treten sollte; der Mensch ist nicht für das Christentum da, sondern das Christentum für den Menschen. Alles dreht sich - oder sollte sich drehen - um den Menschen als Bruder. Ich erinnere mich, dass Sie an einer Stelle von dem Menschen, dem Bruder, als von einer Epiphanie Gottes sprechen.
Sicher.
Wäre das nicht ein Konsensus, auf den man sich einigen könnte, indem man sagt: alles, was im kirchlichen Bereich getan wird, sollte darauf zielen, dass der Bruder oder die Schwester als die Epiphanie Gottes wahrgenommen werden können?
Ja, das wäre ein Ansatz. Er ergibt sich aus der Theologie der Inkarnation: Gott wird Mensch.
Es ist also der Mitmensch, in dem die Inkarnation erkannt wird.
Ja. Und das ist das genaue Gegenteil dessen, was unsere Gesellschaft fordert und schon in den Schulen einüben lässt, nämlich, im anderen Menschen den Konkurrenten zu sehen.
Im Laufe der Geschichte der Kirche gab es unterschiedliche Weisen, die Inkarnation zu verstehen. Man ging sogar so weit, dass man sagte: Gott hat sich in der Kirche inkarniert oder im Predigtamt.
 Nein, nein. Gott hat sich in einem einzelnen Menschen inkarniert, nicht in einem Amt, nicht in einer Institution. Darüber beispielsweise müsste ein Einverständnis erarbeitet werden können, weil es so immerhin im Neuen Testament steht. Die Identifizierung Gottes mit Amt und Institution soll doch nur deren Machtansprüche religiös untermauern. Gott ist jedoch nicht Macht, schon gar nicht Allmacht, er ist »die Liebe«, auch das ist eine zentrale neutestamentliche Aussage, die bezeichnenderweise in keinem Glaubensbekenntnis auftaucht. Gott ist keine andere Macht und hat keine andere Macht als diejenige, die sein Wesen ist und Liebe heißt. Amtliche Liebe? Institutionelle Liebe? Das ist doch Unsinn, ist Un-Gott sozusagen.
Nein, nein. Gott hat sich in einem einzelnen Menschen inkarniert, nicht in einem Amt, nicht in einer Institution. Darüber beispielsweise müsste ein Einverständnis erarbeitet werden können, weil es so immerhin im Neuen Testament steht. Die Identifizierung Gottes mit Amt und Institution soll doch nur deren Machtansprüche religiös untermauern. Gott ist jedoch nicht Macht, schon gar nicht Allmacht, er ist »die Liebe«, auch das ist eine zentrale neutestamentliche Aussage, die bezeichnenderweise in keinem Glaubensbekenntnis auftaucht. Gott ist keine andere Macht und hat keine andere Macht als diejenige, die sein Wesen ist und Liebe heißt. Amtliche Liebe? Institutionelle Liebe? Das ist doch Unsinn, ist Un-Gott sozusagen.
Bedürfte es dann keiner Ämter und keiner Institutionen mehr, wenn wir als Christen in dem Du den Christus erkennen? Ist das nicht die Konsequenz dieses Gedankens?
Es braucht Dienste, die durchaus auch organisiert werden müssen. Aber sie müssen beweglich und veränderbar sein. Sie müssen durch die christliche Basis kontrolliert werden können. Dazu bedarf diese Basis eben der Kriterien, der gemeinsamen Grundüberzeugungen, zum Beispiel die von der Epiphanie Gottes oder Christi im Mitmenschen.
Könnte dieser Mitmensch auch ein Atheist sein?
Ja, selbstverständlich. Er kann auch Buddhist sein oder Marxist.
Ist das der Christus incognito, der im Nächsten wahrgenommen wird, wobei nur der Glaube im Atheisten, Buddhisten oder Marxisten Christus zu erkennen vermag?
Theologie ist eine andere Sicht der Dinge. Das Kreuz, der Gekreuzigte, führt zu einer anderen Sicht der Dinge. Dass ein Gekreuzigter der Sohn Gottes ist, heißt ja, dass unsere geläufige, gewohnte gesellschaftliche Sicht der Dinge nicht diejenige Gottes ist. Wir gehen auf Erfolg, auf Sieg, auf Macht aus. Im Gekreuzigten aber solidarisiert sich Gott mit den Erfolglosen, den Besiegten, den Machtlosen. Das ergibt eine ganz andere Sicht. Aus dieser Sicht kann, soll konkretes Handeln werden. Zunächst muss aber die andere Sicht da sein, bevor gehandelt werden kann. Ich denke mir, dass Theologie diese andere im Sinne des Kreuzes gegenläufige Sicht öffnen müsste.
Obgleich Sie dieses Gegenläufige so stark herausstellen, nehmen Sie doch noch immer eine kulturelle Position wahr. Sie sind kein Bilderstürmer wie Karl Barth, der massiv gegen die Kultur zu Felde zieht, um die andere Sicht der Dinge herauszustellen.
Auch bei Karl Barth hat das nicht zu einem Bruch geführt. Es gab zwar in seinen Anfängen kulturpessimistische Töne. Seine Lebenspraxis war anders, mit Mozartmusik etwa. Er hat aber kein Verhältnis zur modernen Musik und Literatur gefunden, hat das auch gewusst. Im Übrigen partizipiert selbst fundamentale Kulturkritik an der Kultur. Oder man müsste aus der Kultur aussteigen; doch auch das ist Illusion, der Mensch ist nun einmal dazu verdammt oder erwählt, ein Kulturwesen zu sein.
Könnte es denn sein, dass die christliche Umwertung der Werte - dass sich nämlich im Gekreuzigten, Verachteten, Sinn und Wahrheit erschließt -, eine Tendenz zeigt, die auch in der gegenwärtigen Kultur, auch in der modernen Kunst, in der modernen Literatur begegnet? Werden nicht auch hier die Dinge auf den Kopf gestellt? Findet nicht auch hier eine Umwertung der Werte statt, so dass oft das Hässliche, Zerbrochene zum Sinnhaften wird?
Das würde ich für möglich halten. Wie gesagt, Kritik an der Kultur ist kulturimmanent. Man hat keine andere Wahl, als innerhalb einer Kultur zu leben und zu wirken. Gut, man kann in die Wüste gehen und nur noch meditieren, aber selbst das ist noch ein Stück Kultur. Ich verstehe unter Kultur nicht nur gute Kunst, sondern alles, was der Mensch macht, seien es Möbel, Gebrauchsgegenstände, Fabrikate, Sport usw. Aus diesem Gesamtzusammenhang können wir uns gar nicht lösen. Jedes Wort gegen die Kultur bleibt kulturimmanent. Der immanente Widerspruch gegen jetzige Kulturformen äußert sich unter anderem darin, dass auch in den Künsten immer wieder die Dinge auf den Kopf gestellt werden, dass gleichsam tabula rasa gemacht wird, dass ein neuer Ansatz gesucht wird.
Bleiben wir noch einen Augenblick bei der Kultur, an der Sie ja schriftstellerisch partizipieren. Wie hat man denn in literarischen Kreisen reagiert oder wie reagiert man, dass derjenige, der Gedichte, Romane und andere Dinge schreibt, gleichzeitig noch Pfarrer ist? Ist das nicht etwas Ärgerliches?
Doch ja, schon ein bisschen, befremdlich auf alle Fälle. Man merkt bei anderen Schriftstellern, bei Kritikern und Redakteuren eine Art Befremden, ein freundliches Befremden. Es kann auch mal ein unfreundliches Befremden sein, das Misstrauen: Was will der hier in unserem Gebiet, im Feld der Kunst, der Literatur? Ist er ein verkappter Missionar? Will er uns bekehren? Missbraucht er etwa die Literatur, um Inhalte seiner Kirche zu vermitteln? Insgeheim zweifelt er vielleicht am Predigen, weil angeblich niemand mehr in die Kirche kommt. . .
Nehmen wir die Frage einer solchen Kritik einmal ernst: Missbrauchen Sie das Material Sprache dazu, um Proselyten zu machen?
Nein. Aus einem ganz einfachen, sehr persönlichen Grunde kann das nicht der Fall sein. Sprache ist nämlich kein Gebrauchsgegenstand für mich, kein Material, ich kann sie nicht beliebig einsetzen für dies und jenes. Ich schreibe aus einer Art Schreibtrieb heraus. Man wird oft gefragt, warum schreiben Sie überhaupt? Bei mir ist es ein Schreibtrieb, ein Formulierungstrieb, den ich nur dadurch abreagieren kann, dass ich schreibe, für mich allein zunächst, wobei es nicht darauf ankommt - wie in der Predigt -, sofort, von gerade anwesenden Leuten verstanden zu werden. Sofern ich formuliere, schreibe ich zunächst für mich und brauche mich nicht darum zu kümmern, ob das jemand sogleich versteht. Beim Predigen hingegen bin ich immer in Gefahr, mehr zu sagen, als ich verantworten kann. Oder plötzlich sage ich etwas ein wenig anders, als ich eigentlich möchte. Aber das ist im alltäglichen Reden, in Gesprächen, nicht anders. Um der raschen Verständlichkeit willen muss man sich auf Sprachkonventionen, sogar Sprachclichés einlassen, sie gebrauchen. Aber auch diese konventionellen und clichierten Redeformen sind nicht nur Material, transportieren immer schon Inhalt und entwickeln Eigengesetzlichkeiten. Ich möchte sie gebrauchen, aber plötzlich sind sie es, die mich gebrauchen.
Gibt es nicht einen Widerspruch zwischen einem publice docere - um dieses reformatorische Wort aufzugreifen - auf eine Gemeinde hin und dem Schreiben gemäß dem Schreibtrieb? Ist derjenige, der öffentlich vor einer Gemeinde steht und ihr das Wort auslegt, möglicherweise ein anderer als derjenige, der vor dem Schreibtisch sitzt, über Träume nachdenkt oder eine Szene formuliert?
Das weiß ich nicht. Es sind zwei verschiedene Situationen und zwei verschiedene Sprechweisen. Die eine ist mündlich direkt, muss im Moment verstanden werden. Die andere ist mehr privat, ich folge meinem Schreibtrieb. Ich formuliere, und später kann es jemand lesen. Er muss es nicht hören, er kann's lesen, wenn's publiziert ist, und kann sich seine Gedanken dazu machen. Es sind zwei verschiedene Verfahren. Ob dabei zwei ganz verschiedene Menschen herauskommen, bleibt eine Frage. Ich hoffe nicht, glaube es auch nicht. Dass mir die Gefahren des öffentlichen Redens bewusst sind, habe ich soeben anzudeuten versucht. Mein Schreiben ist da vielleicht eine Gegentherapie, ein Versuch zur Selbstfindung in der Sprache und insofern ein immerwährendes Korrektiv, ein kritisches und hilfreiches Korrektiv, das mein öffentliches Reden immer verändert.
Wenn Sie schreiben, haben Sie erst einmal kein Gegenüber außer sich selbst. Wenn Sie predigen, haben Sie die Gemeinde gegenüber, und auf die müssen Sie sich einstellen ...
Ich bereite mich für einen Adressaten vor; wenn ich schreibe, nicht.
Und wenn jetzt ein böser, Ihnen übelwollender Demiurg käme und nähme Ihnen das Schreiben weg, so dass Sie das auf einmal nicht mehr tun könnten - was würde dann passieren? Was würde Ihrem Leben und auch Ihrer Theologie verloren gehen, wenn Ihnen das auf einmal weggenommen würde, auf eine radikale Weise?
Eine hypothetische Frage. Ich weiß keine Antwort. Gut, ich habe ja lange nicht geschrieben, ungefähr bis 35 nicht. Wenn das aufhören musste? Ich kann's nicht sagen. Da bin ich überfragt.
Haben Sie Ihr Schreiben nötig? Brauchen Sie das Schreiben für sich selber, um Pfarrer sein zu können?
Ich bin Pfarrer geworden, habe als Pfarrer gearbeitet, ohne geschrieben zu haben. Das Schreiben ist erst nachträglich hinzugekommen. Mein Schreibtrieb hat sich als Spättrieb geregt, dann aber gebieterisch und ausgelöst vielleicht durch das Gefühl, durch das ständige öffentliche Reden mir selber entfremdet zu werden, langsam mein Ich, meine Identität zu verlieren, etwas allzu dramatisch gesagt.
Es ist natürlich schwer, zu fragen, was wäre, wenn. Aber sicher würde Ihnen, wenn Sie nicht mehr schreiben würden, doch etwas fehlen. Da würde doch irgendein Mangel auftreten.
Wahrscheinlich würde ich das als Mangel empfinden. Aber wie ich mit dem Mangel fertig werden könnte und ob er durch etwas anderes kompensiert werden würde - keine Ahnung.
Wäre das nur ein Mangel, der Sie als Person betreffen würde, oder wäre auch Ihre Theologie davon betroffen? Ist das für Ihr theologisches Denken relevant, ob Sie schreiben, oder tun Sie das nur als Privatperson?
 Ich kann die Theologie von meiner Person, mein theologisches Denken von meiner Person, von meinen persönlichen Erfahrungen, Erlebnissen, nicht trennen. Auch nicht jetzt, im jetzigen Moment. Deshalb ist meine Theologie ganz bestimmt beeinflusst von dem, was ich schreibe. Und das, was ich schreibe, ist ganz bestimmt beeinflusst von meinem theologischen Denken, das geht ineinander über. Was wäre, wenn das Schreiben wegfiele? Das weiß ich nicht. Jetzt ist es einfach so. Ich sehe keine Möglichkeit, das irgendwie auseinanderzunehmen, noch nicht einmal theoretisch. Ich weiß nur, dass ich, wenn ich schreibe, immer aufgrund von ganz persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen schreibe. Diese Erfahrungen und Erlebnisse, mit denen ich mich schreibend beschäftige, zwingen mich andauernd, meine Theologie zu überprüfen, zu revidieren, zu befragen.
Ich kann die Theologie von meiner Person, mein theologisches Denken von meiner Person, von meinen persönlichen Erfahrungen, Erlebnissen, nicht trennen. Auch nicht jetzt, im jetzigen Moment. Deshalb ist meine Theologie ganz bestimmt beeinflusst von dem, was ich schreibe. Und das, was ich schreibe, ist ganz bestimmt beeinflusst von meinem theologischen Denken, das geht ineinander über. Was wäre, wenn das Schreiben wegfiele? Das weiß ich nicht. Jetzt ist es einfach so. Ich sehe keine Möglichkeit, das irgendwie auseinanderzunehmen, noch nicht einmal theoretisch. Ich weiß nur, dass ich, wenn ich schreibe, immer aufgrund von ganz persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen schreibe. Diese Erfahrungen und Erlebnisse, mit denen ich mich schreibend beschäftige, zwingen mich andauernd, meine Theologie zu überprüfen, zu revidieren, zu befragen.
Wird denn auch Ihre Literatur durch die Theologie befruchtet? Vermag Theologie heutzutage noch der Literatur etwas zu geben, sie anzuregen, zu inspirieren, was in früheren Jahrhunderten öfter der Fall war?
In meinem persönlichen Falle schon. Ich bin ja Pfarrer, bin dadurch dauernd mit Menschen konfrontiert, deren Probleme mich belasten, die mir Fragen stellen, mich in theologische Gespräche verwickeln, mich auch herausfordern, attackieren. Ich mag schreiben, was ich will, irgendwie animiert, inspiriert mich die Theologie immer wieder zu literarischen Äußerungen, Formulierungen, Gestaltungen. Mich würde eher wundern, was passieren würde, wenn mir plötzlich die Theologie verboten würde. Da würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr schreiben. Oder mein Schreiben würde vielleicht vertrocknen oder einfach aufhören, weil mir der bisherige Erfahrungsbereich und seine spezifischen Denkherausforderungen entzogen wären.
Für Sie selbst ist eine Trennung - hier Schriftsteller, dort Theologe — unvorstellbar?
Eine isolierte Theologie und eine isolierte Kunst erzeugen dieselben Gefahren, nämlich dass die Entfremdung nicht überwunden, sondern verstärkt wird, um ein gängiges Stichwort zu gebrauchen. Das ist bei der Kunst, bei der Theologie, ist bei allem so, was als isolierte Beschäftigung betrieben wird.
Den Begriff »reine Kunst« würden Sie ablehnen?
Reine Kunst? Ich weiß nicht, was man darunter eigentlich versteht. Wenn Sie mich fragen würden, was haben Sie für literarische Vorbilder, so würde sich wahrscheinlich zeigen, dass es Autoren sind, die als »reine Dichter« gelten . . .
Wer wäre das denn?
Hölderlin oder Rene Char oder auch Celan beispielsweise, um mal von der Lyrik auszugehen. Das sind keine sogenannt engagierten Dichter. Man wird sagen, es sind »reine Dichter«. Ich setze aber ein Fragezeichen hinter diesen Ausdruck. Das angeblich reine Dichten kommt ja aus einem so engagierten Leben und Leiden, dass diese Autoren sonst für nichts mehr Kraft haben. Leben und Schreiben - das zehrt ihre ganze Substanz auf! Gab es engagiertere Dichter als Hölderlin, Trakl, Celan? In ihrem totalen Engagement war das politische mit eingeschlossen, was man erst heute zu entdecken beginnt.
Ich möchte auf folgende Sache hinaus, die Sie in Ihrem Aufsatzband »Grenzverkehr« genannt haben, dass Kunst, ein Ausdrucksbereich unserer Gesellschaft, etwas aufbewahrt hat, was andernorts - etwa in der entfremdeten Arbeit am Fließband - verlorengegangen ist. Es geht nun nicht darum, an diesem Punkt stehen zu bleiben, bei Kunst als Teilbereich des gesellschaftlichen Lebens, sondern darum, dass von der Kunst eine Art Erneuerung ausgehen könnte.
Kunst kann die Entfremdung nicht überwinden oder gar aufheben. Sie kann sie aber auf ihre konkrete Weise artikulieren, bezeugen. Um die Finsternis überhaupt darstellen zu können, braucht man jedoch Licht, wenn auch nur ein wenig. Erst ein Ausblick auf mögliche Nicht-Entfremdung - auf Welt als Heimat, um mit Ernst Bloch zu reden - macht die Entfremdung artikulierbar, bezeugbar. Ein Hölderlin-Gedicht, ein Text von Rene Char, das sind Ausblicke in diese Richtung. Insofern ist das nicht Poesie im Elfenbeinturm, sondern vehement engagierte Dichtung.
Aber tendiert Kunst, wenn sie auf die Aufhebung von Entfremdung aus ist, dann nicht auch auf die Aufhebung ihrer selbst hin, wenn der utopische, der heimatliche Zustand verwirklicht wäre?
Man könnte theologisch sagen: Im Reich Gottes gibt es keine Kunst mehr. Oder ist dann alles Kunst? Das Reich Gottes, so stelle ich mir vor, ist das Ende der arbeitsteiligen Welt, also das Ende auch der Arbeitsteilung zwischen Kunst und Nicht-Kunst, vielleicht sogar das Ende der Arbeitsteilung zwischen Gott und Mensch, weil Gott »alles in allem« sein wird (Paulus). Das tönt ja nun sehr schwärmerisch und verrückt, ich weiß, gehört für mich aber zum Ausblick, in dessen Licht ich die jetzige Entfremdung schärfer, genauer wahrnehmen kann, wahrnehmen muss. Ist die Möglichkeit einer anderen Weltzukunft nicht schon immer so etwas wie die imaginative Potenz des christlichen Glaubens gewesen?
Das wäre also das Eschaton.
Ja, gut, nennen wir es so.
Dann wäre auch die Theologie überflüssig.
Ja, selbstverständlich. Das ist sogar gut biblisch. Es gibt im himmlischen Jerusalem keine Priester und keine Tempel, keine Theologie und keine Kirche mehr.
Ergänzt Ihrer Meinung nach für Sie persönlich die Sichtweise der Literatur oder der Kunst die Sichtweise der Theologie?
Schwierig, so generell zu sprechen. Für mich persönlich gibt es eine Art von Komplementarität. Für andere existiert sie nicht. Nur, was heißt denn eigentlich Theologie? Es gibt auch säkularisierte Theologie. Es gibt sogar sehr viel davon, z. B. im Marxismus. Lebt nicht in jeder Hoffnung ein theologisches Element, der Glaube an noch andere Möglichkeiten? Der Spannungsbogen zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit findet sich sowohl in der Kunst wie in der Theologie.
Dann geht es auch um etwas Sakramentales, wenn in einem Diesseits, etwa im Bereich der Alltäglichkeit, dieser Bogen aufgezeigt werden kann.
Ja, vielleicht. Sakramental wäre dann eine punktuelle Epiphanie und Vorwegnahme, ein Aufleuchten des Eschatons im alltäglichen Hier und Jetzt, in oder außerhalb von Liturgien, in oder außerhalb der Kunst. In der Freundschaft, in der Liebe, im gemeinsamen Kampf oder Leiden können sich Augenblicke, Handlungen, Gebärden ereignen, die sakramentalen Charakter haben, in denen die Heiligkeit des Banalen und Materiellen, die Göttlichkeit des Selbstverständlichen und Geringen erlebt wird. Ich könnte mir denken, dass das mit Kunst etwas zu tun hat, mit ihrer sinnlichen Empfindlichkeit und Genauigkeit, mit ihrer besessenen Aufmerksamkeit für Details, Nuancen gerade des sogenannten Banalen. Für mich jedenfalls hat das etwas zu tun mit inkarnativer Weltleidenschaft und eschatologischer Perspektive.
Dann müsste Kunst aber ihr elitäres Gepräge aufgeben und Gemeinbesitz werden. Aus dem Genießen und Konsumieren müsste es zu einem Mitmachen und Mitspielen kommen.
Ja genau, deshalb ist ja Kunst, wenn sie wirklich Kunst ist, nicht einfach Konsumartikel. Sie stellt Anforderungen, die zum Mitmachen, Mitdenken herausfordern. Ein Hölderlin- oder ein Celan-Gedicht kann nicht einfach konsumiert werden, es nimmt uns in Anspruch, es fordert heraus zum Mitmachen. Und dieses Mitmachen bedeutet: Man macht sich auf in Richtung Eschaton. Andererseits ist auch zu betonen: Es gibt diesen Gegensatz zwischen Eschaton und Alltag eher begrifflich, eher in der Theologie. In der Kunst dominiert das sehr Alltägliche, das sehr Nahe und Nächste. Kunst nimmt die Herausforderung der Materie und der materiellen Existenz auf, sie kann sich ihr nicht entziehen, wie es die Theologie oft tat und tut. Kunst arbeitet mit Stoffen und Materialien, formal und inhaltlich. Braucht es dazu nicht so etwas wie Hoffnung auf Veränderungen, Verwandlungen der Materie? Ist das gelungene Kunstwerk nicht eine Art materieller Epiphanie des Eschatons, ein punktuelles Aufleuchten messianischen Friedens sozusagen?
Braucht man dann noch die Religion und den Glauben? Wenn es die Kunst vermag, das Eschaton sichtbar zu machen, den Verheißungscharakter zu wahren, das Versprechen etwa im Bloch'schen Sinn wachzuhalten . . . Und wenn es sogar gelingt, dieses Versprechen mit der Alltäglichkeit, mit der Banalität, mit der Nähe in Verbindung zu bringen, brauchen wir dann noch die Religion? Leistet jetzt nicht die Kunst das, was im klassischen Sinne der Religion zugeschrieben wird?
Nein. Ich glaube nicht, dass Religion so bald überflüssig wird. Kunst braucht die Religion. Auch Bloch brauchte sie, sein »Prinzip Hoffnung« lebt von religiösen Denktraditionen. Ich meine, die Kunst wird immer inspiriert bleiben von Religion, von religiösen Impulsen.
Also, die Kunst braucht die Religion, damit sie diesen Spannungsbogen. . .
Es ist eine Spannungseinheit. Wenn die Religion entfällt, dann wird auch die Kunst nach und nach verschwinden, wird zur bloßen Illustration oder zur Werbung verkommen.
Es gibt aber bildende Künstler und Schriftsteller, bei denen Religion keine große Rolle spielt. Würden Sie meinen, dass sie dafür eine Krypto-Religion haben?
Das würde ich fast annehmen.
Günter Grass etwa, der ist doch nicht ein religiöser Schriftsteller, aber er ist ein Schriftsteller, ein sehr kraftvoller Schriftsteller sogar.
Mir scheint, er schreibt durchaus im Gegenüber, in der Spannung zur Religion, zu vielem, was von dieser Seite herkommt. Das ist doch in seinen Büchern drin. Ich habe sie allerdings nicht alle gelesen. Auch fällt es mir schwer, jetzt im Blick auf einzelne Autoren zu argumentieren, das stinkt gleich penetrant nach Annektion und Vergewaltigung.
Es geht mir auch nicht um einzelne Personen, sondern darum, ob Kunst die Religion generell nötig hat. Im Präteritum ist das sicher richtig. Aber trifft das auch heutzutage noch zu?
Aber es gibt bis jetzt faktisch keine Kunst völlig ohne Gegenüber zu irgendeiner Religion oder zu einer religiösen Tradition. Das gibt es empirisch nicht.
Es gibt natürlich Kunst, die erklärt atheistisch ist. Sartre betont seinen Atheismus, Camus betont seinen Atheismus.
Aber Camus war ja ständig im Gespräch mit dem Christentum; auch Sartre. Sie kommen schon historisch nicht darum herum. Wenn dieser Gesprächspartner, dieser Spannungspol, wegfallen würde, so würde der Kunst wahrscheinlich etwas Entscheidendes fehlen. Davon bin ich überzeugt. Sie würde auch utopiemüde, würde eben verkommen zu Illustration und Werbung, wenn Religion nicht immer den eschatologischen Horizont wachhielte. Bis jetzt ist auch der Atheismus immer noch auf das bezogen geblieben, was er bestreitet, in irgendeiner Form. Ein wirklich emanzipierter Atheismus dürfte gar nicht mehr Atheismus heißen.
Durch Ihren Umgang mit Literatur und der bildenden Kunst sind Sie mit Erfahrungen konfrontiert worden, mit denen sonst kaum ein Pfarrer konfrontiert wird. Was sind das für Erfahrungen, die Sie dabei gemacht haben?
 Ich selber lernte von daher, was man sagen kann und was nicht. Oder wie man etwas sagen kann und wie man es nicht sagen kann. Ich habe einen enormen, fast zärtlichen Respekt vor jedem Menschen bekommen. Ist nicht jeder ein Roman aus Fleisch und Blut? Oder ein Drama? Oder ein Gedicht? Wie blass, wie flach wird in der Kirche oft von den Menschen geredet. Wie wenig dürfen sie sich ausdrücken, darstellen in der Kirche. Darum hätte ich gern mehr Spontaneität, mehr Diskussion, mehr Bürgerinitiativen in der Kirche, im Gottesdienst sogar. Wir haben bescheidene Versuche in dieser Richtung zu machen versucht. Aber man soll das nicht wieder von oben herab organisieren. Es muss spontan von der Basis her kommen, nicht von mir, dem Pfarrer aus. Ich kann die Leute aber ermutigen, anregen, solidarisch sein mit ihnen.
Ich selber lernte von daher, was man sagen kann und was nicht. Oder wie man etwas sagen kann und wie man es nicht sagen kann. Ich habe einen enormen, fast zärtlichen Respekt vor jedem Menschen bekommen. Ist nicht jeder ein Roman aus Fleisch und Blut? Oder ein Drama? Oder ein Gedicht? Wie blass, wie flach wird in der Kirche oft von den Menschen geredet. Wie wenig dürfen sie sich ausdrücken, darstellen in der Kirche. Darum hätte ich gern mehr Spontaneität, mehr Diskussion, mehr Bürgerinitiativen in der Kirche, im Gottesdienst sogar. Wir haben bescheidene Versuche in dieser Richtung zu machen versucht. Aber man soll das nicht wieder von oben herab organisieren. Es muss spontan von der Basis her kommen, nicht von mir, dem Pfarrer aus. Ich kann die Leute aber ermutigen, anregen, solidarisch sein mit ihnen.
Gibt es nicht eine Korrelation zwischen dem Menschenbild der Gegenwartskunst und dem, was theologisch über den Menschen zu sagen ist?
Ich weiß nicht, was das Menschenbild der Gegenwartskunst ist. Ich glaube, es ist keines.
Der Mensch wird ja in der gegenwärtigen Kunst nicht idealisiert. Die hässlichen Seiten, auch die schwachen, die zerstörerischen, die abgründigen Seiten des Menschen werden ins Zentrum gerückt.
Sicher. Das ist aber nicht neu. Das war schon immer so und ist nicht ein Vorrecht der neueren Kunst. Vielleicht ist das Menschenbild unserer Zeit insofern positiv zu werten, als es eben kein eindeutig festgelegtes Bild ist. Auch die Bibel liefert kein eindeutig festgelegtes Menschenbild. Es gibt die konkreten Menschen mit ihren Erfahrungen und Nöten. Sie alle auf den Generalnenner Mensch zu bringen, ist bereits ein totalitärer Akt, eine Vergewaltigung. Die konkreten Menschen, einmal ernst genommen in ihrer Einzigartigkeit und Vielfalt, spiegeln sich im fehlenden einheitlichen Menschenbild der gegenwärtigen Kunst. Das sehe ich als positiv an.
Werden die konkreten Menschen nicht von fremden Mächten ferngeleitet, etwa von der Werbung, von Machtgruppen, die ihre Ware an den Mann oder an die Frau bringen wollen?
Die Verkündigung muss solche Stereotypen immer wieder zerschlagen, wie es die Kunst ebenfalls und auf ihre Weise tut. Es ist nur eine andere Methode der Zerstörung.
Es versuchen also beide, die Theologie wie die Gegenwartskunst, gegen die Manipulation, den Menschen so oder so fassen zu wollen, anzugehen.
Sie wehren sich gegen diese Manipulation zugunsten des einzelnen Menschen, der überfahren, überrollt und eingezwängt wird. Es sind Manipulationen, hinter denen bestimmte Interessen stehen, welche die einen Menschen den anderen dienstbar machen oder die einen Menschen gegen die andern ausspielen wollen. Hinter solchen Interessen und Manipulationen steht ein ökonomischer und sozialer Herrschaftswille, ein Herrschaftsanspruch. Die Manipulation zielt ja immer wieder, ob im Westen oder im Osten, auf Erhaltung oder Errichtung einer privilegierten Klassenherrschaft. Das aber ist das genaue Gegenteil dessen, was christlicher Glaube meint und will. Ich komme da wieder auf die Inkarnation zurück. Gott wird Mensch - er wird nicht Volk, nicht Klasse, nicht Institution oder Ideologie. Er wird ein einzelner, konkreter Mensch, der nicht zufällig vom Volk, von der herrschenden Klasse, von der Institution und Ideologie gekreuzigt wird. Das ist unsere Realität, gegen die Gott sich auflehnt, gegen die er das andere, das Eschaton setzt, die Menschwerdung des Menschen, die das Ziel der Menschwerdung Gottes ist, wie ich glaube.
Bei aller Unterschiedenheit und Autonomie von Theologie und Kunst denke ich, dass beide auf ihre Weise Anwälte, Fürsprecher des einzelnen Menschen, seiner Bedürfnisse und Rechte, seiner Hoffnungen und Wünsche sind oder jedenfalls sein sollten, sein könnten.