
Wiedergänger |
„Du kannst nicht allezeit, wie du willst.“Zur Gottesfrage in Theodor Storms SchimmelreiterHans Jürgen Benedict
Wir meinen, wir seien als aufgeklärte Menschen des 21. Jahrhunderts über religiöse Deutungen von Katastrophen hinaus. Und doch titelte die BILD-Zeitung im September 2001: „Großer Gott, steh uns bei.“ Und nach dem Tsunami vom Dezember 2004 in der ihr eigenen Manier einer populären Theodizeefrage: „Wo warst du, lieber Gott?“ Das erinnert an die theologischen Deutungsversuche der großen Sturmflut aus dem Jahr 1756, wie sie in Theodor Storms Novelle Der Schimmelreiter eine großartige literarische Gestaltung gefunden hat. Als der Deich bricht, springt der Schimmelreiter in die Lücke mit dem Satz: „Nimm mich, Herr, Herr, verschon die anderen!“ Gilt also im Jahr 2016 wie im Jahr 1756, dass angesichts von Naturkatastrophen im Grunde der Rückbezug auf das Religiöse ein wichtiges Mittel bleibt, der inneren Unruhe einen Sinn zu geben und die Angst zu beschwichtigen, auch wenn es keine zufriedenstellende Antwort ist? Zu diesem Zweck soll im Folgenden die Gottesfrage in Storms Novelle genauer beleuchtet werden. Der Held der Schimmelreiter-Novelle, Hauke Haien, ist ein umgetriebener Aufsteiger und Tatmensch, einer, der im rückständigen Marsch-Dorf den Fortschritt will und dabei mit den Vorurteilen seiner Bewohner ringt. Der Sohn eines Kleinbauern will nach oben, Deichgraf werden. Denn er will er mit den Sturmfluten als Schickungen Gottes auf neue wissenschaftliche Weise fertig werden, Deiche so bauen, dass sie die Katastrophe soweit wie möglich abwehren. Das Wasser muss in einer sanft ansteigenden Linie auf den Deich auflaufen und so seine zerstörerische Kraft verlieren. Er liest schon als Junge den Euklid, um die Bewegungen des Wassers zu verstehen. Er will Land gewinnen durch Eindeichung des Vorlands, wie Faust „mit freiem Volk auf freiem Grunde stehen“(Faust II), Neuschöpfer sein, der es wagt, einen Pril umzulenken. Landgewinn verheißt mehr Sicherheit und auch mehr Besitz. Bei diesem menschlichen Schöpfungswerk ist Gott vor allem eine Art Rückversicherung So ist in Storms Novelle häufig von Gott die Rede, dem die Menschen letztlich den Schutz vor der Naturgewalt verdanken, auch wenn sie sich durch Deichbau vor ihr schützen. Gott ist sozusagen der Garant des Restrisikos. Es ist die traditionelle Gottesanrufung einer agrarischen Gesellschaft am Meer, die tut und arbeitet, was sie kann, um das Leben zu sichern, die aber doch weiß, dass sie nicht alles in der Hand hat. Das erklärt den wiederholten Gottesbezug in der Novelle, die Mitte des 18. Jahrhunderts spielt, in der Zeit der Frühaufklärung, die Gott nicht abschafft, aber ihn deistisch auf die Funktion der prima causa reduziert. Hauke Haien bringt es einmal auf die paradoxe Formel, es sei seine Aufgabe, „ein verantwortlich Amt“ heißt es gut lutherisch, „die Gemeinde vor unseres Herrgotts Meer zu schützen.“(84) Der alte weißhaarige Pate Jewe Manners spricht bei der Versammlung der Deichbevollmächtigten, als es um den neuen Deich mit dem neuen Profil geht, zu Hauke Haiens Gunsten. „Wir haben Gott zu danken, daß er uns trotz unserer Trägheit das kostbare Stück Vorland gegen Sturm und Wasserdrang erhalten hat, jetzt ist aber die elfte Stunde, in der wir selbst Hand anlegen müssen (…) und auf Gottes Langmut nicht weiter trotzen.“ (58f) Und kurz darauf heißt es: „Der Herrgott schien seine Gunst dem neuen Werke zuzuwenden“, als der Bau des neuen Deichs im Sommer große Fortschritte macht. Auch Hauke Haien teilt diese Gottesauffassung, die Gott als letzten Garanten irdischen Heils und Wohlfahrt im Amte lässt, sonst aber energisch an die Weltgestaltung geht Gleichzeitig mit dieser jüdisch-christlichen Gottesrückversicherung eines Gott verantwortlichen Gemeinwesens gibt es Reste magischen Aberglauben. Hauke Haien setzt den neuen Deich durch und muss dabei zugleich die Lethargie und den Aberglauben der Dorfbewohner bekämpfen. Sie können mit dem ungeheuren Schrecken der von Gott geschickten Naturgewalten nicht anders umgehen als ihre steinzeitlichen Vorfahren – durch ein archaisches Opfer. Als das letzte Stück des neuen Deichs geschlossen werden soll, sieht er, wie ein Dorfbewohner einen Hund zum Deich trägt und ihn hineinwirft. Was das soll, herrscht er ihn an. „Es muss was Lebiges in den Deich“. Was Lebiges, aus welchem Katechismus hast du das gelernt? Aus keinem, aber das haben unsere Großväter schon gewußt, die sich mit euch im Christentum wohl messen durften. Ein Kind ist besser noch, wenn das nicht da ist, tut‘s wohl auch ein Hund. Schweig du mit deinen Heidenlehren, es stopfte besser, man würfe dich hinein.“ (70) Das Tieropfer hat das Menschenopfer abgelöst wie in der Geschichte von Isaaks Opferung. Doch der Deichgraf will das nicht gelten lassen. Er rettet den Hund. Er sieht nicht die abgründige Wahrheit, dass der hilflos den Naturschrecken ausgesetzte Mensch sich nicht anders zu helfen weiß als durch die Opferung des Liebsten.
Er muss sich mit den Vorurteilen der Dorfbewohner auseinandersetzen, sie zu dem Modernisierungsvorhaben zwingen. Und macht doch einen Kompromiss, als sich eine schadhafte Stelle an dem alten Deich zeigt, die er nur notdürftig reparieren lässt. Als die Sturmflut den alten Deich durchbricht, sagen die Bauern: „Eure Schuld, Herr Deichgraf, nehmt‘s mit vor Gottes Thron“. Hauke Haien erforscht sich: „Herr Gott, ja ich bekenn es“, rief er laut in den Sturm heraus, „ich habe meines Amte schlecht gewaltet.“ Und weiter: „Nur Herr mein Gott, sei gnädig mit uns Menschen (…) Aber Sturm und Meer waren nicht barmherzig, ihr Toben zerwehte seine Worte.“ (91f) Er sieht, wie Frau und Kind in den Fluten verschwinden. Letztlich weiß er keinen Ausweg als sich selbst zu opfern, indem er mit dem Schimmel in die Bruchstelle des Deiches springt: „Herr Gott, nimm mich, verschon die anderen.“(93) So vollzieht er, was er als Aberglauben verdammt hat: „es muß was Lebiges in den Deich.“ Es ist der Gedanke der Sühne für eine übermächtige Gewalt und Schuld im Natur- und Menschenschrecken. Ein Gedanke, der aber letztlich auch dem Opfer Christi zugrunde liegt; Hauke Haien wird dadurch zu einem leidenden Messias des Fortschritts, der in den Wassern der Sturmflut untergeht. Die großartige Sprache Storms, die den Naturschrecken in ihm standhaltende Worte fasst, kommt hier zu einem Höhepunkt. Schließlich gibt es im Schimmelreiter eine modern-skeptische Weise des Gottesglaubens. „Er hatte sich sein eigen Christentum zurechtgerechnet“, heißt es, „aber es war etwas, das sein Gebet zurückhielt.“ (64) Hauke Haien ringt mit Gott, klagt ihn an, stellt ihn in Frage, als seine Frau bei der Geburt ihres Kindes zu sterben droht. Ungeheuerliche Sätze fallen. „Herr, mein Gott, nimm sie mir nicht.“ Doch leiser setzte er hinzu: „Ich weiß ja wohl, du kannst nicht allezeit, wie du willst, auch du nicht.“ (64) Es ist ein Gebet, dessen angeblich gotteslästerlichen Inhalt das zuhörende fromme Dienstmädchen im Dorf verbreitet. „Er hatte Gottes Allmacht bestritten; was war ein Gott denn ohne Allmacht? Er war ein Gottesleugner.“ (65) Besonders die Mitglieder eines frommen Konventikels im Dorf, geleitet von einem holländischen Schneider, die von sich sagen, sie hätten den „lebendigen Glauben“, machen Stimmung gegen den Deichgraf. „ Wer aber Gottes Allmacht widerstreitet, wer da sagt, ich weiß, du kannst nicht ,was du willst, der ist von Gott gefallen und suchet den Feind Gottes, den Freund der Sünde zu seinem Tröster (…) ihr aber hütet euch vor dem, der also betet, sein Gebet ist Fluch!“ (66) Es stellt sich heraus, das Kind, ein Mädchen, Wienke genannt, ist geistig behindert, „schwachsinnig“ in der damaligen Sprache. Hauke Haien liebt sie über alles, aber die Mutter fragt sich: „aber warum, was habe ich arme Mutter denn verschuldet?“ Er antwortet: „Ja, Elke, das habe ich freilich auch gefragt, den, der allein es wissen kann; aber du weißt ja auch, der Allmächtige gibt den Menschen keine Antwort.“(77) Das sind Sätze, die sehr treffend das Problem des Gebets auf den Begriff bringen, Sätze, die noch in Thomas Mann Joseph und seine Brüder einen Widerhall finden - in der Szene, als Rahel stirbt und Jakob fragt: „Warum, Herr? In solchen Fällen erfolgt keine Antwort.“ Wichtig ist der Schrei, die Klage, auch wenn es keine Antwort gibt. Oder mit Rumi, dem islamischen Mystiker des 14.Jahrhunderts gesprochen: „Die Antwort liegt im Schrei.“ Storm zeichnet Hauke Haien als einen einsamen Menschen, in seinem Herzen nistet sich ein Trotz und abgeschlossenes Wesen gegen andere Menschen ein. Lebendige Arbeit und Liebe zu Frau und Kind halten ihn im Leben. Es ist eine zu Herzen gehende Szene, wenn in der Nacht der Flutkatastrophe Hauke Haien mit seinem Schimmel noch einmal hinaus muss an den Deich und wie das Kind hinter ihm herruft: „Vater, lieber Vater“. Das Kind, das zuvor in einem Gespräch (über infantiles Allmachtsdenken, würde Freud sagen) mit ihm gefragt hatte: „Vater, du kannst das doch, du kannst doch alles.“ „Was soll ich können?“ Dem Wasser sagen, dass es uns nichts tun soll. „Nicht ich kann das, Kind, aber der Deich schützt uns, den dein Vater ausgedacht und hat bauen lassen.“ (75f) Dieser Deich ist nun gefährdet. Um das Dorf zu schützen, wollen die Bauern den neuen Deich durchstechen. Der Hauke Haien-Koog soll überschwemmt werden. Sein Erbauer springt verzweifelt in die Bruchstelle, die sich im alten Deich aufgetan hat und das Dorf bedroht. „Herr Gott, nimm mich, verschon die anderen.“ Der agnostisch eingestellte realistische Erzähler Theodor Storm lässt in seiner letzten Novelle eine scheinbar versunkene Glaubens-und Geisterwelt der Vorfahren noch einmal auferstehen. In der Not der Sturmfluten und der privaten Krisen rufen die Menschen zu Gott. Die Erzählung lässt offen, ob Gott eingreift oder nicht. Eher nicht, wäre wohl zu sagen. Aber entscheidend ist, dass die Protagonisten der Novelle Gott nicht ganz loslassen. Dass die Rede von Gott, der Glaube an Gott im Gut-Vernünftigen wie im Abergläubischen hilft , das Übermächtige der Natur, des Meers, den Schrecken der Katastrophe zu bewältigen. Die Aktualität von Storms Novelle liegt darin, dass dieser Gottesbezug auch in Zeiten scheinbar vollendeter Säkularisierung noch relevant ist. Der holländische Regisseur Johan Simons, der jetzt am Thalia-Theater den Schimmelreiter dramatisiert hat, war davon fasziniert. Selbst am Wasser aufgewachsen, hat er als Kind die große Sturmflut in Holland von 1953 miterlebt (und meinte am Morgen der Katastrophe, als er rechts und links seines Elternhauses das Wasser anbranden sah, das kann nur Gott getan haben), eine Schreckenserfahrung, die ihn bis heute nicht loslässt. Die Welt von Theodor Storms Schimmelreiter ist ihm vertraut. Er meint: „Religion spielt in dieser Welt eine große Rolle. Jeder glaubt an Gott, man wird mit Gott geboren und man stirbt auch mit Gott.“ (Programmheft Thalia-Theater) Und das Gottesverhältnis des Menschen ist wichtig für seine Beurteilung durch die anderen. Dieser absolute Glaube an die Existenz Gottes in Storms Novelle hat Simons fasziniert, mehr als die Beschreibung des Fortschritts in der gelungenen Eindeichung des Hauke Haien-Koogs oder die Gespenstergeschichten. Diese Ebene stellt er in den Mittelpunkt seiner Inszenierung. Das führt zusammen mit dem sehr langsamen gedehnten Tempo zu einer Akzentverschiebung der Erzählung. Die Geschichte bekommt eine zugleich spätmittelalterliche und eine frühmoderne Erscheinung. Vor allem strukturiert durch ein Ritual, das gleich zu Beginn des Stücks eindrücklich inszeniert ist. Eine schräg aufragende Wand mit zwei Treppen und dem Kadaver eines Schimmels nimmt den Bühnenvordergrund ein, darüber hängt eine Glocke. Leise wird sie geläutet und die Figuren von Storms Novelle Der Schimmelreiter treten auf den Deich – der Deichgraf Hauke Haien, seine Frau Elke, die alte Trien Jans ,das Kind, der Großknecht Ole Peters und Carsten. Hauke beginnt: Es war im Jahr 1756, als eine Sturmflut ungeheuren Ausmaßes Nordfriesland heimsuchte. Er beschreibt das heraufziehende Unheil. Die Alte erwähnt merkwürdig-abartige Erscheinungen in der Natur, kleine Totenköpfe im Waschbecken des Pfarrers, dann spricht sie ein flehentliches Gebet, das Kind fragt, was denn geschehe, sie stirbt ist die Antwort,. „Gott gnad die annern“, hatte die Trins noch gesagt. „Was wollte die alte Hexe. Sind denn die Sterbenden Propheten--?“ fragt Hauke Haien.
|
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/105/hjb52.htm |
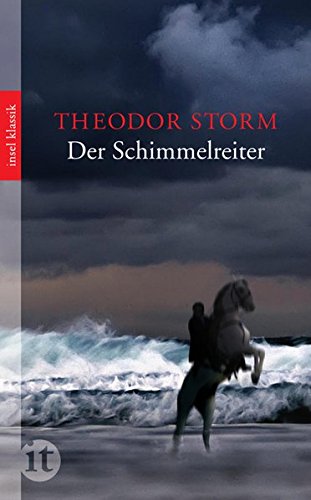
 Zu dieser archaischen Erbschaft gehört auch der Gespensterglauben, der in Haiens Schimmel, dem „Teufelspferd des Deichgrafen“, das weiße Pferdegerippe von der Jeverhallig wiedererkennen will. Noch die Zeitgenossen des Erzählers im 19. Jahrhundert sehen in der Erscheinung des vorbeireitenden Schimmelreiters Vorboten eines Unglücks. Zu diesem Aberglauben gehören auch die Erscheinungen der im Wasser Gestorbenen, gehört die Erzählung von den schrecklichen Vorzeichen der sich ankündigenden Katastrophe in der Natur, kleine Totenköpfe im Waschbecken des Pfarrers.
Zu dieser archaischen Erbschaft gehört auch der Gespensterglauben, der in Haiens Schimmel, dem „Teufelspferd des Deichgrafen“, das weiße Pferdegerippe von der Jeverhallig wiedererkennen will. Noch die Zeitgenossen des Erzählers im 19. Jahrhundert sehen in der Erscheinung des vorbeireitenden Schimmelreiters Vorboten eines Unglücks. Zu diesem Aberglauben gehören auch die Erscheinungen der im Wasser Gestorbenen, gehört die Erzählung von den schrecklichen Vorzeichen der sich ankündigenden Katastrophe in der Natur, kleine Totenköpfe im Waschbecken des Pfarrers.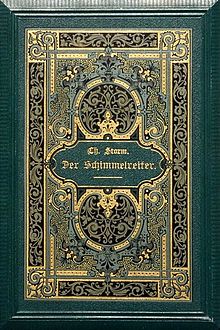 Diese Szene widerholt sich in Johann Simons Dramatisierung der Novelle sieben Mal. Sie ist ein Ritual, das an den Schrecken des Deichbruchs und die persönliche Katastrophe des Hauke Haien und seiner Familie erinnert. „Jedes Mal, wenn die Glocken läuten und die Figuren auf dem Deich kommen, erscheinen sie für mich vor dem Angesichte Gottes. Die Glocke, die zwischen Himmel und Erde hängt, ist wie die Stimme Gottes. Jeder muss seine Schuld vor Gott tragen, also springt das Geschehen immer wieder zurück in die Vergangenheit“, sagt Simons. Man muss die Konsequenz dieser Inszenierung anerkennen, auch wenn sie für viele Zuschauer eine Zumutung ist, einige sogar aus dem Theater treibt. Sie stellt eine unabweisbare Frage an unseren Umgang mit Katastrophen. Robert Leicht, prominenter Laie und EKD-Synodaler, schrieb angesichts des Tsunami in der ZEIT vom 30. Dezember 2004 ausdrücklich: „Schuldlos in der Sintflut“: „Es drängt uns der Heimsuchung einen Sinn zu geben – und wir entdecken doch nur unsere Verwundbarkeit.“ Damit schien die alte straf- und mahntheologische Diskussion endgültig beendet. Der Schimmelreiter zeigt, dass sie es nicht ist.
Diese Szene widerholt sich in Johann Simons Dramatisierung der Novelle sieben Mal. Sie ist ein Ritual, das an den Schrecken des Deichbruchs und die persönliche Katastrophe des Hauke Haien und seiner Familie erinnert. „Jedes Mal, wenn die Glocken läuten und die Figuren auf dem Deich kommen, erscheinen sie für mich vor dem Angesichte Gottes. Die Glocke, die zwischen Himmel und Erde hängt, ist wie die Stimme Gottes. Jeder muss seine Schuld vor Gott tragen, also springt das Geschehen immer wieder zurück in die Vergangenheit“, sagt Simons. Man muss die Konsequenz dieser Inszenierung anerkennen, auch wenn sie für viele Zuschauer eine Zumutung ist, einige sogar aus dem Theater treibt. Sie stellt eine unabweisbare Frage an unseren Umgang mit Katastrophen. Robert Leicht, prominenter Laie und EKD-Synodaler, schrieb angesichts des Tsunami in der ZEIT vom 30. Dezember 2004 ausdrücklich: „Schuldlos in der Sintflut“: „Es drängt uns der Heimsuchung einen Sinn zu geben – und wir entdecken doch nur unsere Verwundbarkeit.“ Damit schien die alte straf- und mahntheologische Diskussion endgültig beendet. Der Schimmelreiter zeigt, dass sie es nicht ist.