
Kultur |
Bildungs-GangBildung in F.C. Delius‘ Erzählung „Bildnis der Mutter als junge Frau“Christian Göbel
Einleitung
Offensichtlich geht es – wie Delius verschiedentlich unterstrichen hat – um eine Art Erkenntnisweg, aus der tagtraumartigen Existenz im sicheren, fernen Rom zum allmählich erwachenden Verständnis der politischen Realitäten und des Krieges. Der Leser sieht sich einer Dürrenmatt‘schen Harmlosigkeit des Erzählten gegenüber, dessen Hinter- und Abgründe nur allmählich bewusst werden, nie ganz durchscheinen. Oft reichen Andeutungen wie der Hinweis auf einen „Mann im Schwarzhemd“, der den Bürgersteig mit seinem kaputten Fahrrad versperrt (107). Verstörend, zuweilen empörend, wirken die Naivität und Selbst- und Weltverniedlichung der Hauptfigur. Delius gelingen dabei irritierende Einblicke in das chaotische Gefühlsleben einer Frau der Nazi- und Kriegsjahre. Er bietet aber auch einen kritischen Entdeckungsspaziergang durch seine Geburtsstadt und deren deutsche Kolonie, in der nicht selten ‚Bildungsphilister‘ den Ton angeben; als „Liebeserklärung“ oder „Hommage“, wie die ZEIT 2006 schrieb, bleibt das Buch zumindest ambivalent. Beide Themen, der Erkenntnisweg der jungen Frau und die Schilderungen römischer Kultur, öffnen eine dritte Deutungsebene: die Erzählung lässt sich auch als eine Allegorie auf die Bildung lesen. Wir sehen die junge Frau – ihr Name, Margarete, kann nur erschlossen werden (25) – vor uns wie in einem „Bildnis“ (Titel); ihr Gang bildet sie aber auch auf eine Weise, die wesentliche Kennzeichen von Bildung als umfassende, über die bloße Wissensvermittlung hinausgehende Reifung des Menschen in Geist und Seele illustriert. Ihr Erkenntnisweg ist Bildungs-Gang. Dessen Schritte und Stufen sind oft nur zu erahnen aus wie beiläufig mitgeteilten Gedanken. Dabei bleibt allerdings zuweilen unklar, ob das Allegorische den Rahmen der Erzählform überfordert, ob die Naivität der Hauptperson nicht überzeichnet ist und wie bewusst der Autor selbst diese Deutungsebene beschritten hat. Denn die Wanderung durch Rom bildet die junge Frau in einer Form, die die Erzählwirklichkeit hinsichtlich Ort, Zeit und Gehalt ihres Erkenntnisgewinns übersteigt. Bildung als Thema der ErzählungDen Aspekt der Bildung – dass nämlich die Hauptfigur im Grunde ein junges Mädchen „ohne jede Bildung“ sei – hob Delius bei der römischen Lesung besonders hervor. Doch schon die wenigen Passagen, aus denen er las, warfen Fragen auf. Besonders vom Schluss her ergeben sich Zweifel an der These von Unbildung und Kulturlosigkeit. Kann die Behauptung zutreffen auf eine Frau, die endlich, am Ende ihres langen Gangs durch Rom, eine Stadt, von der sie wenig versteht, unter den Blicken der Römer, von denen sie wenig weiß (und hält), ihre Ängste und Sorgen, ihre Verkrampfungen und Unsicherheiten in der Musik überwindet? Und es ist nicht irgendeine Musik, sondern ein Streichquartett Haydns und eine Bach-Kantate, klassische Musik-Schöpfung, die Religion, Mythos, Literatur Gestalt gibt, dargeboten im Kirchenraum, über dessen Architektur und deren Zusammenspiel mit der Musik die junge Frau feinsinnig reflektiert, so dass sie eine „Kuppel aus Harmonien“ wahrnimmt und ihr ein bergendes „Pantheon der Töne“ entsteht (154f.). Das Erlebnis wird zum Gesamtkunstwert, das, wenn nicht die ‚Bildungsbürgerin‘, so zumindest den umfassend gebildeten und empfindenden Menschen anspricht. Der jungen Frau wird das Musik-Erleben in der römischen Christuskirche zur Überwindung der Schrecken des Todes, der im „Choral Komm, o Tod, du Schlafes Bruder“ (155) geradezu herbeigesungen wird. Das übertönt den ganzen „Lärm des Krieges“ (der ihr noch fern und vor allem in der Vorstellung oder durch „Wehrmachtsberichte im Radio“ erfahrbar ist), „so dass sie sich weitere und viel lautere Choräle gegen den Tod wünschte, Tag und Nacht müssten Choräle erschallen und die Orgeln mit allen Registern gehen, bis der Krieg am Ende sei, und ab sofort sollten alle mitsingen, Schwester Ruth, Schwester Luise, und sie müssten nur anfangen, alle Zuhörer in ihrer Reihe, alle in der Kirche, die ganze Via Sicilia, ganz Rom, ganz Europa müsste einstimmen und ohne Pause einen Choral nach dem anderen singen, / auch die Soldaten, wie sie es früher beim Alten Fritz getan hatten, alle Generäle an allen Fronten, Christen, Heiden, Juden, Kommunisten, alle müssten Atem holen und einstimmen in ein gewaltiges Lobet den Herrn, wie es ihr Kapitänsvater so kräftig anzustimmen verstand, dass man gar nicht anders konnte als aus voller Brust mitzusingen und den mächtigen König der Ehren zu preisen, / alles passte unter das Himmelszelt der Musik, auch die wunderbare Stille, die nach dem Ende des letzten Taktes anbrach mit nachhallenden Schwingungen, eine gelöste, heitere Stille, die zu ihrer inneren Stille passte, ein halbminütiges, nicht von Beifall oder Unruhe gestörtes Schweigen, das ihrem glücklichen Schweigen entsprach und ihr den Gedanken eingab, das Schönste im Krieg sei die Stille“ (156f.). Soweit aus dem Schluss des Buchs, den Delius vorlas. Schon damit stellte sich also die Frage: Kann jemand ungebildet sein, der einen solchen Sinn für das Geschaffen-Schöne hat, darin existentielles Durchatmen, Erlösung findet und zugleich die friedensstiftende Kraft der Musik erkennt? Ist eine Frau ‚ungebildet‘, die das „Wunder“ sieht – und sich von ihm ansprechen lässt –, dass „Bach noch 200 Jahre nach seiner Zeit das Empfinden einer einundzwanzigjährigen Frau […] mit einer einzigen Kantate verstehen und ausdrücken und mit Trost lindern“ kann, und die auf höchst gebildete Weise sinniert über die „in die Tiefen der Seele dringenden Musik von Bach, gespeist aus biblischen und ähnlich kraftvollen Worten und der klaren Sicht eines flehenden und dankenden Ichs“ (152f.)? Besteht hier ein Widerspruch zur erklärten Absicht des Autors? Will ihm die Darstellung der Unbildung nicht recht gelingen? Oder bedarf der Bildungsbegriff eingehenderer Klärung? Ich spreche Delius nach der Lesung darauf an, ein kurzes Gespräch, in dem er zugibt, ohne es, auf dem Sprung, recht fassen zu können, dass die Hauptperson wohl „emotionale“ Gefühls- oder Herzensbildung habe; impliziert ist, dass es eher um den Mangel an formaler Bildung gehe. Formen von Bildung und UnbildungDer Blick ins Buch bestätigt zunächst, dass Bildung bzw. der Mangel der Mutter an Wissen ein zentrales Thema ist: Rom weckt in ihr die Furcht des Unbekannten mit seinen „unendlich vielen Wallfahrtsorten der Gebildeten, an denen sie ungebildet vorüberlief“ (15), ein „mecklenburgisches Landmädchen, das keine höhere Schulbildung mitbrachte“ (27). Immer wieder wird ihr Unverständnis betont, weil sie die Sprache nicht versteht oder kulturell-historische Hintergründe nicht kennt. Die Stadt ist „voll von Hieroglyphen und Rätseln“ (33); „SPQR“ sind ihr „unverständliche Buchstaben“ (21); „sie fühlte sich sprachlich völlig unbegabt, hatte nicht einmal drei Wörter einer anderen Sprache gelernt“ (10), erst recht kein Latein (26). Ihre Ehe ist auch Bildungsbeziehung, in der die – jüngere – Frau mit fast kindlichem Eifer vom Mann zu lernen bereit ist, von seinem Wissen profitiert, ihn für seine Kenntnisse „bewundert“, staunend aufsaugt, was er mit ihr teilt, und auch dann noch „dankbar für seine Klugheit“ (51) ist, wenn er ihre Naivität nahezu väterlich „lächelnd“ korrigiert (29). Eine recht einseitige, aber nicht zeituntypische Abhängigkeit der Geschlechterrollen. Freilich hat die junge Frau doch eine gewisse formale Bildung genossen. In der Schule hatte sie „in Rechnen und Turnen die besten Noten“, Interesse an Biologie (10f.) und ausgezeichnete Kenntnisse in der Pflanzenkunde (54). Es stellt sich zudem heraus, dass sie aus (verarmter) adliger Familie stammt (76), und die Prägung im Elternhaus hat ihr durchaus ein Geschichtsbewusstsein vermittelt; auch Grundkenntnisse von Roms Vergangenheit hat sie sehr wohl mitbekommen (26, 112), und sie ist bereit, selbst Wissen zu suchen, etwa im Baedeker. Dieser Bildungsdrang mag zwar durch Gert veranlasst sein, doch ließ sie sich bereits in ihrem früheren Leben z.B. von der Architektur des Doberaner Münsters und der Wartburg ansprechen (32, 78, 127). Dass sie Neptuns Dreizack für eine Gabel hält (29), scheint vor diesem Hintergrund wenig überzeugend. Schließlich hat sie sogar eine weiterführende (Aus)Bildung genossen, allerdings stark ‚genderspezifisch‘, nämlich mit dem Ziel, auf eine traditionelle Rolle als „Mutter und Ehefrau an der Seite des ihr bestimmten Mannes“ vorbereitet zu werden; dazu kam sie von Doberan nach Kassel, wurde auf „Haushaltsschule“ und „Kindergärtnerinnen-Seminar“ (122, 144) geschickt. Sie ist mehr als andere Frauen ihrer Generation herumgekommen, kennt sich in Rostock und Eisenach aus, war in Berlin, und die Wartburg ist ihr nicht nur ein Begriff, sondern Inbegriff der eigenen, deutschen, protestantischen Bildung und des daraus erstehenden Weltgefühls (66). Die „stolze, schöne, deutsche Wartburg“ mit ihrem „von Luther geheiligten Boden“ beschwört sie auch im fernen Rom; vor dem inneren Auge bleibt ihr „die uneinnehmbare, hoch über den Wäldern thronende Festung […] prägendes Bild des Glaubens“ (60f., 126). Überhaupt haben die frommen Eltern Margarete so bibelfest werden lassen, dass sie ihre Gedanken immer wieder mit Bibelzitaten durchsetzen kann. Der Glaube ist damit weiteres Thema des Buchs; er prägt die Hauptfigur entscheidend und wird zum Gegenstand fortschreitender Reflexion. Es geht auch um Glaubensbildung. Natürlich reichen diese Wissensansätze nicht, eine Weltläufigkeit zu entwickeln, die Margarete Rom – den „Nabel der Welt“ (27) – vertrauter machen könnte. Fremd bleibt ihr die Stadt aber auch aus anderen Gründen: weder versteht sie die Mentalität der Römer, ihre „Gesten und Blicke“ (17) kann sie nicht deuten, noch hat sie einen Sinn für ihre Katholizität und den Pomp im Petersdom der 1940er Jahre, wo der Papst „wie ein Sieger im Olympiafilm oder der Führer in der Wochenschau“ begrüßt wird und „vor lauter Getöse kein Singen und Beten zu hören war, alles wirkte so heidnisch, so laut, so äußerlich, eher ein Theater als ein Gottesdienst“ (20). Kurz: sie „fühlte sich bisweilen zu evangelisch oder zu norddeutsch oder zu jung in der ewig genannten Stadt“ (115). Nun fällt beim Lesen der Erzählung eine schwer einzuordnende Spannung auf, die dadurch zustande kommt, dass Margarete über ihre vermeintliche Unbildung auf eine Weise reflektiert, die, wie es scheint, allzu offensichtlich dem – gebildeten – Autor zuzuschreiben ist. Diese Spannung könnte allerdings dann gerechtfertigt sein, wenn die Hauptfigur darin eine wesentliche Grundlage des Gebildetseins unter Beweis stellte: im Bewusstsein des Nichtwissens brächen, in bester sokratischer Tradition, natürliches Selbstbewusstsein und Bildungsdrang des Menschen durch. Das freilich wird kaum ausdrücklich thematisiert. Zudem bleibt auf anderer Ebene zunächst eine irritierende Naivität, die eine markante Form mangelnder Selbstbildung darstellt, nämlich in Bezug auf den immer näher rückenden Krieg und, allgemeiner, der Politik gegenüber, an der Margarete geradezu trotzig-bewusst desinteressiert ist – offenbar, weil das kein Frauenthema sei (28, 72, 83). Zur Kritik am Faschismus kann sie damit nicht kommen. Distanzlos übernimmt sie chauvinistische Vorurteile und den deutschen Vaterlands- und Rassendünkel auch gegenüber den italienischen Verbündeten, mit denen sie nur widerwillig den „Adler“ als „Wappentier“ teilt (41). In diese Haltung mischt sich eine generelle Prüderie (sie scheut selbst vor Nacktheit in der Kunst zurück: 56,118), so dass ihr die Römer als „liederlich“ und „träge“ (23) erscheinen. Schon die alten Römer hatten die „losen Sitten“ (40) der heutigen (freilich spielt hier persönliche Erfahrung eine Rolle: Blicke, Pfiffe und sogar einen Griff ans Gesäß hat Margarete über sich ergehen lassen müssen: 34); man pflegt frech „Müßiggang“ statt „Disziplin und Ordnung“ (117). Margarete flüchtet sich in den Gedanken, dass die Blicke römischer Männer vielleicht daher kommen, dass sie sie „als Deutsche erkennen, als Arierin“ (24), und spiegelt die überhebliche Haltung der deutschen Exilantenkolonie, der es gefällt, „dass eine deutsche Frau bald wieder ein deutsches Kind gebären werde“ (129). Die protestantische Ablehnung alles überbordend Katholischen wird mit hineingenommen in diese Aversion gegen Rom und die Römer. Es entsteht eine eigenartige Mischung von Naivität und Minderwertigkeitsgefühlen auf der einen Seite und einem stur-stolzen Überheblichkeitsdenken auf der anderen Seite, die auch deswegen zunächst nicht hinterfragt wird, weil Margarete die Grundfesten ihrer Moral als gesichert ansieht (ohne dass diese allerdings über vorwiegend äußerliche Aspekte der Sittlichkeit hinausgingen). Immerhin hat sie, durch Eltern und Umfeld, durchaus positive Tugenden entwickelt, z.B. den ausgeprägten Sinn für Bescheidenheit, der römischem Luxus, dem bloßen Zur-Schau-Stellen und der Äußerlichkeit des hiesigen Kulturlebens tatsächlich überlegen scheint (113f.). Religiöse und politische UnmündigkeitDoch die sittliche Prägung entstammt einem unreflektierten Glauben, der eine unheilige Allianz mit politischen Vorurteilen eingegangen ist. Genauer: Die ‚Unbildung‘ gesellschaftlicher Kritiklosigkeit erstreckt sich auch auf Margaretes Glaubensleben, das formelhaft und ohne echte Erkenntnistiefe bleibt. So kann sich faschistisches Denken in den religiösen Betrachtungen niederschlagen, zu denen sie Zuflucht nimmt. Der politische Antisemitismus macht ihr „auch die Gestalten des Alten Testaments irgendwie verdächtig“ (80). Freilich sind in dieser Hinsicht auch viele der ‚formal gebildetsten‘ Zeitgenossen – Deutsche wie Italiener – gescheitert. Wer sich im Dunkel des Faschismus einrichtet, dem mangelt es an wahrer Menschenbildung, Selbstreflexion, Herzensgröße, am Sinn für den Mitmenschen in Empathie wie Reflexion. Besonders ‚bloße‘ Mitläufer – auch in der so zivilisiert scheinenden Kulturgesellschaft der römischen Kolonie – beweisen, dass ihnen ein wesentliches Kennzeichen von Bildung in ihrer ganzen philosophischen Größe fehlt: an der Distanznahme zu sich, zu anderen, zu gesellschaftlichen Vorgaben. Mitläufer und Gutheißer sind in besonderer Weise der Masse des ‚Man‘ verfallen (M. Heidegger). Margarete verkörpert das, zumindest zu Beginn des Buchs. In diesen Passagen gelingt Delius eine verstörend eindrückliche Beschreibung der Mitbedingtheit unkritischen Mitläufertums durch soziale Abhängigkeit, die hier auch durch die allzu zeit- und regimegemäße Geschlechterrolle markiert ist sowie durch die kaum reflektierte Religiosität. Allerdings deutet Delius schon bald einen möglichen Gegenentwurf politischer Wachheit aus dem Glauben an: Margaretes Vater und Mann haben Kontakte zur Bekennenden Kirche (83), und in Rom steht ihr Ilse gegenüber, eine selbstbestimmte Frau, die sich souverän in der römischen Gesellschaft zurechtfindet und dem Widerstand nahesteht. Von ihrer offenen und „forschen Art“ (71) ist Margarete fasziniert, aber auch angstvoll zurückgestoßen. Sie weiß, dass Ilses Zweifel „im Reich“ als Wehrkraftzersetzung gälten; Ilses Vertrauen wird ihr „unheimlich“ (69). Alter und Lebenserfahrung geben Ilses Worten eine Autorität, die in Margarete Ansätze erster Zweifel am Sinn des Krieges aufkommen lassen, die aber schnell wieder erstickt werden. Sie fühlt sich „schuldig“, ist „verwirrt und erschrocken von diesem verbotenen Gedanken“ und flüchtet sich in eine Haltung des Mitleids gegenüber der anderen Frau, die seit drei Jahren von ihrem Verlobten getrennt ist, „offenbar zu wenig festen Halt im Glauben“ hat und „nicht jeden Sonntag zum Gottesdienst“ geht, „daher womöglich ihre seltsamen Ansichten“ (72f.). Ihre Haltung Ilse gegenüber schwankt zwischen Bewunderung und Unverständnis; weiteren Gesprächen, die sie „so durcheinander bringen“, will sie aus dem Weg gehen (73). Margarete denkt lange bereitwillig in den Schemata nationalsozialistischer Gehirnwäsche und hat sich einen missgeleiteten Fatalismus der Gottergebenheit zu eigen gemacht, der von manch kirchlicher Seite unterstützt wird („seit sie zwölf war, hatte der Führer das Deutsche Reich von einem Triumph zum andern geführt“, und „für die politischen und militärischen Erfolge wurde auch in den Gottesdiensten mit Gebeten gedankt“: 59). So ist sie bereit, jede politische Agenda und Propaganda und noch die schlimmste Wirklichkeit pseudotheologisch zu überhöhen und damit zu akzeptieren. Immer wieder nimmt sie Zuflucht zum Gedanken an Hiob (70, 115) und sieht das Leben – die Trennung von Mann und Eltern im fremden Rom sowie generell den Krieg, das „arme, von Feinden umstellte Deutschland“ (70) – als „schwere Prüfung“ (69), die Gott schon „zum Besten“ lenken werde (48). Sogar der Führergehorsam erscheint ihr gottgewollt: die „Obrigkeit […], Hitler und Mussolini“, sei schließlich „von Gott gegeben“ (72). In dieser Haltung wird sie auf ihrem Weg zum Konzert „nur einen winzigen Augenblick lang von der Frage irritiert […], warum im Krieg das Brot nicht reicht und immer weniger wird, wo man doch immer mehr Land erobert und immer mehr Siege meldet, wo ist das Brot geblieben, der Weizen wächst doch weiter und der Roggen, man konnte das sehen aus den Eisenbahnfenstern, wie alle Felder blühten und reiften, wo ist das Brot geblieben, aber so durfte man nicht fragen, es war eine Prüfung, es war Gottes Wille, er schenkte das tägliche Brot und verteilte es“ (18f.). Hier wird Eigendenken durch das Wiederkäuen fremdbestimmter Vorurteile ersetzt; und was man sich auch selbst oft genug einredet, glaubt man schließlich. Wer so handelt, hat sich in den Zustand Kant’scher Unbildung begeben, die den Gegensatz zur philosophischen „Aufklärung“ darstellt und von einer „selbstverschuldeten Unmündigkeit“ gekennzeichnet ist, nämlich dem „Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen“ (I. Kant, Was ist Aufklärung?). Erwachende Kritikfähigkeit und BildungswilleFreilich ist eine andere Lesart solcher Stellen möglich: die wiederholte, aufreizend penetrante Selbstbeschwichtigung ist auch Beleg für das allmähliche Aufbrechen eines kritischen – und urmenschlichen – Potentials, das zunächst mit einer common sense-Logik verschiedene Wirklichkeitserfahrungen aneinander misst. Im eben zitierten Beispiel findet das Ausdruck in Margaretes Reflexion über die Unverfügbarkeit des Brots, die anderen Beobachtungen – der aus dem Eisenbahnfenster normal scheinenden Welt weiter wachsenden Getreides – widerspricht. Solche Reflexionen machen die bemühten, formelhaft-hohlen Denkmuster überhaupt erst erforderlich, können darin nur mühsam und unter immer größerer Kraftanstrengung zurückgedrängt werden, bis sie sich schließlich kaum noch einfangen lassen und die logische Reflexion zu politischen und ethischen Fragen führt und nicht mehr bereit ist, die vorgegebene soziale Wirklichkeit fraglos zu akzeptieren. Immerhin fällt Margarete früh auf, dass „die Siegesparolen immer öfter zu hören und zu lesen“ sind, je weniger „es in Russland gut aussah“ (22, 58). Auch über den Sinn der zahlreichen „Gesetze und Bestimmungen“ (117) ist sie sich nicht immer im Klaren. Schon Stellen, die auf den ersten Blick noch als unfassbar naive Zeugnisse von „Mitläufertum, Gottvertrauen und Führergehorsam“ erscheinen mögen (H. Huber auf www.lesekost.de), zeigen somit indirekt den „zögernden Beginn einer Emanzipation“ (FAZ 2006) an, die sich im Buch auch vollzieht. Margarete trägt die Ambivalenz ihrer Gefühle – den passiv-naiven Fatalismus auf der einen Seite und doch auch immer wieder aufkeimende Kritik an den politischen Verhältnissen auf der anderen (beide sind stark von ihrem Glauben mitgeprägt: 106) – noch in das Konzert in der Christuskirche, in dessen Verlauf es zum klärenden Durchbruch kommt. Es ist zunächst die „weltliche, weit über die Bräuche des Lobens und Dankens hinausschweifende, über den täglichen Kummer triumphierende Musik“ Haydns, die eine längst vorhandene, aber immer wieder zurückgedrängte, natürlich-menschliche „Sehnsucht nach Frieden“ anspricht und – nun bei voller Anerkennung der Realität des Krieges – als „befreiender Anschub ihrer liebsten und geheimsten Phantasien“ wirkt (145). So empfinden auch die anderen Zuhörer. Doch über den Beifall erschrickt Margarete noch; sie erahnt in ihm ein „aufsässiges“ Zeichen des Widerstands (145). Angesichts der jahrelangen Prägung durch nationalsozialistische Propaganda (und der möglichen Anwesenheit „Offizieller“ im Publikum), gepaart mit ihrem hilflos verbogenen ‚Gottvertrauen‘, verbietet sie sich zunächst solche „fast lästerlichen Sprünge“ (143). Doch ihre Entwicklung innerhalb des Konzerts schreitet voran, und sie erfasst endlich auch eine tiefere Logik des christlichen Glaubens. Zuvor feierte sie die eigene Fähigkeit als Erfolg, allmählich erkannte Konflikte zwischen „Kreuz und Hakenkreuz“, Führer- und Gottesverehrung (123) zu verdrängen. Dann aber löst sich die Verwirrung über die Diskrepanz zwischen Regime und Religion, über die Vermischung von selbstlos-christlicher Liebe und Rassenkunde (123f.), über den Missbrauch christlicher Symbole (137), über den Widerspruch zwischen göttlicher Rachsucht und Barmherzigkeit, über das Dilemma politischer Feindbilder zur Kriegsrechtfertigung angesichts der völkerverbindenden (oft mit den ‚Feinden‘ geteilten) Christlichkeit und der Grundprinzipien christlicher Nächstenliebe (147). In die Friedensvision zum Ende des Konzerts kann sie sogar Kommunisten aufnehmen (156), deren Lehre sie noch kurz zuvor, religiöse Pauschalurteile und politische Propaganda wiedergebend, als „Religion der Gottlosen, bekämpft und fast schon besiegt“ (148), bezeichnete. In der Schlussszene mit ihrer Vision von Frieden durch Musik, von einer „maigrünen Zukunft“ „ohne Befehle“ und „Verfeindungen“ (141f.), ist die Selbsteinordnung in den Fatalismus der Mitläufer überwunden, die sich in ihren Antworten auf drängende Fragen der Zeit und der eigenen Existenz mit (selbst)beschwichtigenden Verweisen auf die Politik des Vaterlandes und ‚Gottes Wille‘ zufrieden geben – auch wenn sich Margarete diese Überwindung noch immer nicht ganz selbst eingestehen kann und Bestätigung und Billigung des Gatten einholen will. Ihm allein hat sie bisher ihre „zwiespältigen Gefühle“ anvertrauen und „über Heikles, über die Gefährlichkeit ihrer Einfälle sprechen“ können (82). So endet das Buch mit Margaretes Vorsatz, „noch heute einen Brief zu schreiben und möglichst viel von dem, was sie auf ihrem Weg beobachtet und unter dem Himmelsdach der Musik empfunden hatte, im Herzen zu bewahren und dem fernen Geliebten in Afrika zu erzählen und zu berichten, möglichst noch heute, nach dem Abendbrot, in einem langen, langen Brief“ (157). Bildung im Zusammenspiel zwischen Selbst und AnderenSelbst wenn es sich bei diesem Vorsatz nicht nur um ein formales Festhalten an gewohnten Mustern handeln sollte, wenn also der Bildungsaufbruch dieser jungen Frau nur im Zusammenspiel und unter der Führung eines Mentors vonstattengehen sollte, so handelte es sich noch dabei um eine Form bereits erreichter Bildung. Er belegt den Willen zur Bildung und kommt der bewussten Entscheidung nahe, sich bilden zu lassen. Das Bildungsideal aufklärerischer Philosophie (Kant u.a.) stellt – in zuweilen irreführender Weise – das vollkommen autonome Subjekt in den Vordergrund[2]. Das antike, sokratische Ideal hingegen betont deutlicher – ohne Eigen-Bildung und Selbst-Denken zu vernachlässigen –, dass sich dieser Aufbruch im dialektischen Zusammenspiel und unter der „Seelenführung“ (Phaidros 271c) eines ‚Meisters‘ ereignen kann. Dazu ein Blick auf das klassische Beispiel literarisch-philosophischer Bildungsallegorien, Platons Höhlengleichnis (Politeia 514ff.). Im Philosophieunterricht unserer Zeit wird es gern mit aufklärerischen Motiven unterlegt und dient zur Illustration des Bildungsaufbruchs des Subjekts, das radikal alles Gewohnte – Tradition, gesellschaftliche Vorgaben und Denkmuster und generell die Wirklichkeit, wie sie uns erscheint – hinterfragt. Doch auch in Platons Text ist am Ende eben nicht jeder der Höhle entronnen. Bildungsgewinn wäre schon dann zu erreichen, wenn die Höhlenbewohner bereit wären, auf den zu hören, der den Aufbruch und gefahrvollen Weg ans Licht und den Denkweg in die Sphären des transzendenten Grunds alles irdischen Seins auf sich genommen hat. Er hat die wahre Welt außerhalb der Höhle gesehen und ist bereit, die Verantwortung der Gebildeten anzunehmen, zurück ins Dunkle hinabzusteigen, um sein Wissen zu teilen und die Welt der Schatten zu erleuchten. Es reichte also, wenn sich die Unwissenden in der Höhle bilden ließen. Platons Gleichnis aber hat kein gutes Ende: die Höhlenbewohner schenken dem Gebildeten keinen Glauben und töten ihn, weil sie sich nicht aus der Welt des Unwissens, der bloßen Meinung und der Manipulation durch gesellschaftliche Führer, in der sie sich gemütlich eingerichtet haben, aufschrecken lassen wollen. Hier hat Platon offensichtlich Sokrates‘ Schicksal vor Augen, der als Märtyrer für die Wahrheit starb. Im Unterschied dazu bewiesen die Schüler des Sokrates und zahlreiche Generationen Späterer genau darin schon einen wesentlichen Grad von Bildung, dass sie sich bewusst den Philosophenschulen der Antike anschlossen, um dort (weitere) Bildung zu suchen und den Weg zur Weisheit fortzusetzen. Philosophie war dabei übrigens ein ganzheitliches Unterfangen, das theoretisches Wissen wie praktische Weisheit und Lebenskunst verband. Diese Tradition setzte das Christentum fort, allerdings mit dem Anspruch, im Glauben die „wahre Philosophie“ und Lebensform und in Christus die inkarnierte Weisheit gefunden zu haben (Augustinus, De vera religione 8). Der hl. Benedikt begründete in diesem Horizont die Tradition des abendländischen Mönchstums, in dem Klöster „Schule des Herrn“ (RB Prolog 45) und zugleich für Jahrhunderte Orte allgemeiner Bildung wurden. Die Selbstüberantwortung an die Weisung anderer auf dem Weg der eigenen Bildung sieht Thomas von Aquin sogar als Erweis göttlicher Gnade: „Die Menschen, die fremder Führung und Beratung bedürfen, wissen, wenn sie in der Gnade sind, wenigstens darin sich selber zu raten, dass sie den Rat anderer Menschen erbitten und dass sie einen guten Rat von einem schlechten Rat zu unterscheiden vermögen“ (Summa Theologica, II-II, 52,1,ad 1, Übers. J. Pieper). Bildung kommt also nicht ohne Beziehung aus; allein wird niemand gebildet. Doch Führung schließt keineswegs Selbständigkeit aus: bei Erwachsenen als selbstverantwortete Entscheidung zur Bildung und in der Kindererziehung als Ziel der begleiteten Reifung, die heute – neben den Familien – v.a. Erzieher und Erzieherinnen, Lehrer und Lehrerinnen leisten, denen Eltern ihre Kinder zur Bildung anvertrauen. Zugleich setzen heutige Schulen, gerade in der Tradition katholisch-humanistischer Erziehung, den ganzheitlichen Zugang der philosophischen Bildung fort, die – im Zusammenspiel von natürlichen Anlagen und sorgsamer Begleitung – umfassende menschliche Reifung im Auge hat. Der alte Gedanke des ‚Schulmeisters‘ ist in dieser Tradition der antiken Philosophenschulen und der christlichen Erziehung nicht überholt, sondern verdient neue Aufmerksamkeit. Denn einem solchen Lehrmeister liegen nicht nur Wissensvermittlung und Fächerkanon am Herzen, sondern Hilfestellung auf dem Weg zu einer Form der Geistigkeit und Selbstbesinnung, die den Menschen erst ‚gesellschaftsfähig‘ macht. So argumentiert schon Sokrates dem stolzen Jüngling Alkibiades gegenüber (im gleichnamigen Dialog Platons), und ähnliche Gedanken motivieren die Gründer christlicher Schulorden wie z.B. E. D’Alzon (1810-1880), der nicht allein „Karrierebildung“, sondern die ganze Person des Zöglings mit Körper, Geist und Seele ins Zentrum seiner Anstrengungen stellt[3]. Heute hat sich diesen Anspruch vielfach auch das staatliche Erziehungswesen zu eigen gemacht; er wurde zuletzt zum Leitbild aktueller Schulreformen. Wo ihm aber der Bezug auf ein Menschenbild fehlt, in dem Menschen-Bildung Selbstzweck sein darf, steht er stets in der Gefahr, außerkurrikulare, überfachliche „Schlüsselqualifikationen“ wie Sozial-, Methoden-, Personen- und Handlungskompetenz wieder auf marktrelevante Fähigkeiten zu reduzieren, die in wirtschaftlichen Erfolg übersetzt werden können. Friedensvision und ethisch-religiöse BildungDas Ziel solcher Bildung wird am Ende von Delius‘ Erzählung angedeutet, in der Friedensvision während des Kirchenkonzerts. Auf dieses Schluss-‚Bildnis‘ laufen die Hauptfigur und mit ihr das ganze Werk zu. Hier erwacht endlich echt ethische Bildung, als Margarete die verbindende Einheit der Menschheit erfasst. Dabei schöpft sie gleichermaßen aus einer natürlichen Gemütsbildung wie sie angeregt, erschüttert, aufgerüttelt ist durch das geradezu metaphysische Gesamterlebnis, in dem sie Schönes erfährt: Bachs Musik und den Aufschein der Transzendenz im Sakralraum der Christuskirche an der Via Sicilia. Die Szene setzt Ethos und Theos in Verbindung; das eine gründet im anderen: die Friedensvision der geeinten Menschheit über die Grenzen von Klassen, Nationen, Rassen hinaus nährt sich aus der Einsicht, unter dem einen Herrn und „König der Ehren“ geborgen zu sein (156). Freilich ist die geistige Kraft der Religion etwas, das auch Atheisten erfahren können. Ist nicht überhaupt jede Kirche architektonisches Ensemble, das noch dort, wo der religiöse Sinn verloren geht, zumindest ein ästhetisches Erlebnis bereitet und Geist, Kultur, Geschichte verkörpert und bewahrt? So lässt der Philosoph P. Mercier eine Hauptperson seines Romans Nachtzug nach Lissabon (btb 472006, 198) im Portugal des Salazar-Regimes folgende Worte sagen: „Ich möchte nicht in einer Welt ohne Kathedralen leben. Ich brauche ihrer Schönheit und Erhabenheit. Ich brauche sie gegen die Gewöhnlichkeit der Welt. Ich will zu leuchtenden Kirchenfenstern hinaufsehen und mich blenden lassen von den unirdischen Farben. Ich brauche ihren Glanz. Ich brauche ihn gegen die schmutzige Einheitsfarbe der Uniformen. […] Ich will den rauschenden Klang der Orgel hören, diese Überschwemmung von überirdischen Tönen. Ich brauche ihn gegen die schrille Lächerlichkeit der Marschmusik. Ich liebe betende Menschen. Ich brauche ihren Anblick. Ich brauche ihn gegen das tückische Gift des Oberflächlichen und Gedankenlosen“. Echte Religion jedenfalls braucht metaphysische Tiefe sowie ethische Oberflächenwirkung. Die im ‚mecklenburgischen Landmädchen‘ Margarete entstehende Friedensvision als Zielpunkt des Bildungsgangs stellt auch einen Gengenentwurf zu der bloß äußerlichen Bildung, dem selbstgefälligen Wissen und der nur sprachlich-gesellschaftlichen Gewandtheit dar, die in der deutschen Exilanten- und Diplomatengesellschaft sowie unter den beflissenen Kunsttouristen Roms oftmals den Ton angeben mögen (vgl. 94). Obgleich schon Ilse „die gebildeten Deutschen mit ihrem oberflächlichen Schönheitsblick“ in Frage stellte, „die Rom-Schwärmer aus den höheren Schichten“, die „nur das antike Rom […], die Paläste, Altäre, Säulen und Kunstwerke sahen und bei jeder Gelegenheit Goethe […] zitierten“, weil sie nichts vom einfachen Leben und den Nöten der Menschen mitbekamen (74), hat sich Margarete gerade ihnen gegenüber stets unzureichend ‚gebildet‘ gefühlt, so dass sie sich auch in ihrer Mitte (und nicht nur unter den Römern) nur am Arm des „Mannes und Beschützers“ (24) sicher wähnte. Vor dem Unbekannten und den Fremden schrak sie zurück, für sie hatte sie nur Seitenblicke und -gedanken übrig, als sie durch die fremde Stadt zum vertrauten Raum der deutschen Kirche eilte. Nun aber hat die junge Frau in diesem Fremden – Rom, seiner Geschichte und Kultur und den Römern, in den Schlussgedanken erweitert um „Heiden“ und Feinde an den fernen „Fronten“, „Juden“ und „Kommunisten“ – das Verbindende, Allgemein-Menschliche erkannt. Freilich wäre es nicht genug, wenn diese Erkenntnis nur Emotion, Idee, Kunstgenuss, „schöne Stunde“ (138) und momentane Tröstung (140) bliebe, ohne die Konsequenz einer aktiven Umsetzung im Leben; wenn Margarete also ihre Vision nur dem abendlichen Brief an ihren Mann anvertraute und – um Delius‘ Geschichte weiterzuspinnen – genauso verschlossen wie zuvor durch Rom zurückhuschte und weiterlebte, vor den Römern und allem Nichtdeutschen zurückweichend. Wenn aber dem geistigen Aufbruch auch ein Öffnen der Haltung anderen gegenüber folgt, so hat das Gesamterlebnis des Kirchenkonzerts die Wirkung, die jede Transzendenzbegegnung haben sollte: als Ermöglichung und Ermunterung zur Mitmenschlichkeit. Delius beschreibt zunächst nur ein Erlebnis des Schönen und der Musik, das sich grundsätzlich auch anderswo als im Kirchenraum vollziehen könnte, aber dadurch umso deutlicher eine religiöse Dimension erhält. Und der ethische Bezug rückt es durchaus in die Nähe eines Leitgedankens der katholischen Eucharistiefeier, in der die Gottesbegegnung ins Leben übersetzt und in die Welt getragen werden will: der Schlusssegen des Priesters ist zugleich Friedenswunsch und Sendungswort: „Ite missa est – Gehet hin in Frieden!“ Wenn Religion zentrales Element ethischer Bildung ist, ergibt sich das gelebte Ethos nicht nur aus der theologischen Reflexion, sondern gründet in der Feier der Liturgie, in der Erfahrung der Gemeinschaft mit Gott und anderen. SchlussMit der vorgeschlagenen Lektüre wird Delius‘ Erzählung – über die ‚Hommage‘ an seine Geburtsstadt Rom und die Beschreibung bequemen Mitläufertums hinaus – zur Illustration wahrer Bildung. Es bleibt allerdings bei einigen Brüchen. So weist das Allegorische über die Erzählwirklichkeit hinaus und darf, wie eingangs gesagt, nicht nur am ‚Realitätssinn‘ des Lesers gemessen werden. Es handelt sich hier nicht um einen Bildungsroman. Die beschriebene Wandlung kann sich nicht während eines Romspaziergangs allein vollziehen. Das Erwachen der natürlich-menschlichen Anlagen, die zugleich Voraussetzungen gelingender Bildung darstellen – darunter Kritik-, Emotions- und Empathiefähigkeit –, muss bereits im Gang gewesen sein. Doch Rom, zudem die noch relativ unbeschwerte Existenz zu Kriegszeiten, dann die Musik und der Sakralraum der Christuskirche geben Raum, diese Anlagen zu entfalten und Gedanken zu hegen, die vielleicht in der Finsternis Nazideutschlands unentdeckt und unentwickelt geblieben wären. Wenn sich in der Schlussszene des Buchs das Gedanken- und Gefühlschaos der jungen Frau legt und Rom seine Ambivalenz verliert, als die Friedensvision alle Zweifel und Unklarheiten überstrahlt, so gab es in Margaretes Haltung zu Rom bis dahin überhaupt nur deswegen eine Ambivalenz (und nicht allein Abneigung), weil die Stadt ihr immer wieder Schönheitserlebnisse bereiten konnte. Zur Suche nach dem Schönen hat Gert sie ermuntert, und Margarete versteht es, täglich Schönes zu finden und damit „schwere, unangenehme Nebengedanken“ zurückzudrängen und vom Frieden zu träumen (98). Für diesen Erfahrungsort ist sie dankbar. Allerdings hat sich die Erfahrung des Schönen für Margarete kaum anhand der traditionellen Leitlinien römischer Kunst, Kultur und Geschichte vollzogen, die auch ihrem gebildeten Mann vorgeschwebt haben mögen, sondern – neben dem Wissen um eine privilegierte Existenz in der vor Angriffen sicheren Stadt – vornehmlich aus Natur-Erfahrungen genährt: aus der Freude am angenehmen Klima, duftenden Pflanzen, heiterem Wetter, einem frühen Frühling. Das lässt in Margarete vor allem die Erinnerung an die schönsten Seiten ihrer deutschen Existenz wach werden. Die „Natur, das Grüne im Januar“ besänftigen sie (106f.). Noch die umfassendere Erfahrung des Schönen in der Schlussszene, die deutlich Kultur- und Bildungselemente einbezieht und zur Friedensvision führt, ist angesichts des klassischen Bilds deutscher Romliebhaber eher atypisch: nicht das antike oder katholische Rom sind ihr Rahmen, sondern die lutherische Christuskirche und deutsche geistliche Musik. Letztlich bleibt auch bestehen, dass Delius mit dem Dilemma zu kämpfen hat, als Gebildeter Unbildung beschreiben zu müssen. Die Naivität Margaretes erscheint zuweilen überzeichnet und lässt sich nicht vollends in die im Buch vollzogene Bildungs- und Entwicklungsgeschichte einordnen. Andererseits wird die Gedankenwelt der Hauptfigur mit einigen der wie beiläufig eingestreuten, doch höchst scharfsinnigen Erkenntnisse auf eine Weise überfrachtet, die ein wirklich ungebildetes ‚Landmädchen‘ überfordern müsste. Solche Betrachtungen sind aber nicht weniger eindringlich und bleiben mit Gewinn zu lesen. Dazu zählt auch der kurze Abriss des christlich-philosophischen Freiheitsbegriffs (Paulus, Augustinus, Anselm), der modern-postmodernen Freiheitsvorstellungen paradox erscheinen mag, der aber von einem tiefen Vertrauen in den göttlichen Grund allen Seins getragen ist, so dass Autonomie und Theonomie zusammenfallen. Er besteht darin, „den eigenen Willen mit Gottes Willen in Übereinstimmung zu bringen und damit im Gehorsam die höchste Freiheit zu finden“ (145)[4]. Freilich kommt es in diesem ‚Gehorsam‘ darauf an, wirklich auf Gottes Willen zu hören und das – nach christlicher Auffassung – in Gott gründende, natürliche Sittengesetz zu erkennen. Andernfalls würde man in den rein passiven Fatalismus zurückfallen, dem Margarete zunächst anhängt und in dem bestimmte gesellschaftliche Gegebenheiten mit einer gottgewollten politischen Ordnung verwechselt werden. Nicht zuletzt an solchen Stellen wird die Lektüre des Buches auch für den Leser ein Bildungserlebnis von zeitloser Gültigkeit. Anmerkungen[1] Ich zitiere nach der Ausgabe vom August 2008 (Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg). [2] Freilich gründen Missverständnisse häufiger in Fehlinterpretationen als in der Absicht der Aufklärer selbst. Natürlich ist z.B. auch Kant klar, dass Erziehung Erzieher – und sogar „Zwang“ – braucht, damit aber erst wahre Freiheit ermöglicht, die ohne das „moralische Gesetz“ einerseits und die Anleitung durch andere andererseits nicht entwickelt werden kann (vgl. Kritik der praktischen Vernunft A 52f. und Über Pädagogik A32f.). Selbst Kants Ideal höchster Autonomie (Selbstgesetzgebung) steht nicht im Widerspruch zur Theonomie, sondern bleibt vereinbar mit dem Glauben an einen metaphysischen Gesetzgeber und steht späteren Formen eines metaphysischen, politischen oder moralischen Anarchismus fern. Diese unterliegen dem Missverständnis, ethische und soziale Normen grundsätzlich als Einschränkung einer spekulativen ‚wahren Freiheit‘ des Individuums zu sehen, die sie mit ungehinderter Selbstaffirmation verwechseln. Beim Menschen aber ist Geist nicht nur Funktion egoistischer Triebe, Moral Teil seiner Natur, Unmoral Unnatürlichkeit. Menschlichkeit macht authentisches Menschsein aus, da der Mensch wesentlich Gemeinschaftswesen ist, und seine Anlage zur Mit- und Fürmenschlichkeit kann sich im natürlichen (angeborenen und erworbenen, ‚gebildeten‘) Gutsein, aber auch in biologischen und sozialen Schranken, Sitten und Gesetzen ausdrücken. [3] Zu Leben und Werk des französischen Ordensgründers (Augustiner-Assumptionisten) vgl. C. Göbel: „Geist und Welt - Bildung und Philosophie. Emmanuel D’Alzon zum 200. Geburtstag“, in: Ordenskorrespondenz 51 (2010), 389-403. [4] Vgl. etwa Anselm von Canterbury, De libero arbitrio 8. Diesem Verständnis könnte übrigens auch Kant zustimmen (s.o., Anm. 2). |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/93/chg1.htm |
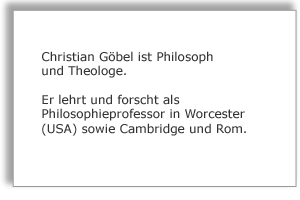 Der Beitrag versteht sich als Leseempfehlung – er schlägt eine neue Lektüre des bereits zu einem kleinen Klassiker gewordenen Buches vor – und verbindet zugleich Literaturanalyse mit philosophisch-theologischen Reflexionen zur Bildung. Berührt werden dabei pädagogische, gesellschafts- und kulturwissenschaftliche, religiöse, historische und ästhetische Themenfelder.
Der Beitrag versteht sich als Leseempfehlung – er schlägt eine neue Lektüre des bereits zu einem kleinen Klassiker gewordenen Buches vor – und verbindet zugleich Literaturanalyse mit philosophisch-theologischen Reflexionen zur Bildung. Berührt werden dabei pädagogische, gesellschafts- und kulturwissenschaftliche, religiöse, historische und ästhetische Themenfelder. 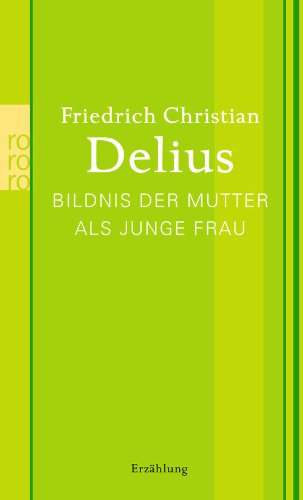 Bei einer Lesung im Goethe-Institut Rom begegnete ich im April 2013 Friedrich Christian Delius und seinem Werk „Bildnis der Mutter als junge Frau“ (2006), das als „wundervolle Erzählung“ (Süddeutsche Zeitung) und „kleines Meisterwerk“ (Die Zeit) gerühmt worden ist (u.a. Evangelischer Buchpreis 2009). Im Rahmen eines Projekts der römischen Universität Sapienza zur deutschen Gegenwartsliteratur las der Büchner-Preisträger (2011) aus dem Buch. Es beschreibt den Gang der Protagonistin, Mutter des Autors, die allein – kaum in Rom angekommen, musste ihr Mann Gert, lutherischer Pastor der deutschen Auslandsgemeinde, in den Kriegseinsatz in eine nordafrikanische Schreibstube –, ohne Kenntnis der Sprache, kaum einundzwanzig und schwanger mit ihrem ersten Kind, an einem Sonntag im Kriegsjahr 1943 von einer ‚deutschen Insel‘ zur andern durch die fremde Stadt wandert: von der Unterkunft im Diakonissenheim auf der Westseite des Tibers zum nachmittäglichen Konzert in der evangelischen Christuskirche nahe Via Veneto und Villa Borghese. Stilistische Besonderheit: ein einziger langer Satz (zumindest formal wird erst am Ende des Buchs ein Punkt gesetzt) spiegelt und beschreibt den Gedanken-Gang, d.h. die durchwanderten Örtlichkeiten wie den Bewusstseins- und Assoziationsstrom der Hauptperson.
Bei einer Lesung im Goethe-Institut Rom begegnete ich im April 2013 Friedrich Christian Delius und seinem Werk „Bildnis der Mutter als junge Frau“ (2006), das als „wundervolle Erzählung“ (Süddeutsche Zeitung) und „kleines Meisterwerk“ (Die Zeit) gerühmt worden ist (u.a. Evangelischer Buchpreis 2009). Im Rahmen eines Projekts der römischen Universität Sapienza zur deutschen Gegenwartsliteratur las der Büchner-Preisträger (2011) aus dem Buch. Es beschreibt den Gang der Protagonistin, Mutter des Autors, die allein – kaum in Rom angekommen, musste ihr Mann Gert, lutherischer Pastor der deutschen Auslandsgemeinde, in den Kriegseinsatz in eine nordafrikanische Schreibstube –, ohne Kenntnis der Sprache, kaum einundzwanzig und schwanger mit ihrem ersten Kind, an einem Sonntag im Kriegsjahr 1943 von einer ‚deutschen Insel‘ zur andern durch die fremde Stadt wandert: von der Unterkunft im Diakonissenheim auf der Westseite des Tibers zum nachmittäglichen Konzert in der evangelischen Christuskirche nahe Via Veneto und Villa Borghese. Stilistische Besonderheit: ein einziger langer Satz (zumindest formal wird erst am Ende des Buchs ein Punkt gesetzt) spiegelt und beschreibt den Gedanken-Gang, d.h. die durchwanderten Örtlichkeiten wie den Bewusstseins- und Assoziationsstrom der Hauptperson.