
Kirche und Theologie |
|
Das Klima wird rauerReligionspolitische Konfliktlagen in DeutschlandRolf Schieder
Da der religionsneutrale, säkulare Rechtsstaat sich aufgrund seiner Religionsfreiheitsgarantie ein Urteil über den Nutzen oder den Nachteil von Religionen nicht anmaßen kann, war es politisch vernünftig, dass der Deutsche Bundestag die Debatte über die Beschneidung aus religiösen Gründen gesetzlich regelte. Die Debatte ebbte daraufhin überraschend schnell ab. Die von den Beschneidungsgegnern angekündigte Protestwelle blieb aus. Die Lust an einem Kulturkampf scheint in der deutschen Bevölkerung gering zu sein. Insofern neige ich dazu, den Titel meines Vortrages mit einem Fragezeichen zu versehen: Wird das Klima wirklich rauer? Oder sind die religionspolitischen Konfliktlagen seit der Wiedervereinigung Deutschlands relativ stabil und berechenbar, die Rollen der Konfliktpartner verteilt, deren Strategien bekannt und durchschaut, so dass nur wenig religionspolitischer Handlungsbedarf besteht? Möglicherweise ist das einzige Problem, das an der religionspolitischen Front besteht, ein Bildungsproblem. Weil es immer noch Menschen gibt, die Mitbürgerinnen und Mitbürger mit anderer weltanschaulich oder religiös geprägter Lebensform für dumm, für anachronistisch, für irgendwie zurückgeblieben halten, schaukeln sich religionskulturelle Kontroversen auf. Möglicherweise spielen auch nationale Mentalitäten eine Rolle: Als englische Atheisten mit einem Bus durch London fuhren, konnte man als Aufschrift lesen: „There is probably no God. Now stop worrying and enjoy life.“ Die deutschen Atheisten, die eine ähnliche Aktion durchführten, brachten den folgenden Text an ihrem Bus an: „Es gibt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen Gott“. Daraus wurden dann unterschiedliche Konsequenzen abgeleitet: „Ein erfülltes Leben braucht keinen Glauben.“ Oder „Nur Du bist für Dein Leben verantwortlich.“ Oder: „Werte sind menschlich.“ Während die britischen Atheisten ihre Kampagne humorvoll gestalten und ihr Slogan problemlos die Variante erlaubt: „There is probably a God. Now stop worrying and enjoy life.“, glauben die deutschen Atheisten fest daran, die Wissenschaft an ihrer Seite zu haben. Allerdings können die Konsequenzen, die aus dem ersten Satz gezogen werden, den Gesetzen der Logik nicht standhalten. Denn auch dann, wenn man an Gott glaubt, kann man den Menschen auf seine Verantwortung für sein Leben ansprechen, Werte für menschlich halten und die Aufklärung grundsätzlich bejahen. Die Ursachen für ein gereiztes Klima zwischen religionslosen und religiösen Menschen in Deutschland will ich auf drei Faktoren zurückführen: Zum einen herrscht gegenwärtig keine Klarheit darüber, welchen Sachverhalt man eigentlich mit dem Begriff der „Säkularisierung“ namhaft macht – dies umso mehr, als der Begriff der „postsäkularen Gesellschaft“ neue Verwirrung gestiftet hat. Zweitens sind auch die Konturen des Religionsbegriffs unscharf geworden. Auch hier sind vermehrte Differenzierungsanstrengungen nötig. Und schließlich gibt es zunehmende Kritik an einer staatlich verordneten Zivilreligion, über die sich die Gesellschaft aufzuklären hätte. Weil die Analyse religiöser Phänomene immer auch die Kritik dieser Phänomene mit einschließt, ist dieser Essay auch ein Plädoyer für mehr Religionskritik. Kritik als die Fähigkeit zu unterscheiden und zu differenzieren ist die Voraussetzung für eine gebildete und pluralismusfähige Religionspraxis. Stimmt auch die Gegenthese: „Noch nie ging es den Religionsgemeinschaften in Deutschland so gut wie heute!“? Als regelmäßiger Leser von „Spiegel Online“ fällt mir auf, dass Religion an Ansehen gewinnt. Mit einem Papst, der sich den Namen „Franziskus“ auferlegt, werden Hoffnungen auf Reformen in der katholischen Kirche geweckt. Beeindruckend war aber auch, dass der Spiegel, der in der Vergangenheit an den großen christlichen Feiertagen in der Regel mit einer gehörigen Portion Häme auf die angeblich naturwissenschaftlich völlig unsinnigen Glaubensinhalte der Christen hinwies und diese als einen kleinen Rest bildungsresistenter und unaufgeklärter Hinterwäldler darstellte, in diesem Jahr einen Artikel aus der Feder Jakob Augsteins veröffentlichte, der so beginnt: „Man muss kein Christ sein, um die Bedeutung der Auferstehung schätzen zu lernen. Die Auferstehung ist der Sieg des utopischen Denkens! … Die Tatsachenmenschen haben abgewirtschaftet. Kapitalismus und Neoliberalismus halten keine Hoffnung bereit. Die Aufgabe der Politik wäre es, ihnen mit der Kraft der Utopie zu begegnen. Ostern, das Fest der Auferstehung, erinnert an diese Kraft.“ Die Religionsgemeinschaften als die Verbündeten gegen einen ungezähmten und zynischen Kapitalismus – diese Utopie hat eine Geschichte. Die „Social-Gospel“-Bewegung in den USA ebenso wie die sogenannten „Religiösen Sozialisten“ in Europa hegten sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts, scheiterten allerdings sowohl an den dogmatistischen Führern der sozialistischen Bewegung als auch an den bürgerlichen Kirchenführern. Auch wenn die Mehrheit der evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrer heute „Rot/Grün“ wählt, ist ein Bündnis zwischen Arbeiterschaft und Religionsgemeinschaften nicht in Sicht. Aber im Vergleich zu den religionspolitischen Kämpfen der Vergangenheit hat sich das Verhältnis zwischen den ehemaligen Weltanschauungsfeinden deutlich entspannt. Seit 1990 herrscht – von den turbulenten Jahren 1919 bis 1933 abgesehen – zum ersten Mal in der deutschen Geschichte in ganz Deutschland uneingeschränkte Religionsfreiheit. Bis 1919 waren die jeweiligen Landesherren zugleich die höchsten Bischöfe der protestantischen Landeskinder. Die protestantischen Kirchen waren Staatskirchen, die katholischen Mitbürger galten als Ultramontanisten. Die Weimarer Republik gewährte Weltanschauungs- und Religionsfreiheit, von der die Weltanschauungsgruppen und Religionsgemeinschaften aber keinen vernünftigen Gebrauch machten. Im Gegenteil: die Aufladung politischer Konflikte als Weltanschauungskonflikte war eine der Ursachen für das Scheitern der Weimarer Republik. Die Weltanschauungskämpfe zwischen Katholiken und Protestanten, aber auch zwischen Sozialisten und den christlichen Kirchen machten eine rationale und programmatische Parteipolitik unmöglich. Von entscheidender Bedeutung für die Verbesserung der religionspolitischen Lage in Deutschland war der Wandel der politischen Parteien von Weltanschauungsparteien in Volksparteien. Die CDU vollzog diesen Wandel, indem sie sich für protestantische Mitglieder öffnete und die katholische Kirche Klerikern nicht mehr erlaubte, ein politisches Mandat innezuhaben. Die SPD vollzog diesen Wandel 1959 mit dem Godesberger Programm, in dem sie ihre weltanschauliche Fundierung aufgab und sich für alle Religionen und Weltanschauungen öffnete. Sie war mit dieser Strategie außerordentlich erfolgreich: In den 90er Jahren bestand der Rat der EKD fast ausschließlich aus SPD-Mitgliedern. Auch die Grünen wählten den Weg weg von einer fundamentalistischen Gesinnungspartei hin zu einer pragmatischen, an den politischen Realitäten orientierten Partei – ebenfalls mit beträchtlichem Erfolg bei religiös engagierten Wählerinnen und Wählern. Die Partei, die bewusst den Konflikt mit den Kirchen riskierte, war die FDP, die dafür teuer bezahlte. Sie verlor ihr traditionelles liberales protestantisches Wählerpotential fast gänzlich an die SPD und die Grünen. Die von den politischen Eliten der Bundesrepublik bewusst vollzogene Pragmatisierung und Säkularisierung des Politischen sicherte den Kirchen in der alten Bundesrepublik einen enormen Einfluss. Gerade weil die Parteien bewusst auf die Pflege patriotischer und staatsbürgerlicher Gesinnungen verzichteten und sich strikt als pragmatische Wohlfahrtsstaatsparteien definierten, die nur das Vorletzte und Vorläufige organisierten, trugen sie den Kirchen die Rolle an, einen Beitrag zur Pflege von staatsbürgerlichen Werten und Überzeugungen zu leisten. Ernst-Wolfgang Böckenfördes berühmtes Diktum bringt diesen bundesrepublikanischen Konsens klassisch zum Ausdruck. Aber auch ein Blick nach Ostdeutschland zeigt, dass es den Kirchen noch nie so gut ging wie heute. So viel Religionsfreiheit gab es in dieser Region noch nie. Die Christinnen und Christen im Osten nutzen diese Freiheit: Ihre Präsenz in den Landes- und Städteparlamenten ist überdurchschnittlich hoch. Gleiches gilt für die Wahlbeteiligung. Die religiöse Bildung wird vom Staat aktiv gefördert. Religionsunterricht nach Art 7,3 GG gibt es in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern. In Sachsen und Thüringen übersteigt die Zahl der konfessionslosen Kinder, die am RU teilnehmen, oft die der konfessionell gebundenen Kinder. Noch nie sind in der deutschen Geschichte in einem so kurzen Zeitraum so viele Glocken gegossen worden wie in den letzten zwanzig Jahren. Die Glockengießerei Lauchammer gießt sein 1994 im Durchschnitt 50 Glocken pro Jahr. Im kommenden Jahr werden es also tausend Glocken sein. Grund dafür ist der hohe Bedarf ostdeutscher Kirchbaufördervereine. Diesen gehören in der Regel 25% Christen und 75% Konfessionslose an. Zwar ist der sonntägliche Kirchenbesuch schlecht, aber das Bedürfnis, eine schöne Dorfkirche zu haben, ist groß. Dem kann man entgegenhalten, dass alle verfügbaren Gottesdienstbesuchsstatistiken eine kontinuierliche Abnahme verzeichnen. Nur noch knapp 5% aller Protestanten besuchen regelmäßig den Sonntagsgottesdienst. Die Quote liegt bei katholischen Christen etwas höher. Daraus hat man lange den Schluss gezogen, dass es mit der Religion im Zuge fortschreitender Modernisierung – quasi mit geschichtsphilosophischer Notwendigkeit – bergab gehe. Dass das Ende der Religion nur noch eine Frage der Zeit sei – darin schienen sich Erich Honecker und westdeutsche Soziologen einig zu sein. Was ist Säkularisierung? Der Begriff des Säkularen ist äquivok, mithin missverständlich. Religionsferne Zeitgenossen verbinden damit gerne das geschichtsphilosophische Urteil, dass sich moderne Gesellschaften von traditionell religiösen in künftig säkulare, also religionslose, weiterentwickeln würden. Das „Säkulare“ ist für sie ein Gegenbegriff zum „Religiösen“. Für Rechts- und Politikwissenschaftler verbindet sich mit dem Begriff des Säkularen die Entlassung des Staates aus kirchlicher Dominanz und weltanschaulicher Determination. Theologen sollten – wie es Ernst-Wolfgang Böckenförde bereits 1976 angemahnt hat – „diesen Staat in seiner Weltlichkeit nicht länger als etwas Fremdes, ihrem Glauben Feindliches erkennen, sondern als die Chance der Freiheit, die zu erhalten und zu realisieren ihre Aufgabe ist.“[1] Soziologen verbinden den Begriff mit dem Prozess der Ausdifferenzierung des Gesellschaftssystems. Demzufolge konzentrieren sich die unterschiedlichen gesellschaftlichen Systeme zunehmend auf ihre eigentlichen Aufgaben. Das Religionssystem wir damit von nicht-religiösen Aufgaben entlastet. Historiker erinnern an den Prozess der „Säkularisation“, mithin der Enteignung der Kirchen durch staatliche Institutionen zu Beginn des 19. Jahrhunderts – und schließen darauf auf eine Opferposition der Kirchen im Prozess der Modernisierung. Allerdings kann gerade ein Blick auf die Modernisierungsgeschichte der USA zeigen, dass die Kirchen dort den Prozess der Modernisierung aktiv vorangetrieben haben. Würde man die Bürgerinnen und Bürger fragen, ob sie meinen, dass sie in einer „säkularen Gesellschaft“ leben, dann würde die überwiegende Mehrheit vermutlich mit „Ja!“ antworten. Und in der Tat: Hoffentlich leben wir noch lange in einer Gesellschaft mit säkularen staatlichen Institutionen. Die Selbstbeschränkung der Bundesrepublik Deutschland durch die Selbstbestimmung als „säkularer Staat“ befreite die Religionsgemeinschaften aus staatlicher Herrschaft, eröffnete der Gesellschaft Raum für religiösen und weltanschaulichen Pluralismus und garantierte individuelle und korporative Religionsfreiheit. Vom säkularen Staat profitieren alle, Religiöse wie Nichtreligiöse. Und deshalb setzen sich sowohl religiöse wie nichtreligiöse Bürgerinnen und Bürger nachdrücklich für einen säkularen Staat ein – wohl wissend dass auch „aufgeklärte“ Staaten immer in der Gefahr stehen, sich zivilreligiös zu überanstrengen. Man würde aber die für ein liberales Gemeinwesen grundlegende Unterscheidung von „Staat“ und „Gesellschaft“ übersehen, wenn man von einem „säkularen Staat“ auf eine „säkulare Gesellschaft“ schlösse. Das Gegenteil ist der Fall: Ein säkularer Staat setzt die Existenz einer nicht-säkularen Gesellschaft voraus – sonst wäre er als religionsneutraler Staat ja gar nicht nötig. Ein liberales Gemeinwesen kann per definitionem keine „säkulare Gesellschaft“ haben. Aber auch empirisch ist die Rede von einer „säkularen Gesellschaft“ nicht plausibel. Nach wie vor gibt es knapp zwei Drittel Kirchenmitglieder in Deutschland – von den vielfältigen Kooperationen und Verflechtungen zwischen Kirche und Staat ganz zu schweigen. In einer liberalen Gesellschaft gibt es stets eine Pluralität von Weltanschauungen – religiösen und nicht religiösen. Eine säkulare – mithin religionsneutrale – Gesellschaft könnte es nur geben, wenn man religiöse Weltsichten gewaltsam ausschlösse. Das haben die totalitären politischen Systeme des 20. Jahrhunderts versucht und sind damit gescheitert. Wenn es in Deutschland niemals eine „säkulare Gesellschaft“ gegeben hat, dann kann es jetzt auch keine „postsäkulare Gesellschaft“ geben. Dem Begriff kann man keine deskriptive Geltung zubilligen – durchaus aber eine programmatische. Der Begriff wurde von Jürgen Habermas in seiner Dankesrede anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche im Jahre 2001 geprägt. Habermas geht es um eine Reformulierung des Säkularisierungsbegriffs. Weder solle man ihn als Verdrängung des Religiösen aus der Öffentlichkeit noch als Verfall einer glaubenslosen Moderne deuten. Vielmehr sei im Prozess der Säkularisierung ein zivilisierender, demokratisch aufgeklärter Commonsense entstanden, der gegenüber allen Weltanschauungen, den wissenschaftlichen wie den religiösen, Äquidistanz wahre. Zugleich sei dieser Commonsense „gleichsam osmotisch nach beiden Seiten, zur Wissenschaft und zur Religion, hin geöffnet.“ Während die Wissenschaft immer nur eine Beobachterperspektive einnehmen könne, lege dieser neue Commonsense zugleich Wert auf die Wahrnehmung einer Beteiligtenperspektive. Gerade für diese Beteiligtenperspektive aber stünden die Religionen. Es komme in einer postsäkularen Gesellschaft nun darauf an, die wissenschaftliche und die religiöse Perspektive füreinander lesbar zu machen. „Eine Säkularisierung, die nicht vernichtet, vollzieht sich im Modus der Übersetzung.“ Die „säkulare Seite“ müsse sich ein „Gefühl für die Artikulationskraft religiöser Sprache“ bewahren, die „religiöse Seite“ hingegen müsse imstande sein, ihre Position nicht als unhinterfragbaren Glaubensstandpunkt, sondern als ein auf dem Forum des vernünftigen Diskurses verhandelbares Argument vorzutragen. Dieses Anliegen Habermas’ verdient Unterstützung. Seit es sie gibt, leisten etwa Theologische Fakultäten solche „Übersetzungsarbeit“ – in einem ganz elementaren Sinne als Erschließung antiker Quellen für unsere Kultur, aber auch als Ausbildungsinstitutionen und Sozialisationsinstanzen. Aber auch das an den Juristischen Fakultäten seit Jahrhunderten gelehrte Kirchenrecht, das man neuerdings Religionsverfassungsrecht nennt, garantierte immer schon, dass sich der Staat und die Religionsgemeinschaften in allen res mixtae-Fragen (Religionsunterricht, Diakonie, Anstalts- und Militärseelsorge) ihre jeweiligen Anliegen füreinander übersetzen. Man kann also Jürgen Habermas die frohe Botschaft überbringen, dass die einschlägigen Institutionen den von ihm geforderten Perspektivenwechsel schon seit geraumer Zeit praktizieren – auch wenn das seiner Aufmerksamkeit für geraume Zeit entgangen sein mag. Eine wachsende Pastoralmacht des Staates? Der französische Philosoph Michel Foucault hat eine ganz eigene Sicht auf Prozesse der Säkularisierung entwickelt. Er versteht unter Säkularisierung die Ausweitung der pastoralen Praktiken des Staates. Foucault macht dafür einen grundlegenden Politikwandel in der frühen Neuzeit verantwortlich. War die Macht des Herrschers bis dahin die Macht, den Untertanen das Leben zu nehmen, so beginnen die Regierenden im 17. Jahrhundert systematisch, das Leben der Untertanen zu verwalten und zu bewirtschaften. „Im Gegensatz zur Souveränitätsmacht, die sterben macht und leben lässt, lässt die neue Macht sterben und macht leben. Aus der Macht über den Tod wird eine Macht über das Leben, eine Bio-Macht, die es weniger mit Rechtssubjekten als mit Lebewesen zu tun hat.“[2] Der Staat der Neuzeit sieht nicht nur die Sicherung des Territoriums und die Aufrechterhaltung des Rechts als seine Aufgaben an, sondern auch die Organisation der Lebensführung seiner Untertanen. Die Pastoralmacht des Staates wird in der frühen Neuzeit institutionell und strukturell ausgebaut.[3] Dazu musste der Staat eine Institution entmachten, der bis dahin die Führung der Seelen anvertraut war: die Kirchen. Säkularisierung in Foucaults Perspektive ist also nicht die schiedlich friedliche Trennung von Kirche und Staat oder gar die Befreiung des Menschen von der finsteren Macht der Kirche. Vielmehr kopiert und nostrifiziert der Staat das, was früher kirchliche Domäne war. Der Staat selbst übernimmt die Pastoralmacht im Lande – vor allem auf dem Bildungssektor. Ein interessantes Beispiel für diese Sicht ist die Haltung des Diesterweg-Gymnasiums in Berlin-Wedding. Die dortige Schulleitung hatte einem Schüler islamischen Glaubens untersagt, während der Pause das Pflichtgebet zu verrichten. Sie begründete ihr Verbot damit, dass sich die Schule der staatlichen Neutralität in religiös-weltanschaulichen Fragen verpflichtet fühle. Hier liegt freilich ein Missverständnis von Seiten der Schulleitung vor. Denn zum einen ist die staatliche Neutralität eine grundsätzlich religionsfreundliche Neutralität, zum anderen kann das staatliche Neutralitätsgebot nicht dazu herangezogen werden, religiöse Vielfalt zu unterbinden und die Religionsfreiheit von Schülerinnen und Schülern zu unterbinden. Der Schüler zog vor Gericht. Das Verwaltungsgericht gab dem Schüler Recht. Das Oberverwaltungsgericht hingegen sah den Schulfrieden objektiv in einem so hohen Maße gefährdet, dass es der Schulleitung Recht gab. Das Bundesverwaltungsgericht schließlich betonte das Recht des Schülers auf Ausübung seiner Religionsfreiheit, die nur dann eingeschränkt werden dürfe, wenn ein konkreter Anlass bestehe, der zu der Annahme berechtige, dass ein anderes Rechtsgut von Verfassungsrang gefährdet sei. Ein solches Rechtsgut sei der Schulfrieden – dessen Gefährdung jedoch nur im jeweiligen Einzelfall festgestellt werden könne. Mit anderen Worten: ein allgemeines Gebetsverbot in einer Schulordnung ist unzulässig. Das stört die Schulleitung freilich wenig – nach wie vor untersagt sie in ihrer Schulordnung das Gebet in ihren Räumen. Klärung des Religionsbegriffs Die Frage nach der Zukunft der Religion wird man nicht auf die Frage nach der Zukunft der Kirche reduzieren dürfen. Der Religionssoziologe Thomas Luckmann hat mit seiner These einer „Unsichtbaren Religion“ eine ganze Fülle von Forschungen angeregt, die sich auf die Suche nach Religionsformen machten, die unabhängig von der in den Kirchen gepflegten Frömmigkeit praktiziert werden. Ein uns mittlerweile geläufiges Beispiel für eine außerkirchliche Religionspraxis ist die Fußballbegeisterung der Deutschen. Was in deutschen Kirchen undenkbar ist, gelingt im Fußballstadion problemlos: es wird öffentlich gebetet, innbrünstig gesungen und mutig ein Bekenntnis zum eigenen Verein abgelegt. „Schalke ist meine Religion!“ heißt es auf weiß-blauen Stolen, die sich die Fans anlässlich ihrer kultischen Begehungen am Samstagnachmittag umlegen. Fußballspieler bekreuzigen sich beim Betreten des Spielfeldes und nach erfolgreichem Torschuss. Bemerkenswert ist ein Service des Hamburger Sportvereins: Er bietet seinen Fans eine eigene Grabstätte auf dem Altonaer Friedhof an. Man betritt das Grabfeld durch ein Fußballtor. Die Toten werden mit Blick auf das Volksparkstadion bestattet. In einem Rasen, der – wie immer man sich das vorstellen soll – „Originalrasen“ vom Spielfeld des Stadions ist. Die Grabstätten können mit dem HSV-Emblem verziert werden, bei der Beerdigung werden HSV-Schlachtgesänge gespielt. Damit wird die kleine Transzendenzerfahrung des samstäglichen Kampfes der Guten gegen die Bösen um die große Transzendenz des Überganges vom Leben in den Tod ergänzt. Der Fußballverein als Kirchenersatz. Die Zukunft der Religion wird also auf jeden Fall eine solche sein, in der die Wahl des Individuums eine zentrale Rolle spielen wird. Der Soziologe Peter L. Berger hat diese Entwicklung als das Entstehen eines „häretischen Imperativs“ bezeichnet. Berger will damit eine gesellschaftliche Realität beschreiben, in der die Menschen nicht mehr in eine Tradition hineingeboren werden, die ihnen eine bestimmte Rolle zuschreibt. Sie müssen sich vielmehr ständig entscheiden und sie müssen ständig wählen – und zwar nicht nur nicht nur dies und das, sondern vor allem und zuerst sich selbst. Wer will ich sein? Der Mensch ist zur Selbstwahl befreit – und dazu gezwungen. Dieser Prozess erlegt sich vor allem den Heranwachsenden als eine gesellschaftliche Erwartung auf. Jeder muss sich selbst zum Projekt machen. Damit steigt aber das Risiko des Scheiterns ganz enorm. Angeblich hat jeder unendlich viele Wahlmöglichkeiten – und dann erweist die eigene Lebenspraxis doch als begrenzt. Die Schere zwischen dem, was man alles hätte werden und erreichen können, und dem, was man wirklich erreicht hat, wird größer und die Entwicklung von Strategien der Frustrationstoleranz werden dringlich. In der gerade von der Bundeszentrale für politische Bildung herausgegebenen Untersuchung „Wie ticken Jugendliche? 2012. Lebenswelten von Jugendlichen im Alter von 14-17 Jahren in Deutschland“ wird dieser Befund noch einmal unterstrichen. Dort heißt es: „Das Bedürfnis nach Sinnfindung ist allgegenwärtig. Sinn wird dabei v.a. im persönlichen Glauben gefunden, der für viele Jugendliche nicht zwingend über Religion bzw. Kirche vermittelt sein muss. … Glaube wird als etwas Veränderbares und Individuelles, das man mit sich selbst ausmacht … verstanden.“ (77). Gleichzeitig wird aber der Druck, etwas aus seinem Leben machen zu müssen, größer: „Es herrscht bei vielen Jugendlichen Unsicherheit darüber, ob das eigene Leistungsvermögen für ein Leben in sicheren Bahnen ausreicht. Die große Frage, die sich die Jugendlichen … stellen, … lautet: Was wird aus mir und wann werde ich es? … Jugendliche gehen davon aus, dass sie die Antwort weitgehend allein finden müssen.“ (41) Dementsprechend groß ist das Bedürfnis der Jugendlichen nach einem stabilen sozialen Umfeld: die Familie und gute Freunde stehen auf der Werteskala der Jugendlichen ganz weit oben. Prozesse der Individualisierung zwingen zur Selbstverwirklichung mit unklarem Ausgang. Der Imperativ: „Werde, der Du bist!“ ist paradox und führt zum Kauf von enormen Mengen an Ratgeberliteratur, die einem dabei helfen soll, sich selbst zu finden. Wenn Ulrich Beck darin recht hat, dass die Zukunft der Religion darin bestehe, dass jeder sein „eigener Gott“ sei, dann kann das ambivalente Konsequenzen nach sich ziehen. Denn als unser eigener Gott begegnen wir uns auch als unser eigener Richter: Jeden Morgen beim Blick in den Spiegel vollziehen wir an uns das Jüngste Gericht. Täglich müssen wir uns neu bewähren. Gottseidank gibt es dafür gesellschaftliche Unterstützung: Reinheitsvorschriften für Speisen erfüllen wir, indem wir nur noch Bioprodukte kaufen („Bio ist das neue Kosher!“). Im Fitnesstudio vollziehen wir unsere wöchentlichen Exerzitien. Dem Coach beichten wir das Verfehlen unserer Ziele. Die Rechtfertigungspflicht nach innen und nach außen steigt. Es müsste also in einer „Religion des eigenen Selbst“ so etwas wie eine Differenz zwischen der Unergründlichkeit des eigenen Selbst und der uns erschlossenen Vorfindlichkeit geben – verbunden mit der Verheißung, dass wir uns in allem, was auch geschieht, selbst wieder finden können. Man kann diesen Individualisierungsschub in der Theologie selbst finden. Wer Friedrich Daniel Ernst Schleiermachers „Reden über die Religion an die Gebildeten unter ihren Verächtern“ aus dem Jahre 1799 liest, der wird dort alle Motive einer höchst individuellen „Anschauung des Universums“ durch das „fromme Individuum“ finden, das erfahrungsoffen und kunstsinnig in allem Endlichen das Unendliche aufspüren kann. Das Individuum ist Letztgrund religiöser Überzeugungen – freilich immer im Bewusstsein, sich selbst nicht selbst erschließen, sondern sich immer nur als schon erschlossen vorzufinden. Auch die irritierend neue Sichtbarkeit von Religion kann als Ausdruck der Individualisierung der Religion gelesen werden. Denn wenn sich die Gesellschaft darauf verständigt hat, dass jeder das Recht auf seinen eigenen Glauben hat, dann dient es der eigenen Identitätssteigerung, wenn man an etwas glaubt, woran andere gerade nicht glauben. Vor allem jungen Migrantinnen und Migranten bietet das deutsche Religionssystem viele Möglichkeiten der Selbstexpression. Religion wird zum Identitätsmarker. Es war Émile Durkheim, der ein unsoziologisches Verständnis von Individualisierung zurückwies. In seinem Essay „L’individualisme et les Intellectuels“ in der Revue Bleue des Jahres 1898 (7-13) schreibt er: „Nicht nur ist der Individualismus nicht Anarchie, sondern er ist künftig das einzige Glaubenssystem, das die moralische Einheit des Landes sichern kann.“ (10) Der „culte de l’individu“ sei die Religion der Zukunft. Der Glaube an die Menschenrechte werde zum moralischen Kern der Gesellschaft. Dieser Kern sei aber nicht einfach gegeben. Jede Gesellschaft müsse das, woran sie zutiefst glaube, von Generation zu Generation weitergeben. Dieser Individualismus stehe mit dem Christentum keineswegs im Konflikt. Im Gegenteil: dieses habe mit dem Gedanken der Gottunmittelbarkeit des Individuums den Boden für den modernen Kult des Individuums bereitet. Der sowohl von Klerikern wie von Marxisten bekämpfte Individualismus sei, so Durkheim, gerade kein Produkt egoistischer Launen oder eine kapitalistische Erfindung, er sei vielmehr jener Glaube, der die moderne Gesellschaft noch integrieren könne. Man müsse sich aber immer vergegenwärtigen: „In Wirklichkeit ist die Religion des Individuums eine soziale Einrichtung wie alle bekannten Religionen“(12). Es gibt eine ganze Reihe von Anhaltspunkten, die für die These Durkheims sprechen, dass die Religion des Individuums zum Glaubenskern moderner Gesellschaften geworden ist. Hans Joas spricht in seiner jüngsten Veröffentlichung von der „Sakralität der Person“, die als zivilreligiöser Kern des Menschenrechtsgedankens zu gelten habe. Aber auch die in den vergangenen Monaten mit Leidenschaft geführte Debatte über das Kölner Beschneidungsurteil kann man als eine zivilreligiöse Debatte über Menschenrechte als Kinderrechte deuten. Während die Vertreter eines Beschneidungsverbotes das Menschenrecht des Kindes auf körperliche Unversehrtheit schützen wollten, so sahen die Befürworter einer Straffreiheit der Beschneidung das Menschenrecht auf Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft in Gefahr. Aber Gegner wie Befürworter waren sich darin einig, dass das Kindeswohl Entscheidungskriterium sein müsse. Dass es sich dabei um mehr handelte, als um einen Rechtsstreit und das professionelle Abwägen von Rechtfertigungsgründen, zeigt die Leidenschaft, mit der debattiert wurde. Kollektive Erregung erscheint mir immer ein Hinweis auf Debatten über das Profil zentraler zivilreligiöser Dogmen zu sein. Dann geht es aber auch nicht um einen Konflikt zwischen „Säkularität“ und „Religiosität“, vielmehr arbeiten sich beide Seiten an ihren tiefsten Überzeugungen ab. Die Zukunft der Kirchen in Deutschland Die Kirchen in Deutschland sind von enormen Mitgliederverlusten bedroht. Die römisch-katholische Kirche hat zwischen 1990 und heute mehr als 3,5 Millionen Mitglieder verloren, die in der EKD organisierten evangelischen Kirchen mehr als 5 Millionen Mitglieder. Allerdings übersteigt die Zahl der Sterbefälle die Zahl der Austritte um das Doppelte. Die Zahl der Taufen und der Wiedereintritte übertrifft die Zahl der Austritte um etwa ein Drittel. So standen zwischen 1991 und 2008 in der EKD 5,2 Millionen Taufen 3,7 Millionen Kirchenaustritten gegenüber und in der römisch-katholischen Kirche 4,4 Millionen Taufen 2,3 Millionen Austritten. Das demographische Problem der Überalterung ist also drängender als das Austrittsproblem. Trotzdem verlassen jährlich durchschnittlich 250.000 Menschen die beiden Kirchen. Zurzeit gehören noch 60 Prozent der Deutschen einer der beiden großen Kirchen an. Die Quote wird in den nächsten 20 Jahren auf 50 Prozent gesunken sein wird. Das muss den Kirchen zu denken geben – sie können sich aber auch mit folgender Zahl trösten: Zurzeit gehören 1,9 Prozent der Deutschen einer der im Bundestag vertretenen Parteien an. Welche Austrittsmotive sind festzustellen? Die Bedeutung finanzieller Erwägungen zeigt sich nicht nur an erhöhten Austrittszahlen bei Änderungen der Einkommenssteuergesetzgebung, sie zeigt sich auch daran, dass vor allem Berufsanfänger im Alter zwischen 25 und 35 Jahren zum Kirchenaustritt neigen. In den ersten 5 Berufsjahren ist das Kirchenaustrittsrisiko sechsmal höher als im späteren Berufsleben. In den letzten Jahren hat die Unzufriedenheit mit der Institution oder einzelnen Amtsträgern als Austrittsgrund an Bedeutung zugenommen. Spannend ist auch, dass der Verlust des Glaubens an Gott nur für jeden Fünften eine Rolle beim Kirchenaustritt spielt. Und nur 2 Prozent nennen den Glauben an andere Götter als Motiv. Der Trend geht hin zum „believing without belonging.“ Viele sind davon überzeugt, dass sie auch ohne Kirche gute Christen sein können. Langfristige Bindungen erscheinen nicht mehr zeitgemäß. Finanzielle Verluste erleiden die Kirchen in der BRD durch die Austritte allerdings noch nicht. Das Kirchensteuereinkommen der beiden großen Kirchen lag im Jahr 2001 bei 8,5 Mrd. €. Im Jahr 2010 lag es bei 9,2 Mrd. €. Die Kirchensteuereinnahmen sind also trotz der Austritte und der hohen Sterberate gestiegen. Auch das Staat-Kirche-Verhältnis ist trotz der Schrumpfung der Mitgliederzahlen stabil. Selbst in Ostdeutschland, wo nur noch 20 Prozent aller Bewohner einer Kirche angehören, ist der konfessionelle Religionsunterricht – mit Ausnahme von Brandenburg – ordentliches, staatlich finanziertes Unterrichtsfach. Vergleicht man übrigens das politische Engagement im Osten mit der Kirchenzugehörigkeit, dann fällt auf, dass Kirchenmitglieder überdurchschnittlich hoch in den Parlamenten vertreten sind. Auch von einer Erosion des Repräsentationspotentials des Protestantismus kann angesichts eines Bundespräsidenten, der früher protestantischer Pfarrer in Rostock war, und einer Bundeskanzlerin, die Pfarrerstochter aus dem Osten ist, kaum gesprochen werden. Die Rolle der Kirchen im Bereich von Bildung und Diakonie ist nach wie vor bedeutend. Der Zulauf zu kirchlichen Privatschulen in und um Berlin beispielsweise ist enorm. Aber auch die Theologischen Fakultäten und der konfessionelle Religionsunterricht erfreuen sich stabiler Zustimmung. Globalisierungsfolgen sind auch auf religiösem Gebiet festzustellen. Seit 1990 sind in Berlin 120 Migrantenkirchen entstanden: 40 asiatische und 80 afrikanische. Der Regierende Bürgermeister von Berlin, der sich früher gegen die Bezeichnung Berlin als „Hauptstadt des Atheismus“ nicht gewehrt hat, bezeichnet Berlin inzwischen stolz als die Metropole Europas mit der größten religiösen Vielfalt. Das kann man bezweifeln, es sagt aber etwas über den Wandel der Wahrnehmung des Religionssystems durch das Politische aus. Die Anerkennung religiöser Vielfalt wird als politische Herausforderung gesehen und grosso modo auch gefördert. Zivilreligion – der Elephant im Wohnzimmer der Deutschen? Die Frage, ob es sinnvoll ist, das Konzept der Zivilreligion in funktional-ausdifferenzierte Gesellschaften zu benutzen, ist umstritten. Dafür spricht, dass auch das politische System zumindest bei bestimmten Anlässen religiöser Sprache und religiöser Rituale bedarf. Die Gottesbezüge in den Verfassungen sind uns bekannt. Die Pflicht zur Erziehung zur Ehrfurcht vor Gott in den Schulartikeln von Baden-Württemberg, NRW und Bayern erstreckt sich auf alle Lehrkräfte, auch diejenigen, die keiner Kirche angehören. Als sich eine muslimische niedersächsische Ministerin dazu entschloss, ihren Amtseid mit der Bekräftigungsformel „So wahr mir Gott helfe!“ zu leisten, gab es nur für kurze Zeit einen leisen Protest von kirchlicher Seite, dass der Verfassungsgott doch ein christlicher Gott sei. Das ist er nämlich gerade nicht. Er ist auch ein christlicher Gott, aber auch der Gott der Juden, der Muslime und anderer gottgläubiger Bürgerinnen und Bürger. Zivilreligionsbedarf entsteht aber auch immer dann wenn die Särge junger deutscher Soldaten aus Afghanistan und anderen Krisengebieten in Deutschland ankommen und dann in einer Trauerfeier Abschied genommen werden muss. Bisher werden die Kirchen um Beistand bei diesem zivilreligiösen Ritual gebeten. Allerdings muss dann doch ein Volksvertreter den Hinterbliebenen erklären, warum dieser junge Mensch so früh sterben musste und wofür er sein Leben geopfert hat. Den kirchlichen Rahmen nehmen die staatlichen Stellen aber immer noch gerne in Anspruch. Anders als in den USA hat sich im Nachkriegsdeutschland aber kein affirmatives zivilreligiöses Narrativ entwickelt. Allerdings scheinen die Erinnerung an die Shoah und die daraus abgeleiteten Verpflichtungen für das Selbstverständnis Deutschlands schlechterdings fundamental zu sein. Martin Walsers Versuch in der Paulskirche 1998, sich der zivilreligiösen Zumutung durch den Vorwurf der Instrumentalisierung, des Einsatzes von Moralkeulen und der lippengebetshaften Ritualisierung zu erwehren, wurde streng sanktioniert und als Tabubruch, als Bedrohung eines zivilreligiösen Konsenses empfunden. Ein anderer öffentlicher Konflikt, bei dem die Erinnerung der Shoah als zivilreligiöse Forderung im Mittelpunkt stand, war der Streit um den Anruf der Kanzlerin Angela Merkel beim Oberhaupt der Katholischen Kirche, Benedikt XVI. im Zusammenhang der Aufhebung der Exkommunikation des Shoah-Leugners William Richardson. Nicht wenige deutsche Katholiken fühlten sich an alte Kulturkampfzeiten erinnert. Die öffentliche Erregung lässt sich aber mit antikatholischen Ressentiments nicht hinreichend erklären. Nicht die ostdeutsche protestantische Pfarrerstochter Angela Merkel kritisierte den bayerischen Katholiken Joseph Ratzinger. Vielmehr sah die Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland ein zentrales zivilreligiöses Dogma in Gefahr – dessen Verletzung mittlerweile ein Straftatbestand ist. Wie die amerikanische Zivilreligion von allen Konfessionen erwartet, dass deren Repräsentanten imstande sind, „God bless America“ zu sagen, so erwartet die deutsche Zivilreligion von allen Konfessionen, dass sie die Verpflichtung aus der Shoah ernst nehmen. Während der mexikanische Kardinal Barragán die Äußerungen Williamsons lediglich für eine Dummheit hielt und die ganze Aufregung in Deutschland nicht verstand, erkannten die deutschen Bischöfe die Dimension des Problems und erklärten eine Kirchengemeinschaft mit Leugnern der Shoah für inakzeptabel. Allerdings haben die Ereignisse des letzten Wochen und Monate gezeigt, dass Martin Walser mit seiner Paulskirchenrede in einer Hinsicht recht hatte: wer die Erinnerung der Shoah zur Zivilreligion macht, der zahlt dafür einen Preis. Denn wie in jeder Religion werden auch die zivilreligiösen Dogmen von verschiedenen Menschen unterschiedlich interpretiert – und sie werden nicht von allen geteilt. Walser artikulierte ein Unbehagen, das mittlerweile so stark um sich gegriffen hat, dass man geradezu von einem „elephant in the livingroom“, von einem Elephanten im Wohnzimmer, sprechen kann. Mit dieser Metapher soll eine Situation bezeichnet werden, in der ein Problem mittlerweile so groß geworden ist, so wenig handhabbar, dass man darüber nicht mehr sinnvoll miteinander kommunizieren kann. Letzter Höhepunkt waren die Antisemitismusvorwürfe gegen Jakob Augstein. Es wäre an der Zeit, den Begriff des Antisemitismus einfach nicht mehr zu verwenden. Nicht nur, weil er sachlich irreführend ist, sondern vor allem deshalb, weil sich der Inkriminierte wie ein Ketzer, aber auch die Inkriminierenden wie die mittelalterliche Inquisition vorkommen müssen. Die Debatte kommt für uns Deutsche insofern überraschend, als wir doch nun in wahrhaft vorbildlicher Weise die Erinnerung der ermordeten Juden organisieren. Wir geben sogar viel Geld dafür aus, dass junge Deutsche mit türkischem Migrationshintergrund in die Erinnerungsgemeinschaft integriert werden. Was nicht so einfach ist, weil junge Türkinnen und Türken sich ja ganz zu Recht fragen, was der Faschismus denn mit ihnen zu tun hat. Wer das kürzlich erschienene Buch von Tuvia Tenenbom „Allein unter Deutschen“ gelesen hat, dem wird klar, dass wir Deutschen uns über das zivilreligiöse Dogma der bleibenden Verantwortung für die Shoah neu verständigen müssen. Denn offenbar hat das zu einer „Obsession mit den Juden“, wie Tenenbom es nennt, geführt, die höchst problematisch ist. Die zivilreligiös orthodoxe Erinnerung der toten Juden führt zu Anpassungsproblemen im Umgang mit lebenden Juden. Aber bereits beim Versuch, dieses Thema öffentlich zu thematisieren, spürt man die Wellen der Erregung auf sich zukommen. Die Shoah ist mit so viel Transzendenz aufgeladen worden, dass es uns schwer fällt mit ihr als einem weltimmanenten Geschehen umzugehen und ihr etwas von ihrer sakralen Aura zu nehmen. In den Kirchen steht für solche religionskritischen Operationen die Theologie bereit. Die Theologie besitzt das Privileg zu historischer Kritik. Dogmen werden konsequent in ihre historischen Kontexte eingeordnet, heilige Texte mit allen verfügbaren Methoden der Literarkritik dekonstruiert. Eine Zivilreligion, die sich nicht zum unkontrollierbaren Dampfkessel entwickeln soll, benötigt ebenfalls Zivilreligionskritik. Es scheint mir einen Aufgabe einflussreicher öffentlicher Intellektueller zu sein, in die Rolle von Ziviltheologen zu schlüpfen und die anstrengenden Auseinandersetzungen neu zu rahmen. So bin ich am Ende meines Vortrages über das aktuelle religionspolitische Klima bei der Religionskritik gelandet. Als Theologe plädiere ich nachdrücklich für die Kritik der Religion – freilich nicht, um Religion zum Verschwinden zu bringen, sondern in der Absicht, ihr zu helfen, eine dem Wohl der Menschen dienende Rolle zu spielen. Die Zivilisierung der Religionen durch Bildung ist ein bleibender Auftrag. Anmerkungen
[1] Ernst Wolfang Böckenförde: Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation. In: Ders.: Recht, Staat, Freiheit, Frankfurt am Main 1976, 42-64, 61. [2] Thomas Lemke: Eine Kritik der politischen Vernunft. Foucaults Analyse der modernen Gouvernementalität. Berlin 1997, 135. [3] Ganz auf der Linie der Perspektive Foucaults hat Alexis de Tocqueville diesen Prozess zu Beginn des 19. Jahrhunderts so beschrieben: „Ich scheue mich auch nicht zu behaupten, dass in fast allen christlichen Völkern der Gegenwart (…) die Religion in die Hände der Regierung zu fallen droht. Nicht dass die Herrscher sehr darauf erpicht wären, selber das Dogma festzulegen; sie bemächtigen sich aber mehr und mehr des Willens dessen, der es erläutert: sie (…) brauchen den Einfluss, den der Priester besitzt, zu ihrem alleinigen Vorteil; sie machen aus ihm einen ihrer Beamten und oft einen ihrer Diener und dringen mit ihm ins tiefste Seeleninnere jedes Menschen ein.“ Zitiert nach Lemke, A.a.O., 151. |
|
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/90/rs1.htm
|
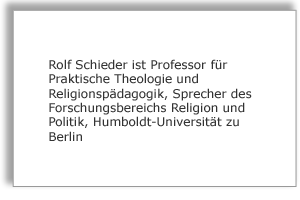 Als die öffentliche Debatte über das von den betroffenen religiösen Minderheiten als skandalös empfundene Urteil des Kölner Landgerichts ihrem Höhepunkt zustrebte, schien es so, als stünden sich religiöse und religionskritische Bürgerinnen und Bürger in einer bisher ungekannten Unversöhnlichkeit gegenüber. Der Streit darüber, wer denn nun die Deutungsmacht über das religiöse Ritual der Beschneidung besitze, wurde zunehmend unübersichtlich und verworren. Legitim seien nur Beschneidungen aus medizinischen Gründen, meinten die Kinderärzte – auf die Religionsfreiheit beriefen sich die Juden und die Muslime. Der Begriff des Kindeswohls kristallisierte sich als ein Standard heraus, an dem das Handeln von Eltern gemessen werden müsse. Damit war man allerdings wieder bei der Frage angelangt, die von Beginn an die Debatte bestimmte: Ist Religion gut für Mensch und Gesellschaft oder muss sie für unzuträglich gehalten werden?
Als die öffentliche Debatte über das von den betroffenen religiösen Minderheiten als skandalös empfundene Urteil des Kölner Landgerichts ihrem Höhepunkt zustrebte, schien es so, als stünden sich religiöse und religionskritische Bürgerinnen und Bürger in einer bisher ungekannten Unversöhnlichkeit gegenüber. Der Streit darüber, wer denn nun die Deutungsmacht über das religiöse Ritual der Beschneidung besitze, wurde zunehmend unübersichtlich und verworren. Legitim seien nur Beschneidungen aus medizinischen Gründen, meinten die Kinderärzte – auf die Religionsfreiheit beriefen sich die Juden und die Muslime. Der Begriff des Kindeswohls kristallisierte sich als ein Standard heraus, an dem das Handeln von Eltern gemessen werden müsse. Damit war man allerdings wieder bei der Frage angelangt, die von Beginn an die Debatte bestimmte: Ist Religion gut für Mensch und Gesellschaft oder muss sie für unzuträglich gehalten werden?