„Es lächelt der See, er ladet zum Bade“
Tagebuch einer Luzern-Reise
Hans Jürgen Benedict
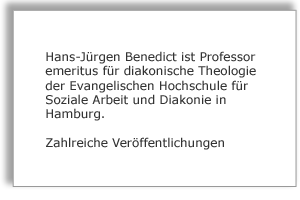 Ein guter Freund hat mir angeboten, in seiner Luzerner Wohnung Urlaub zu machen. Er sei einen Monat weg, der Garten müsse gegossen, der Briefkasten geleert werden. Sonst könne ich alles benutzen, auch seine Bibliothek natürlich. Ich frage meine Partnerin, ob sie mitkommen will. Sie will. Also Aufbruch morgens um 6.30 in Köln mit ihrem alten Polo, vollgeladen mit Wein, Wasser, Bier und haltbaren Lebensmitteln, denn die Schweiz ist ein teures Land für Eurotouristen. Deswegen vorher zu Aldi! Ein guter Freund hat mir angeboten, in seiner Luzerner Wohnung Urlaub zu machen. Er sei einen Monat weg, der Garten müsse gegossen, der Briefkasten geleert werden. Sonst könne ich alles benutzen, auch seine Bibliothek natürlich. Ich frage meine Partnerin, ob sie mitkommen will. Sie will. Also Aufbruch morgens um 6.30 in Köln mit ihrem alten Polo, vollgeladen mit Wein, Wasser, Bier und haltbaren Lebensmitteln, denn die Schweiz ist ein teures Land für Eurotouristen. Deswegen vorher zu Aldi!
Prolog in Strassburg – ein milder Weltenrichter
Da auf der Autobahn Karlsruhe mit Staus zu rechnen ist, fahren wir die parallele A 5 im Elsass, vorbei an Sesenheim („Es schlug mein Herz, geschwind zu Pferde, es war getan fast getan gedacht ...“ Goethes nächtlicher Ritt zur Pfarrerstochter Friederike, immerhin an die 50 km) und mit der Ankündigung von Straßburg. Kurz entschlossen biegen wir Strassburg-Centre ab, gerade als sich vor uns ein Stau aufbaut und kommen ohne Behinderung schnell ins Zentrum, finden einen Parkplatz und nähern uns erwartungsvoll dem Münster. Zuletzt habe ich es vor 40 Jahren gesehen. Die Erinnerungen sind schwach, an die Uhr erinnere ich mich und an die Skulpturen von Ekklesia und Synagoge am südlichen Querhausportal. Gegenwärtig ist mir auch noch Goethes schwungvolles Lob des Baumeisters Erwin von Steinbach, der aber nur einer von vielen zumeist unbekannten Baumeistern war. Ob wohl der französische Einfluss an diesem Inbegriff deutscher Gotik deutlich erkennbar war, plädierte er für eine deutsche Kunst. Viele haben an dieser Kathedrale über 4 Jahrhunderte mitgebaut, sie ist eigentlich ein französisch-deutsches Koprojekt lange vor dem Freundschaftspakt. Von der Romanik, die den Chor bestimmt und das südliche Querhaus über die Hochgotik des Langhauses bis zur Spätgotik der Laurentiuskapelle mit ihrem schönen Portal und dem Turm. Überwältigend der Eindruck der Westfassade mit ihren himmelstrebenden Bögen und Fialen, die dem Mauerwerk vorgebaut sind und eine Vertikalisierung der Fassade erzeugen, die einmalig ist. Himmelsstürmend, allerdings nur bis zum ersten Stock. Reich das Bildprogramm an den Portalen. Das südliche Portal stellt das Gleichnis der klugen und törichten Jungfrauen dar, mit einem Interpretament bei den Törichten, das sonst nicht vorkommt. Während rechts ein ernster Christus die klugen Jungfrauen empfängt, die genug Öl haben, sind links die törichten dargestellt, deren eine sich wohlgemut einem gut aussehenden lächelnden Verführer als dem „Fürsten dieser Welt“ mit einem Apfel in der rechten Hand zuwendet. Dessen Rückseite enthüllt sein wahres Wesen – Schlangen und Kriechgetier als Zeichen seiner satanischen Provenienz – diese Paar hat den Sündenfall zum Subtext. Im Giebelfeld wird das dazugehörige Jüngste Gericht dargestellt. Im Bogenfeld des Hauptportals läuft das Drama Leidensgeschichte Jesu ab…
Es ist vieles zu berichten aus dem Innern des Münsters – sei es die Kanzel von Hans Hammer, angefertigt für den bekannten Bußprediger Gailer von Kaysersberg, der bereits vor der Reformation die Schwächen der Kirche anprangerte. Auch sein Hündchen ist dargestellt, das während der langen Predigten seines Herrn geduldig ausharrte. Erinnert ein wenig an das Hündchen der Siebenschläfer, das mit eingemauert wurde und nach moslemischer Lesart deswegen auch ins Paradies kommt. Wir bewundern die spätmittelalterliche Orgel, von Silbermann erneuert und ihre gotische Empore, getragen von dem starken Simson, der den Löwen tötet. Die Engelssäule schließlich im südlichen Querhaus, die einen milden Christus als Weltenrichter zeigt. Die unter ihm Auferstehenden grüßt er zart mit der linken Hand, während die Rechte lässig in die Seite gestemmt ist. Er hat den Kopf nach links gewendet, blickt eher uns die Betrachter an. Es gibt weder Auserwählte noch Verdammte, keine Scheidung zwischen Böcken und Schafen also, das ist ikonographisch einmalig. Auf einem Fenster im südlichen Langhaus wird ebenfalls das Jüngste Gericht dargestellt – hier gibt es, ordentlich aufgeteilt, zwei Drittel Erwählte und nur ein Drittel Verdammte. Das ist auch für uns „kleine Sünderlein“, wie man in Köln sagt, eine frohe Botschaft. Im nördlichen Querhaus ein siebenseitiges Taufbecken und eine dramatische Gethsemane-Szene mit den schlafenden Jüngern und dem mit einem schweigenden Gott ringenden Christus, während hinter dem Zaun schon die von Judas angeführten Soldaten aufmarschieren. Diese Szene, die das Menschliche an Christus, seine Angst vor dem Sterben, betont, findet sich häufiger im süddeutschen Raum. Prominent im Norden nur das Altarbild der Dresdener Frauenkirche. Der romanische Chor ist nicht zu besichtigen. Weiterfahrt nach Stärkung mit Flammkuchen auf dem Gutenbergplatz, obwohl ich gerne noch geblieben wäre.
Am frühen Abend sind wir in Luzern. Fulberts und Lis schöne geräumig-komfortable Wohnung mit großen Fensterfronten, natürlich vielen Büchern, einer Terrasse und einem vielfältig naturnah bepflanzten Garten in der Wemselinstraße empfängt uns freundlich. Eine nette Nachbarin händigt den Schlüssel aus und weist den Weg in die Garage. Man kann sogar die Spitze des Pilatus sehen

Am nächsten Tag ein erstes Bad im See, abends sitzen wir in einem Restaurant am rauschenden Wehr der Reuss. Ein. älteres Ehepaar aus Glasgow am Nebentisch. Wir sprechen über den Krieg und die Bombenangriffe auf Hamburg, an die gerade zum 70. Jahrestag der Operation Gomorrha gedacht wurde. Aber wie konntet ihr bloß auf diesen Hitler reinfallen!, sagte der Mann. Ich muss ihm rechtgeben und lobe dann Churchill mit seinem entschiedenen Widerstand gegen Hitler. Auch mit seiner Bereitschaft zu einem Neuanfang nach dem Krieg, seine Zürcher Rede vom September 1946, in der er für einen Akt des Vergessens aller Verbrechen plädierte, auf den das neue Europa aufgebaut werden müsse. Das hat dann ja auch geklappt, vor allem in der deutsch-französischen Freundschaft, etwas weniger in der mit den Engländern, deren Boulevardpresse uns gerne noch als Hunnen tituliert, auch mit den Polen nach Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze (mit der mutigen Ostdenkschrift der EKD) und Russen, die besonders schlimm unter den Wehrmachtsverbrechen zu leiden hatten. Nur: dieses produktive Vergessen konnte nicht für den Völkermord Nazideutschlands an den Juden gelten. Deswegen nach einer Phase des Beschweigens die Auschwitz-Erinnerungskultur. Ich erwähne das, weil ich gerade etwas über Erinnern, Vergessen, Versöhnen geschrieben habe.
Auf die Rigi mit dem Tell-Pass
 Am nächsten Tag Ausflug auf den Berg, der die Rigi heißt und nach Ansicht unserer Gastgeber ein Muss ist. In Goldau kaufen wir uns einen Tell-Pass (2 Tage Freifahrt, 5 Tage Halbtax), weil allein die Rundfahrt auf der Rigi 66 CHF kostet. Also mit der Zahnradbahn auf den Rigi-Kulm, den Klassiker unter den Wanderbergen bei Luzern, der viele berühmte Besucher zu verzeichnen hat, darunter Mark Twain, der darüber in seinem Reisetagebuch köstlich berichtet. Wunderbar der Rundblick vom Gipfel über die Seen, unter uns direkt der Zuger See, zur andern Seite auf die Hochalpen bis zu Jungfrau und Matterhorn. Bei klarer Sicht könnte man bis nach Freiburg, ja Straßburg blicken. Ein älterer Musikant bläst das wehmütige Alphorn, wie sagt doch der Schweizer Deserteur in Des Knaben Wunderhorn: „Zu Strasburg auf der Schanz, da ging mein Trauern an. Das Alphorn hört ich drüben wohl anstimmen, ins Vaterland musst ich hinüberschwimmen. Das ging ja nicht an.“ Er hört das Alphorn und wird von Heimweh gepackt, schwimmt durch den Rhein, wird aufgegriffen, zum Tode verurteilt und zur Hinrichtung abgeführt. Das Lied, das Mahler vertont hat, sind seine letzten Gedanken und Worte. Stockend ist der Gang der Musik. Illusionslos spricht der zum Tode verurteilte Schweizer: „Ich soll bitten um Pardon und ich bekomm doch meinen Lohn, das weiß ich schon.“ Noch einmal erklärt er seinen Beweggrund in einer sehnenden musikalischen Bewegung: „Der Hirtenbub ist schuld daran; das Alphorn hat mir’s angetan, das klag ich an.“ Ach ja, so einfach waren und sind die Gründe damals und heute. Das Schicksal tausender Desertierter, die im 2.Weltkrieg von grausamen leidunempfindlichen Militärrichtern abgeurteilt und erst vor kurzem vom Bundestag rehabilitiert wurden (die CDU war stets dagegen), kommt mir in den Sinn, wenn ich dies wehmütige Mahlerlied höre. Am nächsten Tag Ausflug auf den Berg, der die Rigi heißt und nach Ansicht unserer Gastgeber ein Muss ist. In Goldau kaufen wir uns einen Tell-Pass (2 Tage Freifahrt, 5 Tage Halbtax), weil allein die Rundfahrt auf der Rigi 66 CHF kostet. Also mit der Zahnradbahn auf den Rigi-Kulm, den Klassiker unter den Wanderbergen bei Luzern, der viele berühmte Besucher zu verzeichnen hat, darunter Mark Twain, der darüber in seinem Reisetagebuch köstlich berichtet. Wunderbar der Rundblick vom Gipfel über die Seen, unter uns direkt der Zuger See, zur andern Seite auf die Hochalpen bis zu Jungfrau und Matterhorn. Bei klarer Sicht könnte man bis nach Freiburg, ja Straßburg blicken. Ein älterer Musikant bläst das wehmütige Alphorn, wie sagt doch der Schweizer Deserteur in Des Knaben Wunderhorn: „Zu Strasburg auf der Schanz, da ging mein Trauern an. Das Alphorn hört ich drüben wohl anstimmen, ins Vaterland musst ich hinüberschwimmen. Das ging ja nicht an.“ Er hört das Alphorn und wird von Heimweh gepackt, schwimmt durch den Rhein, wird aufgegriffen, zum Tode verurteilt und zur Hinrichtung abgeführt. Das Lied, das Mahler vertont hat, sind seine letzten Gedanken und Worte. Stockend ist der Gang der Musik. Illusionslos spricht der zum Tode verurteilte Schweizer: „Ich soll bitten um Pardon und ich bekomm doch meinen Lohn, das weiß ich schon.“ Noch einmal erklärt er seinen Beweggrund in einer sehnenden musikalischen Bewegung: „Der Hirtenbub ist schuld daran; das Alphorn hat mir’s angetan, das klag ich an.“ Ach ja, so einfach waren und sind die Gründe damals und heute. Das Schicksal tausender Desertierter, die im 2.Weltkrieg von grausamen leidunempfindlichen Militärrichtern abgeurteilt und erst vor kurzem vom Bundestag rehabilitiert wurden (die CDU war stets dagegen), kommt mir in den Sinn, wenn ich dies wehmütige Mahlerlied höre.
Es ist brütend heiß, gibt wenig Schatten. Im Bahnhofsrestaurant Rigi-Staffel essen wir eine Kalbsbratwurst mit Zwiebelsauce für 9,80 CHF, es wird die teuerste Bratwurst meines Lebens (dafür bekomme ich in Hamburg auf der Mönckebergstrasse 3 Bratwürste). Überall die durchaus differenzierten Kuhglocken-Konzerte der auf den Steilwiesen grasenden Tiere - wie schön Mahler diese Glocken in seiner 6.Sinfonie integriert hat!
In First kommen wir auf einen Blumen- Wanderweg am Bergesrand 1400 m hoch über dem See – Bärenklau, Walddistel, Frauenmantel, Knabenkraut, Akelei, Bärenklau; atemberaubend schöne Blicke auf den Vierwaldstättersee. Dann kommt die Trasse der ehemaligen Rigi-Eisenbahn mit Brücke und Tunnel, die wir in brütender Hitze bis Rigi Scheidegg laufen, wo wir nach dreieinhalb Stunden endlich ankommen. Mein linker Knick-Fuß schmerzt, länger hätte ich nicht gehen können.
Wie Wilhelm Tell – Schifffahrt bei Sturm und Gewitter

Der Vorhang öffnet sich, ein Schweizer See und ein eindrucksvolles Bergpanorama ist zu sehen. Eine idyllische Szene, der Fischerknabe singt zur Melodie des Kuhreigens: „Es lächelt der See, er ladet zum Bade, der Knabe schlief am grünen Gestade…“ Und träumt von der Nixe. Ein Gewitter zieht auf, dunkles Krachen von den Bergen. Ein Mann in Not, Baumgarten, verfolgt von den Häschern des Landvogts, kommt an das Ufer des Sees und bittet den Fährmann ihn überzusetzen. Er hat, um seine Frau vor der Vergewaltigung zu retten, einen Burgvogt erschlagen. Der Wind peitscht das Wasser. Baumgarten, des Fährmann Knie umfassend bittet: „So helf euch Gott, wie ihr euch mein erbarmet.“ Doch dieser weigert sich, den Verfolgten ans rettende Ufer über zu setzen. Er habe Weib und Kind, das könne er nicht riskieren. Dringliche Bitten der Umstehenden können seinen Sinn nicht ändern. „Greif an mit Gott, dem Nächsten muss man helfen / es kann uns allen gleiches ja begegnen“, sagt Kuoni. Da kommt Wilhelm Tell des Wegs. Auch er fordert den Schiffer auf: „Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt / vertrau auf Gott und rette den Bedrängten.“ Der antwortet: Tue es doch selbst, kannst du doch auch das Boot durch Wind und Wellen im Sturm steuern. Und in der Tat, Tell wagt es mit Gott und rettet den Verfolgten, steuert das Boot glücklich über den See. „Wohl aus des Vogts Gewalt errett ich euch / Aus Sturmes Nöten muss ein andrer helfen / Doch besser ist’s, ihr fallt in Gottes Hand / als in der Menschen.“
So die Eröffnung des Schweizer Freiheitsdramas, ich sah sie als 12jähriger im Deutschen Schauspielhaus und war von Gewitter, Sturm und Rettung überwältigt. Der Sturm auf dem See spielt noch einmal eine wichtige Rolle in dem Drama. Geßler hat Tell zum Apfel-Schuss auf den eignen Sohn gezwungen. Das ist Frevel wider die menschliche Natur. Geßler versündigt sich so am Naturrecht sittlichen Verhaltens. So greift die Natur, Gott selbst, im Gewitter rächend ein. Ich meine Tells Rettung aus dem Boot des Landvogts, der ihn gefangen genommen hat, sie wird ganz als Werk des Wagemuts und des Gottvertrauens geschildert. In einer Umkehrung der Jonageschichte, wo im Sturm der Prophet Gottes über Bord geworfen wird, um die Elemente zu besänftigen, wird Tell gebeten, das Boot im Sturm zu steuern. Er nutzt die Gelegenheit, ganz romantischer Held und Stuntman an einem Felsenriff, die Gnade Gottes anflehend vom Boot zu springen und so sich selbst zu retten. „So bin ich hier gerettet aus des Sturms Gewalt und aus der schlimmeren der Menschen.“(87)
Nachvollziehen konnte ich 60 Jahre nach der Theatererfahrung diese Sturmdramatik realiter auf dem Vierwaldstättersee. Wir wollten nach der Rigi-Wanderung noch eine abendliche Fahrt mit dem Schiff in den Sonnenuntergang machen. Doch ein Gewitter zog auf. Die Sonne verdunkelte sich. Schwarze Wolkenmassen ballten sich über dem Gebirge, der Pilatus war nicht mehr zu sehen, der Wind peitschte das Wasser. Blitze am Himmel, Donner. Überall am Ufer leuchteten die Warnlampen auf. Letzte Boote retteten sich in den Hafen. Der Wind wurde stärker, die Wellen höher, es fing an stark zu regnen. Da legte das Schiff nach Beckenried an. Dann fegten Wind- und Regenböen mit 80 Stundenkilometren über den See und den Anlegesteg, es war kaum noch etwas zu sehn auf dem Wasser. Der Sturm war so gewaltig, dass der Kapitän bekanntgab: wir bleiben erst mal an der Anlegestelle liegen. Es blies, donnerte und krachte, dass man es mit der Angst bekommen konnte. Mir fiel Tells Satz ein: „Wohl aus des Vogts Gewalt errett ich euch / Aus Sturmes Nöten muss ein andrer helfen / Doch besser ist’s, ihr fallt in Gottes Hand / als in der Menschen.“ Den sprach jetzt keiner, vielleicht innerlich ein kleines Stoßgebet. Aber man war ja sicher auf einem mit neuester Technik ausgestatteten Schiff der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees, auf dem der Kellner mich gerade fragte, was ich zu trinken wünsche. Mutig trat ich aufs Außendeck, um die Tell-Erfahrung sinnlich zu machen, Regen peitschte mir ins Gesicht. Ich singe in den Wind: „Wir lieben die Stürme, die brausenden Wogen“, gehe aber lieber doch wieder nach drinnen. Nach einer Viertelstunde können wir die Fahrt fortsetzen, der Sturm hat sich ein wenig beruhigt, das Unwetter ist weitergezogen. Nach einer Stunde klart es sogar auf, Fetzen blauen Himmels sind zu sehen, doch die Sonne zeigt sich nicht mehr, nur ein paar Bergspitzen sind noch abendlich angeleuchtet. Die anbrechende Dämmerung verdunkelt die Bergwände noch einmal, auf dem jetzt nur noch mäßig bewegten See gleitet das Schiff nur noch leicht schaukelnd dahin. Das Lied „Auf dem Wasser zu singen“ des Grafen Stollberg fällt mir ein, zwar kein tanzendes Abendrot auf dem Wasser, aber das Gefühl, dass meine Seele dahingleitet wie der schwankende Kahn. Und dass ich einmal selber der wechselnden Zeit entgleiten werde. „Ach, es entschwindet mit tauigem Flügel mir auf den wiegenden Wellen die Zeit, morgen entschwindet mit schimmerndem Flügel wieder wie gestern und heute die Zeit, bis ich auf höherem strahlendem Flügel (hopefully!) selber entschwinde der wechselnden Zeit.“ Ich war froh, die dramatische Eröffnungsszene des Wilhelm Tell selbst auf dem See erlebt zu haben, relativ sicher in einem Dampfer. Aber im Zuger Hafen ist bei diesem Sturm ein altes dort ankerndes Passagierschiff untergegangen, sagte mir die Nachbarin aus dem 1. Stock.
An der Anlegestelle ist durch den Sturm ein großer Ast von einem Baum abgeschlagen worden. Hoffentlich hat er niemanden getroffen (wie 1938 ein Ast tödlich den unglücklichen Ödon von Horvath auf den Champs Elysee in Paris, der aufgrund der Weissagung, in Paris erwarte ihn etwas Außerordentliches, dorthin gereist war!).
In der Wohnung von Fulbert und Li schlage ich die Sonntagszeitung auf und lese von diversen Unglücken, die sich in der Schweiz ereignet haben. Ein Heißluftballon ist in eine Hochspannungsleitung geflogen, ein amerikanischer Tourist starb, zwei Touristen und der Ballonführer wurden schwer verletzt. Eine 62 Jahre alte Wanderin aus Deutschland stürzte einen Hang hinunter und verletzte sich tödlich. Das kommt leider häufig vor im Gebirge, denke ich. Aber dann dies: Ein unverantwortlich leichtsinniges Ehepaar mit Kleinkind ist in einen für Personenbeförderung nicht zugelassenen Transportlift gestiegen, der Korb kippte um, die Eltern starben, das Kind überlebte schwerverletzt. Man mag die Opfer nicht selbstgerecht schelten, tat man nicht selber schon mal ähnlich Leichtsinniges! Und doch ist es kaum zu verstehen, dass sie sich so verhalten haben. Welch eine schwere Erbschaft für das Kind. Es ist schon bezeichnend, dass gerade im Urlaub beim Baden, Wandern, Bergsteigen und bei Extremunternehmungen so viele Menschen zu Tode kommen. Es ist der Preis für das schöne Erlebnis bzw. den Nervenkitzel, den wir im Urlaub suchen. Auf der anderen Seite kann man sich noch so vorsichtig verhalten; ein technischer Defekt, ein menschliches Versagen (siehe das schreckliche Zugunglück in Santiago di Compostella) wird dadurch nicht verhindert noch die Gefahr, das Opfer des Leichtsinns oder der mangelnden Konzentration von jemand anderen z.B. eines Autofahrers zu werden.
Was also? „Leben ist immer lebensgefährlich“, sagte Erich Kästner mal. Ich erinnere mich, dass ich auf einem meiner Geburtstage ein Spielchen organisierte, immer zwei Gäste musste aus einem Topf gezogene Sprüche darstellen und kommentieren. Dorothee Sölle bildete mit meinem dicken Bruder Rainer ein Paar. Sie sagte sogleich spontan:. „Welch ein dummer, banaler Spruch!“ Richtig, und doch erinnern einen die Unglücke daran und der Zufall, mit dem sie Menschen treffen. „Man weiß nicht Tag noch Stunde.“
Maria in den Linden
Am nächsten Tag ist es bedeckt, und es hat sich abgekühlt. Morgens lesen, dann Unkraut jäten im Garten, alte Blätter und Blüten entfernen, ich zupfe die verblühten Goldmelissen-Blüten ab, es sind bestimmt über 150. Apropos Unkraut - was ist in einem naturnahem Garten Unkraut, was nicht? Kann sein, dass wir wie die zelotischen Jünger Jesu auch etwas gejätet haben, was kein Unkraut war. Die Schilderwache des Gerätehäuschens sagt es uns nicht, da müsste schon die in Italien weilende La finta gardiniera kommen und aufklären.
Nachmittags ein Ausflug nach Kehrsiten-Bürgenstock mit dem weißen Raddampfer Unterwalden, der in einer eleganten Kurve, geradezu filmmäßig, am Steg anlegt. Welch ein schönes Schiff! Drinnen ist der Maschinenraum einzusehen. Die glänzenden Kolben bewegen sich rhythmisch hin und her und treiben die Schaufeln an. Ruhig liegt der See. Wir gehen den gemütlichen Uferweg nach Stansstad. Männergesang ertönt von fern. Einstimmig, leicht mißgetönt. Auf der Terrasse des Hotels sitzt eine laut redende, singende und lachende Männergruppe. Absolventen der Handelsschule Neuenburg, Mitglieder der Verbindung Industria, keine Akademiker. Wir sind die Armen, die Bettler, sagt einer und lacht. Das sagte Luther auch, sage ich: wir sind Bettler, das ist wahr. Dann sind wir Lutherianer.
In Kehrsiten-Dorf eine kleine Kapelle direkt am See gelegen: Maria in den Linden. 1635, so lese ich drinnen, hatten zwei Fischer eine Marienvision, bei der ihnen die Jungfrau zwischen zwei Linden erschien. Sie bauten ein Bethaus, später wurden daraus ein Kirchlein und ein Wallfahrtsort. Man zieht zu ihm mit einem Marienlied, das den Refrain hat: „O Maria in der Lind, bet für uns bei deinem Kind.“ Der See plätschert ans Ufer, hoch ragt die Felswand auf, Im Hotel Baumgarten kehren wir ein, trinken Kaffee und essen einen wunderbaren Pflaumenkuchen mit Blätterteigboden.
Der sterbende Löwe – eine Schweizer Erinnerung an den Tuileriensturm 1792

Am nächsten Morgen regnet es, bis Mittag will es überhaupt nicht aufklaren. Lesen, Musik hören. Dann in die Stadt. Am Löwendenkmal Massen von Koreanern, Japanern und Chinesen, die wohl im Gletscher-Garten waren und nun den gewaltigen sterbenden Löwen von Thorwaldsen auf der Felswand bestaunen. Er wurde 1821 zur Erinnerung an die Schweitzer Soldaten in den Fels gehauen, die bei der Erstürmung der Tuilerien durch das Volk in Paris (wo der des Verrats verdächtigte König Ludwig XVI. mit seinem Hofstaat nach der Aufgabe von Versailles lebte) am 10. August 1792 zu Tode kamen und für die, die bei den Septembermassakern am 2./3.9 hingerichtet wurden. Zwischen beiden Ereignissen ist zu unterscheiden. Den Tuileriensturm am 10. August, der Beginn der zweiten Revolution des Volkes, hatte ich bislang nur aus der Perspektive des Volkes gesehen, die August-Märtyrer hießen die hunderte von Revolutionären, die dabei getötet wurden. Jetzt also die andere Seite, die Schweizer Soldaten, die bei der Verteidigung des Königs „Schweizerische Tugend und Mut“ bewiesen und „ihrem Schwur treu tapfer kämpfend fielen“, wie die lateinische Inschrift sagt und durch das Relief des sterbenden Löwen geehrt wurden – „das traurigste Stück Stein der Welt“ nannte ihn Mark Twain. In der aufgeheizten Atmosphäre des Koalitionskrieges suchte man in Paris nach der Einnahme von Verdun weiter nach Schuldigen. Mit Duldung durch die Führer der Revolution wurden Anfang September Parteigänger des Ancien regime, die man aus den Gefängnissen holte, auf grausame Weise ermordet. Diesen Septembermassakern, verübt von Mörderbanden, darunter viele Frauen, fielen nach vorsichtigen Schätzungen 1100-1400 Menschen zum Opfer fielen, darunter auch einige Schweizer Söldner.
Ich hatte vor 2 Monaten das Buch von H.J.Schings „Revolutionsetüden“ gelesen, das den außerordentlichen Einfluss dieser Ereignisse auf Schiller, Goethe und Kleist und ihre Distanzierung von der französischen Revolution behandelte. Eine besondere Rolle spielte dabei am 3. September 1792 eines der widerlichsten Verbrechen der französischen Revolution – die Ermordung, öffentliche Verstümmelung und Schändung der Prinzessin von Lamballe, einer engen Vertrauten der Königin Marie-Antoinette. Diese Schändung der Prinzessin von Lamballe, viel kolportiert, hat auch die mit der Revolution sympathisierenden Schriftsteller wie Schiller und Klopstock zur Distanzierung gebracht und jene, die ohnehin die Revolution als „schrecklichstes Ereignis“ ablehnten wie Goethe, in ihrer Kritik an der revolutionären Unordnung bestärkt.
Merkwürdig nun in Luzern, kein 300 Meter von Fulberts und Lis Wohnung entfernt, diesem Verbrechen aus anderer Perspektive zu begegnen, aus der Perspektive des Gedenkens an die Schweizer Söldner, die, zumeist Bauernsöhne, sich fremden feudalistischen Herrn verdingten, nicht nur dem Papst mit seiner Schweizergarde (daran erinnert eine Tafel an der Hofkirche), sondern auch dem französischen König. Dachte Schiller daran, dass diese späten Nachfahren, die Ur-, Ur-, Urenkel Wilhelm Tells, der ja den Tyrannenmord beging (mehr aus privater als aus politischer Motivation allerdings), jetzt bei der Verteidigung eines zum Feind des Volkes, zum Unmenschen erklärten Königs starben (einige von ihnen wurden Anfang September guillotiniert), eines Königs, der dann selber im Januar 1793 hingerichtet wurde. Schiller, am 26. August zum Ehrenbürger Frankreichs erklärt, ekelten die Henkersknechte Robespierre und St. Just an. Die französische Revolution entgleiste zum „Despotismus der Freiheit“ und begründete so die deutsche Revolutionsfurcht, aber auch den Versuch einen „ästhetischen Staat“ zu bauen, „Freiheit durch Freiheit zu geben“ ,wie Schiller es formulierte. Das misslang 1848, 1871 und 1919, gelang erst 1949 und 1989.
Apropos ästhetischer Staat. Bei Credit Suisse sehe ich eine Videowand, die Sponsorentätigkeiten der Bank benennt. Unter anderem unterstützt Credit Suisse auch die Welttheaterspiele im Kloster Einsiedeln .Das merke ich mir. Erst aber fahren wir mit dem Dampfer nach Weggis. Der Himmel hat ein wenig aufgeklart. Hinter der Zackenlinie des Pilatus zeigt sich blauer Himmel, tiefer ziehen weiße Wolkenstreifen vor das Bergmassiv. Weggis wird als Riviera des Sees angepriesen. Hier wächst Oleander, Hibiscus, herrliche Kastanien und sogar Palmen Wir unternehmen einen Dorfspaziergang. Die Allerheiligenkapelle mit ihren schönen Malereien ist leider verschlossen. Wir gelangen zu einem Hügel mit großen Streuobstwiesen. Der dazugehörige Bauernhof hat einen Gemüseladen. Auf der Wiese vor dem Haus drei hingestreckte Obstbäume. Sie sind vorgestern, so die Bäuerin, die uns Bohnen verkauft, vom Sturm entwurzelt worden, auch einige voll hängende Pflaumenbäume hat es erwischt. Welch ein Jammer! Aber was klagen wir, sagt die Bäuerin, bei Zürich hat ein herabfallender Ast einen Menschen erschlagen!
Abends lese ich Hakan Nessers „Der unglückliche Mörder“ zu Ende. Wie ein bis dahin unbescholtener Mann durch ein Fehlverhalten, er setzt sich betrunken ans Steuer, fährt nachts einen Jungen an, der stirbt und begeht Fahrerflucht, auf eine schrecklich schiefe Bahn gerät, er wird erpresst und tötet, um der Verhaftung zu entgehen, drei Menschen, einer davon ist der Sohn des pensionierten Kommissars Van Veeteren. Die ermittelnden Kommissare tappen lange im Dunkeln .Der Autor lässt seine Protagonisten schwarze theologische Gedanken anstellen, um die Logik hinter den Verbrechen zu verstehen. „Ist es nicht immer so, dass der Mörder sein Verbrechen für berechtigt hält“, fragt die Kommissarin Moreno.“ - „Der Mörder hätschelt seine Motive, (…) aber heute ist das Dogma von der Erbsünde vor Gericht einfach kein Argument mehr“, meint Van Veeteren. „Es gibt eine schwarze Logik, die oft leichter zu entdecken ist, als die Logik unseres normalen Verhaltens. Das Chaos ist bekanntlich Gottes Nachbar, aber in der Hölle herrschen zu meist Gesetz und Ordnung … Diese bösartige Logik kann uns alle treffen, wenn wir in die Enge getrieben werden“.(213) Das andere Erklärungsmuster ist die Billardkugeltheorie der Karombolage, „daß man nicht sagen kann, was passiert, wenn wir zusammenstoßen und die Richtung ändern“(272) Karambolage ist der Original-Titel im Schwedischen. Der Mörder, sagt sich Van Veeteren, war offensichtlich in „ein immer komplizierteres, teuflisches Dilemma“ hineingerutscht, das er mit einer Art verzweifelter, pervertierten Logik des Mordens zu lösen versucht hatte. Und war dabei selbst zum Opfer geworden(284). Viel Verständnis für einen Mörder, der es nicht schafft, aus dieser Logik auszusteigen. Zum Schluss, als er gefasst ist, sagt dieser zu Van Veeteren, der ihm endlich gegenübersitzt, dem Mörder seines Sohnes: „Du mußt wissen, dass ich noch vor 2 Monaten ein ganz normaler Mensch war … ich werde mich umbringen, sobald sich eine Gelegenheit dazu bietet.“ „Warte nicht zu lange“ ,sagt Van Veeteren finster, „denn sonst komme ich zurück und erinnere dich daran.“
Wie der Zufall so spielt - ich hatte den Roman bei Fulbert und Li aus einer Reihe von Krimis zufällig herausgegriffen. Der Titel interessierte mich, denn ich muss Ende des Monats in St. Katharinen einen Vortrag über das 5. Gebot halten und wollte besonders auf die fahrlässigen Tötungen eingehen, begangen von Autofahrern mit anschließender Fahrerflucht. Es gibt dazu mehrere Filme, zuletzt Gnade und einen Jugendroman Zebra, der 2011 den evangelischen Buchpreis bekam (ich musste die Laudatio halten) und der auch einen Erpresser kennt, der sich Moses nennt. Wahrscheinlich kannte die Autorin den Krimi von Hakan Nesser, vermute ich jetzt.
Beethoven und Wagner in Tribschen
Wieder regnet es den gesamten Vormittag. Ausführliche Zeitungslektüre und dann entdecke ich Beethovens Klaviertrios mit Barenboim, Zuckerman und der frühverstorbenen Jacqueline du Pre. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1970, die jungen Gesichter auf dem Cover, daran denkend, das die Cellistin anders als ihr Mann Barenboim, der demnächst nach Luzern kommt, nicht alt werden konnte. Das frische Musizieren der jungen Musiker teilt sich ebenso unmittelbar mit Beethovens erfindungsreiche Musik, im Erzherzogstrio wie im Geistertrio und vor allem in dem Trio op. 70 Nr. 2, das manchmal eher wie Schubert klingt. Und dann noch die Variationen über den Schneider Kakadu.
 Nachmittags in das Wagnersche Landhaus in Tribschen. Wunderbar gelegen am See auf einem Hügel, einfacher dreigeschossiger Bau: Wohnhaus Wagners von 1866 bis 1872 : Ort der Fertigstellung der Meistersinger an dem Erard-Flügel. Und des Siegfried-Idylls 1870 zur Taufe des Sohnes mit der berühmten Uraufführung im Treppenhaus als Überraschung für Cosima. 1938 zur Eröffnung der ersten Luzerner Festspielwochen von Toscanini dort wieder aufgeführt. Hier hat Hans Richter die Klavierauszug für Tristan hergestellt und die Partitur der Meisteringer kopiert. Hier war Nietzsche 23mal zu Besuch und verlebte glückliche Stunden der Freundschaft mit Wagner, wurde durch seine Musik quasi neugeboren, er hatte ein Zimmer im 1. Stock, wo Cosima mit den Kindern wohnte. Hier besuchte ihn der junge König Ludwig II und schlief in Wagners Arbeitszimmer. „Wohin ich mich aus meinem Haus wende, bin ich von einer wahren Wunderwelt umgeben, ich kenne keinen schönern Ort auf der Welt.“ Wohl wahr! Nachmittags in das Wagnersche Landhaus in Tribschen. Wunderbar gelegen am See auf einem Hügel, einfacher dreigeschossiger Bau: Wohnhaus Wagners von 1866 bis 1872 : Ort der Fertigstellung der Meistersinger an dem Erard-Flügel. Und des Siegfried-Idylls 1870 zur Taufe des Sohnes mit der berühmten Uraufführung im Treppenhaus als Überraschung für Cosima. 1938 zur Eröffnung der ersten Luzerner Festspielwochen von Toscanini dort wieder aufgeführt. Hier hat Hans Richter die Klavierauszug für Tristan hergestellt und die Partitur der Meisteringer kopiert. Hier war Nietzsche 23mal zu Besuch und verlebte glückliche Stunden der Freundschaft mit Wagner, wurde durch seine Musik quasi neugeboren, er hatte ein Zimmer im 1. Stock, wo Cosima mit den Kindern wohnte. Hier besuchte ihn der junge König Ludwig II und schlief in Wagners Arbeitszimmer. „Wohin ich mich aus meinem Haus wende, bin ich von einer wahren Wunderwelt umgeben, ich kenne keinen schönern Ort auf der Welt.“ Wohl wahr!
Mit Erstaunen lese ich von Wagner, dem energischen Bergsteiger, der gerne und viel wanderte, ohne die heutigen Lifte die Rigi und den Pilatus bestieg, einmal auf den Pilatus die Freunde und die gesamte Familie mitnahm, Cosima machte schlapp. Bei einem Rigi-Aufenthalt stand Wagner früh auf, um den Sonnenaufgang zu erleben, hörte einen Knecht das Alphorn blasen (wie wir drei Tage zuvor), das gab ihm den Einfall zur Hirtenmelodie in Tristan und Isolde (die er zu großen Teilen ja im Hotel Schweizerhof komponierte). Und lange vor Mahler das Lob des Klangs der Kuhglocken, die, der Stolz ihrer Besitzer, stets verschieden klingend ihn faszinierten. Was mich unter den vielen Originaldokumenten berührte - der Dankesbrief an Pastor Tschudi für die Trauung in der Luzerner Matthäuskirche und das Gedicht, das er für Cosima verfasste. Befremdlich die Schreiben, die die Tätigkeiten von anderen für Wagner betreffen, keine Logierkosten und der Dienst, etwas für ihn tun zu dürfen, sei Lohn genug. Trotzdem – Wagner in Tribschen scheint mir ein etwas positiveres Kapitel in seiner weithin unerfreulichen Biographie.
Durch diese hohle Gasse – Gründung eines Mythos
 Samstag Ausflug nach Morschach, von dort mit der Seilbahn nach Stoos und herrliche zwei stündige Wanderung auf den Fronalpstock. Endlich wieder schönes Wetter, strahlend blauer Himmel. Und ein atemraubender Panoramablick auf Bergwelt und Vierwaldstättersee, der viel schöner ist als der vom Rigi. Kurzer Stopp an der hohlen Gasse in Küssnacht, Ausflug ins Konkret-Mythische. Wir gehen den uralten dunklen und gepflasterten Weg bis zur Tell-Kapelle, der erst in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts gerettet und symbolisch aufgeladen wurde. Schon erstaunlich, wie Schillers dramatische Bearbeitung des legendenhaften Stoffs, der sich in einer Chronik aus dem 16. Jahrhundert zuerst findet, einen Nationalhelden der Schweiz erzeugt – angeregt und unterstützt von Goethe, der hier war und Schiller seine Aufzeichnungen zur Verfügung stellte, vor allem die lokale Topographie. Bei Goethe, der bis zum Gotthard wanderte, ist Tell eher ein Säumer, der den Handelsweg nutzt, erst bei Schiller wird er der einsame Jäger, einerseits ein Naturmensch, Kultur und Politik sind ihm verdächtig, er handelt als Mann der direkten Aktion. Andererseits ist er ein Held mit Gottvertrauen, ich sagte es schon, er wagt es mit Gott in Extremsituationen. Gott selber ist auf der Seite Tells und der Schweizer. Er ist ein „Gott mit uns“ derjenigen, die ihre Freiheit erringen, ihre Familie verteidigen, also eng begrenzt auf die Verteidigung legitimer Rechte. Es geht um das Notwendige und Rechtliche der Hilfe für den Nächsten und der Selbsthilfe gegenüber dem Tyrannen in einem begrenzten Fall. Die beweglichen Kulissen, die im Info-Häuschen die Geschichte der Hohlen Gasse, ursprünglich Teil eines Handelswegs nach Norditalien und die Entstehung des Tell-Mythos erzählen, sind unterlegt mit der flotten Wilhelm Tell-Musik von Rossini. Samstag Ausflug nach Morschach, von dort mit der Seilbahn nach Stoos und herrliche zwei stündige Wanderung auf den Fronalpstock. Endlich wieder schönes Wetter, strahlend blauer Himmel. Und ein atemraubender Panoramablick auf Bergwelt und Vierwaldstättersee, der viel schöner ist als der vom Rigi. Kurzer Stopp an der hohlen Gasse in Küssnacht, Ausflug ins Konkret-Mythische. Wir gehen den uralten dunklen und gepflasterten Weg bis zur Tell-Kapelle, der erst in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts gerettet und symbolisch aufgeladen wurde. Schon erstaunlich, wie Schillers dramatische Bearbeitung des legendenhaften Stoffs, der sich in einer Chronik aus dem 16. Jahrhundert zuerst findet, einen Nationalhelden der Schweiz erzeugt – angeregt und unterstützt von Goethe, der hier war und Schiller seine Aufzeichnungen zur Verfügung stellte, vor allem die lokale Topographie. Bei Goethe, der bis zum Gotthard wanderte, ist Tell eher ein Säumer, der den Handelsweg nutzt, erst bei Schiller wird er der einsame Jäger, einerseits ein Naturmensch, Kultur und Politik sind ihm verdächtig, er handelt als Mann der direkten Aktion. Andererseits ist er ein Held mit Gottvertrauen, ich sagte es schon, er wagt es mit Gott in Extremsituationen. Gott selber ist auf der Seite Tells und der Schweizer. Er ist ein „Gott mit uns“ derjenigen, die ihre Freiheit erringen, ihre Familie verteidigen, also eng begrenzt auf die Verteidigung legitimer Rechte. Es geht um das Notwendige und Rechtliche der Hilfe für den Nächsten und der Selbsthilfe gegenüber dem Tyrannen in einem begrenzten Fall. Die beweglichen Kulissen, die im Info-Häuschen die Geschichte der Hohlen Gasse, ursprünglich Teil eines Handelswegs nach Norditalien und die Entstehung des Tell-Mythos erzählen, sind unterlegt mit der flotten Wilhelm Tell-Musik von Rossini.
Welttheater in Einsiedeln
„Ich wär auch liäbr riich und gsund als arm und chrank.“ Mit diesem Satz wirbt das Einsiedler Welttheater für seine diesjährige Aufführung des Grossen Welttheaters, frei nach Calderon. Fast drei Monate lang wird eine neue Fassung von dem Schweizer Autor Tim Krohn und in der Regie von Beat Fäh vor der gewaltigen Barockfassade und auf dem Vorplatz des Benediktinerklosters gespielt. Das Einsiedler Welttheater ist sozusagen das Oberammmergau der Schweiz. Zum ersten mal 1924 aufgeführt wurde das Grosse Welttheater Calderons alle 6, 7 Jahre von Einsiedler-Laienschauspielern des Ortes und der Umgebung, insgesamt 12mal, aufgeführt. 2000 und 2007 wurde zum ersten Mal eine Neufassung von Thomas Hürlimann gespielt. Thema der diesjährigen Neufassung des Stücks von Calderon aus dem Jahr 1635 ist der Mensch als Mängelwesen, das von Gott nicht perfekt geschaffen wurde, das krank wird, an Defekten leidet, Angst vor Erbkrankheiten hat. Es spielt „einige Jahre in der Zukunft“ und skizziert die bedrohliche Entwicklung des „Alles ist machbar.“ Beschweren sich die Menschen bei Calderon noch bei Gott, dass er sie mit ihren Sorgen und Nöten alleinlässt, so fragen sie jetzt, warum er sie zerbrechlich und pannenanfällig geschaffen hat. „So schlufig würd mä keis Auto buuä.“ Und in Variation eines Satzes von Woody Allen: „Ich würd amel a kei Gott wellä glaubä, woa Mänscha wiä mich auf dem Programm hat.“ Ein Chor der Ärzte und Pharmazeuten tritt auf, der die alphabetisch skandierten Krankheiten nicht länger hinnehmen will. Das Stück skizziert einen Gesundheits- und Sicherheitsstaat, der alle Risiken in den Griff bekommen, eine Medizin-und Pharmaindustrie, die unterstützt von korrupten Politikern Gewinn machen will. Wie sich dieser Trend auf der persönlichen Ebene spiegelt, das wird erzählt in Geschichten, wie der von Luki und Leni, die ein Kind zeugen wollen, aber es soll das schönste, beste und gesündeste sein. Die sich dafür Tests unterziehen und die dabei in die Falle der Angst vor Defekten geraten, in das Abtreibungsdilemma. Der Reiche, der dement wird, und ein Penner treten auf. Der Politiker wird vom Schlag getroffen, seine Beziehung zur Pharmaindustrie (LaRoche) hilft ihm da nicht, das Publikum lacht. Calderons Figuren taumeln durch das Leben der Moderne. Dazu die Schönheit, die ewige Jugend, die Himmelshirtin, eien Leistungssportlerin. Und immer wieder treten die überzähligen und missgestalteten Kinder auf, die früher im See entsorgt wurden; ein Pater Clemens ist mit ihnen in Kontakt ist und erzählt ihnen die indianische Geschichte von der Erschaffung der Welt, die er mit ihnen aufführen will.
Das Ganze ist rasant und technisch aufwendig inszeniert. Der Choreographie der Massenszenen gelingt es, den riesigen Platz mit Aktionen zu füllen, angefangen vom Auftritt der Straßenkehrer über den Ärztechor bis zu den Polizisten, Demonstranten und den Dorfbewohnern. An die 300 Schauspieler, Musiker und Statisten aus Einsiedeln und Umgebung spielen mit Hingabe und Leidenschaft. Tolle Licht- und Tonregie. Die Fassade des Klosters bröckelt unter ohrenbetäubend apokalyptischem Lärm, Zappelnde hängen an Kränen. Ein riesiges Nilpferd wälzt sich nach vorn. Die Gestalten der toten Kinder werden an die Fassade projiziert, dort wo die Heiligen stehen. Die Straßenkehrer treten noch einmal auf, wiederholen ihren Text vom Beginn. Der Kreis hat sich geschlossen. Welttheater als Gesellschaftskritik, ein wenig zu moralisch und schwarz-weiß, aber insgesamt eine gelungene Aktualisierung. Wir haben alle Angst vor chronischen, nicht heilbaren Krankheiten, wollen gerne gesunde und schöne Kinder haben, den Krebs besiegen. Wie ertragen wir es mit Gott, gegen, ohne Gott, wenn unser Leben nicht aufgeht, Hoffnungen enttäuscht werden?! Wie finden wir unseren kleinen Platz im Großen Welttheater, wie können wir das nicht aufhebbare Leiden akzeptieren? Nachdenklich eilt man ins Parkhaus und ist doch schnell damit beschäftigt, nach Hause zu kommen, denn es ist schon spät. Und Einsiedeln liegt, wie der Name sagt, weitab.
Sonntag zum Gottesdienst in die reformierte Matthäuskirche hinter dem Hotel Schweizerhof, wie erwähnt Ort der Trauung Wagners mit Cosima und der Taufe Siegfrieds. Enttäuschend einfaches Orgelvorspiel mit Gounods Ave Maria. Freundlicher Pastor mit guter Ausstrahlung. Dass er neben dem Altar-Tisch in einem Sessel sitzt wie in einer Wohnstube, finde ich gewöhnungsbedürftig, aber nicht unsympathisch. Zu Beginn Paul Gerhardts Die güldne Sonne voll Freud und Wonne. Im dritten Vers stimmt etwas am Text nicht, „vor ihn zu treten mit Danken und Beten, das ist ein Opfer, dran er sich ergötzt“, das ist doch nicht original Paul Gerhardt! Ich bin beunruhigt und abgelenkt, auch weil ich nicht gleich auf die ursprüngliche Fassung komme, dann fällt es mir endlich ein: „dankbare Lieder sind Weihrauch und Widder, an welchen er sich am meisten ergötzt.“ Haben die Bearbeiter wohl verändert, weil dem modernen Schweizer Christen die Spiritualisierung der alttestamentlichen Opferpraxis nicht mehr verständlich ist. Aber man hätte es ja wenigstens anmerken können, dass da redaktionell eingegriffen wurde. Die Predigt geht über die Salbung Jesu durch die Sünderin in der Lukas-Fassung. Schöner Gedanke, dass Jesus die Menschen von ihrer Zukunft her beurteilt. Es gibt eine schöne Foto-Ausstellung in der Kirche – das also ist in der bilderfeindlichen reformierten Kirche möglich.
Gipfelstürmer mit dem Tell-Pass
Heute ist der 2. Freifahrttag mit dem Tellpass, das wollen wir richtig ausnutzen. Also: Morgens mit dem Schiff über den stillen See express bis nach Alpnachstad und dann mit der „steilsten Zahnradbahn der Welt“ auf den Luzerner Hausberg, der merkwürdig genug Pilatus heißt. Ein großartiger erhabener Berg mit Zacken, Steilwänden und grünen Matten (ganz anders als die gemütliche Rigi), oft umlagert von Wolkenstreifen oder ganz eingehüllt. Oben in 2100 Meter Höhe scheint die Sonne, aber es ist frisch. Hier lerne ich auch, wieso der Berg den Namen hat. Der Prokurator von Judäa, der Statthalter Pilatus, der Jesu zum Kreuzestod verurteilte und so ins Glaubensbekenntnis kam, soll nach einer Legende Selbstmord begangen, aber dann als Toter keine Ruhe gefunden haben, wie ein Ahasverus von Ort zu Ort gewandert und dann hier begraben sein. In einem stinkenden Pfuhl hoch oben, dort trieb er sein Unwesen, schickte böses Wetter, wenn man Steine hineinwarf. Bis der Stadtpfarrer Müller im Jahr 1585 hinaufstieg und den Tümpel exorzierte. Manche Drachensage rankt sich um den Berg. Es gab böse, aber auch gute Drachen, die die Verirrten beschützten.
Wieder ertönt ein Alphorn. Weiter Blick bis zu Eiger, Jungfrau und Mönch. Beim Rundgang an der Westseite treffen wir auf einen Wanderer, der von Hergiswil heraufgestiegen ist – fast vier Stunden lang. Was sind wir doch für faule Säcke! Aber mein linker Fuß macht es eben nicht mehr. Dann trinken wir einen Weißwein und stoßen auf die Schweizer Berge und unsere in der Toskana weilenden Gastgeber an. Dann wieder runter mit der Bergbahn, aufs Schiff nach Sansstad, mit dem Zug nach Hergisweil, von dort nach Engelberg (nettes Gespräch mit einer Schaffnerin über die Teuerung in der Schweiz) und dann mit drei Bergbahnen, die letzte dreht sich, auf den Titlis 3020 Meter - umgeben und bedrängt von Koreanern, Japanern, Chinesen und Indern. Oben im ewigen Eis des Gletschers, dessen Stube man begehen kann, bei ca. 10 Grad Wintervergnügen, besonders bei den Asiaten, die sich nicht genug tun können im Fotografieren auf der spektakulären wackelnden „europaweit höchsten Hängebrücke“. Aber man fragt sich, was dies aufwendige Erlebnis, hineingehauen in „die unberührte Alpenidylle“ (so das Werbeblatt) soll? Ich habe genug von den Superlativen. Abends sind wir rechtschaffen müde, obwohl wir wenig gelaufen sind, nur das letzte Stück von Gerschnialp nach Engelberg steil den Hang hinunter auf einem Trampelpfad. Gehe aber trotzdem noch im See schwimmen, er lächelt eben abends so schön und lädt zum Bade.
Der Dichtung Schleier aus der Hand der Wahrheit
„Der Morgen kam, es scheuchten seine Tritte den leisen Schlaf, der mich gelind umfing, daß ich erwacht aus meiner stillen Hütte, den Berg hinauf mit frischer Seele ging.“ Dieser morgendliche Beginn von Goethes Zueignung fiel mir ein, als ich wach lag und nicht wieder einschlafen konnte. Also stand ich auf, griff nach Reiners Ewigem Brunnen in der Neuausgabe von Schirnding aus dem Jahr 2005 und las das ganze Gedicht. Dass ja kein Tageszeitengedicht ist, sondern eines über die Dichtkunst, die dem Autor frühmorgens, als der Nebel mit der Sonne kämpft, als göttlich Weib, eine Aurora der Poesie begegnet. Und mit ihm ein Gespräch beginnt: kennst du mich nicht, fragt sie, erinnert ihn daran, dass er sich schon als Knabe eifrig nach ihr sehnte. Und belehrt ihn, seinen Mitteilungsdrang zu zügeln, männlich zu handeln.
Aus Wolkenstreifen greift sie einen Schleier und hält ihm diesen hin: „Empfange hier, was ich dir lang bestimmt: dem Glücklichen kann es an nichts gebrechen, der dies Geschenk mit stiller Seele nimmt: Aus Morgenduft gewebt und Sonnenklarheit / der Dichtung Schleier aus der Hand der Wahrheit.“ Und an dieser Stelle musste ich schlucken, ein paar Tränen stiegen mir in die Augen, so überwältigt war ich von der Schönheit und Wahrheit dieses Satzes. Dieser Schleier kann dir in der Schwüle des Lebens Kühle und Klarheit bringen, sagt die Göttin weiter. Und dann blätterte und las ich noch ein bisschen weiter in der Neuausgabe, entdeckte viele alte Bekannte, manche neue, las Brentano („Wenn der lahme Weber träumt, er webe, träumt die kranke Lerche auch, sie schwebe…“) und stieß dann auf das Gedicht von Robert Gernhardt zu seinem 63. Geburtstag, in dem er 63 Dichter aufzählt, die keine 63 Jahre alt geworden sind, eine Poetologie der zu früh Gestorbenen, fragt: wann schlägt die Stunde dem, der euch alle überlebt hat? Das war im Jahr 2000, Gernhardt, den ich einmal kennenlernte auf einem Empfang des Radius-Verlags, sollte keine 70 werden, die ich jetzt schon bin, seine bitteren letzten Gedichte, dem Kampf mit dem Krebs abgerungen, zeugen von Souveränität und Witz bis zuletzt: „Robert, ach du Armerchen, Gott ist keine Erbarmerchen.“ Grund zur Dankbarkeit am Morgen, der bedeckt war in Luzern.
Dienstagmittag Orgelkonzert mit Orgelgewitter und anschließender Fernwerksführung in der Hofkirche. 1862 hatte der Orgelbauer Haas in der Luzerner Kirche die Orgeldonnerpfeifen (von 1651) mit einer von ihm eigens konstruierten Regenmaschine auf dem Dachboden zusammengeführt, erklärt der umtriebige Organist Wolfgang Sieber, nachdem er eine halbe Stunde lang Schweizer Volkslieder und Tänze, unterbrochen von wahren Orgelgewittern, zum Besten geben hatte. Sie konnten es an Donnerschrecken mit dem Gewittersturm vor einer Woche aufnehmen. Es war ein lustig-melodisches (Appenzeller Tanz) und lautes Konzert, das den Gottes- und Gewitterschrecken (und der gehört seit der Antike zusammen, auch Jahwe war ursprünglich ein Wetter- und Gebirgsgott) recht eindrucksvoll zu Gehör brachte. Klanglawinen mutierten zum Gefühlsschauer Ende des 19.Jahrhunderts, dann ja auch in der Musik Wagners (Walkürenritt, Siegfrieds Trauermarsch), Mahlers (3.Sinfonie 1.Satz) und Richard Strauß (Alpensinfonie).Übrigens zeitgleich zur Eroberung der Berge durch die Bahnen, überall das Megalomane, das dann in die Katastrophe des 1. Weltkriegs mündete, auf das Donnern der Orgeln folgte das der Kanonen, die die männliche Jugend Europas zerfetzten, auf das orgelbegleitete Tedeum das erschütternde Requiem für Millionen Tote, allerdings erst von Britten nach dem 2.Weltkrieg im War Requiem realisiert.
Das Kalb vor der Gotthardpost – Schweizer Mythen
Heute Morgen entdecke ich in Fulbert und Lis schöner Bibliothek Peter von Matt, einen von mir sehr geschätzten Autor, und zwar das Buch Das Kalb vor der Gotthardpost. Zur Literatur und Politik der Schweiz. Ich beginne zu lesen - den ersten großen Essay: Die Schweiz zwischen Ursprung und Fortschritt. Zur Seelengeschichte einer Nation. Er beginnt mit einer Interpretation des Gemäldes von Rudolf Koller, das dem Buch den Titel gab, ein Bild, das jedes Schweizer Kind kennt und das farbig dem Buch als Extrablatt mitgegeben ist– das Kalb, das erschreckt vor einer rasenden Postkutsche davon läuft, Koller malte das Bild 1873, keine zehn Jahre vor der Eröffnung der Bahnlinie durch den Gotthard, die von dem Zürcher Bankier Johannes Escher betrieben wurde. Das erschreckte Kalb, Mitglied einer stehenden Herde (und Opfertier) flieht vor dem „beschleunigten Process“ von Business, Industrie und Kultur, den Jacob Burckhardt im gleichen Jahr 1873 notierte (übrigens eine Fortschreibung der alles verändernden Transformationskraft des Kapitals, den Marx und Engels in ihrem Manifest schon 25 Jahre zuvor beschrieben hatten, was von Matt nicht erwähnt).

1873, auch das Jahr eines Börsencrashs, der von Wien ein ausging. Ein großartiger Auftakt eines Essays (woraufhin ich gleich alles, was ich leichtsinnig hier über die Schweiz geschrieben habe, in den Papierkorb werfen möchte), fortgesetzt mit einer ausführlichen Analyse des großen Lehrgedichts von Albrecht von Haller Die Alpen, das um 1730 Natur, Vernunft, Freiheit mit dem Glück einer noch unverdorbenen Schweizer Bergbevölkerung in Verbindung bringt, während Verderbnis in der Stadt haust, so mit an dem Schweizer Mythos naturverbundener Sonderexistenz wirkte, all das im Rückgriff auf Vergil und Horaz und ihr Lob bukolischer Lebensweise. Und zugleich die Parolen der französischen Revolution mit vorbereitend. “Versuchts, ihr Sterbliche, macht euren Zustand besser.“ Das Bild vom ursprünglichen Bergvolk in der stadtfernen Natur, frei friedlich, vernünftig, ist natürlich ein nationales Traumbild. Den Riss in diesem Bild inszeniert zuerst Gottfried Keller, der als alter Schriftsteller angesichts des Festschwindels der vielen Schützen-, Turner- und Sängerfeste sich als „büssenden Besinger solchen Lebens“ sieht, der „seine Lieder bereut“. Der auch in der Novelle Das verlorene Lachen (Die Leute von Seldwyla II) die Fällung der Wolfhartsgeerer Rieseneiche als symbolische Handlung eines Fortschritts erzählt, die um des raschen Gewinn willens das Maß, sprich Nachhaltigkeit verliert. Die Baumschlächterei aber zerstört nicht nur einen sinnvoll kultivierten Naturzusammenhang (der Wald schützte die Weinberge vor Hagelwetter), sondern auch die Fundamente der Republik. Wo die Eiche stand, sieht der Held der Erzählung Jukundus „leeren Himmel“, von Matt verweist auf die untergründige Beziehung zu Heines und Nietzsches Gott-ist-tot-Passagen, der für das Verschwinden der sinnstiftenden Werte der demokratischen Gesellschaft und ihres Gewissens steht. Matt zeigt, im Gegensatz zum nationalen Traumbild war die Schweiz immer „ein Land der Pässe, des internationalen Verkehrs des Güteraustauschs und des Exports von jungen Männern auf die europäischen Schlachtfelder“. Dass die Großmächte das anerkannten, inklusive Nazideutschland, war schließlich der wirkliche Grund für seine respektierte Neutralität. Ich will und kann den großartigen Essay von Matts hier nicht weiter nacherzählen, (sehr informativ die Ausführungen über die Schweizer Schriftsteller, die in die Fremde gingen, darunter auch Urs Jaeggi), nur auf den Schluss verweisen, der wieder mit einem symbolischen Bild von einer Kuh zu tun hat. Es geht um den Roman Blösch von Beat Sterchi, der 1970 nach Kanada auswanderte, 1983 erschienen. Darin wird erzählt von dem Knecht Ambrosio, aus Spanien in die Schweiz gekommen, der als Melker auf einem Bauernhof arbeitet und eine besonders herzliche Beziehung zu der Kuh Blösch entwickelt. Nun schafft sich der Bauer, der sich lange gegen die Einführung der elektrischen Melkmaschine wehrte, diese schließlich doch an. Die Maschine ruiniert die Kuh Blösch, sie wird an den Schlachthof verkauft und dort muss Ambrosio, der inzwischen auf dem Schlachthof arbeitet, ihren Tod, ihre brutale Zerstückelung mitansehen. Kurz vor Ende des Romans aber stimmt Sterchi anlässlich der rituell mit Bekränzung durchgeführten Schlachtung einer Walliser Kuh einen Hymnus auf die uralte Herkunft der Kühe an, eine Vision ihrer Vorfahren vor aller menschlichen Zivilisation. Auch hier wieder „die Beschwörung eines vergangenen Ursprungs“, durch den „wir vom Richtigen (wissen), auch wenn uns das Illusionäre dieser Vision taghell bewusst ist.“
Deutsche Exilanten – vor dem Grab Thomas Manns
Bevor wir nach Zürich aufbrechen, lese ich noch schnell den Essay Wagner in Zürich. Weil in der Schweiz anders als in Deutschland 1830 und 1848 die Revolutionen glückten, die Macht des Patriziats wurde gebrochen ebenso wie die Herrschaft der Städte über das Land, Presse- und Versammlungsfreiheit wurden festgeschrieben, politischen Flüchtlingen musste von Gesetzes wegen Asyl gewährt werden, entstanden in der Schweiz für die kritisch-revolutionären Deutschen Zufluchtsorte. Viele deutsche Wissenschaftler lehrten an der Zürcher Universität. Einer der später berühmtesten Flüchtlinge in Zürich war Georg Büchner, der vor der Polizei wegen der Veröffentlichung des Hessischen Landboten fliehend sich in Zürich habilitierte und leider dort auch an Typhus starb – 1834 mit nur 24 Jahren. 1848 kam Richard Wagner, der sich an der Revolution in Dresden beteiligt hatte und steckbrieflich gesucht wurde, ebenso wie der Architekt Gottfried Semper, (100 Jahre später Brecht und Thomas Mann). In Zürich fand Richard Wagner einflussreiche und gutbetuchte Menschen, die ihn großherzig unterstützten (Otto Wesendonck aus Wuppertal und seine Frau Mathilde, die aus Hamburg stammte, eine Sloman und seine Muse wurde). Ihnen las er sein Textbuch Siegfrieds Tod vor, das als Reaktion auf die Niederschlagung des Revolution in Wien konzipiert war, Siegfried als das besiegte Proletariat. In der späteren Fassung des Rings ist davon bekanntlich nichts mehr zu finden, da kam Schopenhauer und seine Weltüberwindungsphilosophie dazwischen.…
In Zürich gehen wir als erstes in die Fraumünsterkirche, denn in der Nähe haben wir einen Parkplatz gefunden, einer Stiftung der Töchter Ludwig des Deutschen. Im romanischen Chor vier wunderbare Glasfenster zur biblischen Geschichte von Marc Chagall, jedes mit einem anderen dominierenden Farbton und mit überraschenden Deutungselementen, dazu hoch oben im Querhaus eine Schöpfungsrosette. Dann ins Großmünster, der Wirkungsstätte Zwinglis. Dieser Reformator hat mich immer beeindruckt, tapfer in der 3. Reihe kämpfend ist er in der Schlacht von Kappeln gegen die Katholischen Urkantone gefallen. Obwohl ich Pazifist bin, hat mir das imponiert (im Unterschied zu Luther, der immer die Obrigkeit aufgefordert hat zuzuschlagen und sich selber raushielt). Eindrucksvoll die modernen Kirchenfenster von Sigmar Polke. Vor der Kirche die Statue von Bullinger. Eine informative Ausstellung über die Züricher Reformation im Kreuzgang der Kirche, dessen Innenhof die vier Elemente darstellt.
Kaffeetrinken im Hotel zum Storchen, schweigen wir über den Preis, bummeln und dann durch die Thermengasse (hier lag mal eine römische Therme) zum höher gelegenen Platz vor der Kirche St. Peter. Welch eine schöne Überraschung ist dieser verträumte Platz mit einer Platane in der Mitte, dem Pfarrhaus, in dem Lavater wohnte und der schlichten Barockkirche, deren erster Bau die älteste Kirche Zürichs ist. Lavater ist mir aber von meinen Lessingstudien her in unangenehmer Erinnerung; er wollte, dass Moses Mendelssohn sich taufen lässt…
Schließlich zum Friedhof in Kilchberg. Er liegt sehr schön oberhalb des Sees. Zuerst das Grab Conrad Ferdinand Meyers neben der Kirche (ich liebe seine Novelle Der Schuß von der Kanzel), dann weiter weg die Gräber von Thomas und Katia Mann und ihrer Kinder (bis auf Klaus, der in Cannes begaben liegt und Golo, der am Rand des Friedhofs, möglichst weit weg vom Vater, ein Einzelgrab haben wollte.) Schräg dahinter das Grab von Gert Westphal, der Thomas Manns Romane wunderbar vorgelesen hat (einmal habe ich ihn live gehört: „Und siehe da, es war Lea“). Und im Tod so dem großen Autor nahegerückt ist. Wie viel stilles Leseglück hat mir doch der große Zauberer aus Lübeck bereitet, wie viele Einsichten verdanke ich ihm, wie viel schöne Stellen werden mir bis zuletzt gegenwärtig sein, etwa die Ausführungen Kretzschmars über Beethovens letzte Klaviersonate in Doktor Faustus – das zum Schluss leicht veränderte Arietta-Motiv: „O du Himmelsblau, groß war Gott in uns, grüner Wiesengrund“. Ich bin dankbar und wehmütig zugleich.
Mariae Himmelfahrt und Natur-Theater am Waldweidli
Morgens ist es ungewöhnlich ruhig in der Wemselinstraße, keine lauten Lastwagen, die die Morgenruhe stören, was ist geschehen? Da fällt es mir ein: Es ist Feiertag, Mariä Himmelfahrt, ein Fest, das wir Norddeutschen überhaupt nicht kennen, natürlich mitfeiern würden, wenn es auch im Norden Feiertag wäre. Aber theologisch habe ich meine Schwierigkeiten mit diesem Fest, das ich aber, wenn es künstlerisch gelungen an die Decken der Barockkirchen gemalt ist und befreit von aller Erdenschwere Maria emporschwebt zu ihrem Sohn, durchaus gelten lasse. Mittags fahren wir nach Stansstad und gehen dort Baden, nicht im vollen Schwimmbad, sondern am General Guisan-Quai, dort gibt es eine Wiese mit Toilettenhaus, auf einer Tafel wird ausdrücklich das Baden verboten. Trotzdem gehen viele im See schwimmen. Ich traue mich schließlich auch, in den See zu springen. Da kommt ein Wagen der Polizei, aha denke ich, jetzt geht’s uns an den Kragen, aber nichts da, sie schreiben nur jemanden auf, der falsch geparkt hat und fahren wieder weg. Ich frage ein paar junge Leute neben uns, wie das zu verstehen sei. Resigniert die Polizei vor der Renitenz der Schweizer? Nein, meinen sie, diese Verbotsschilder sollten nur die Haftpflichtfrage regeln – also Baden auf eigene Gefahr.
Von Stansstad nach Seelisberg, wo im Rahmen des Seelisberg-Rütli-Festivals das musikalische Schauspiel Tell trifft Wagner: Begegnungen am Vierwaldstättersee gespielt. Seelisberg liegt oberhalb des Schweizer Mythenorts Rütli ,wo sich vor 700 Jahren in dem berühmten Schwur angeblich die Urform der Eidgenossenschaft konstituierte. Auf einer traumhaft gelegenen Hangwiese, sie heißt Waldweidli, mit Blick auf den Urner See, eingefasst von zwei markanten Bergen rechts und links, die sich abendlich röten, ist die Bühne mit Orchesterzelt aufgebaut, dazu eine überdachte Zuschauertribüne. Allein hier sitzen und das Naturtheater erleben, lohnt den Besuch. Aber es gibt ein musikalisches Schauspiel, das ein umtriebiger Gemeindepräsident flugs zum Seelisberg-Rütli-Festival deklarierte nach der Logik: Wagner, 200. Geburtstag, war hier in Seelisberg oberhalb des Rütli, schwärmte davon, lebte dann in Tribschen, komponierte dort wichtige Werke, hatte illustre Gäste (König Ludwig I), daraus machen wir was: Tell trifft Wagner also, verfasst von Ursula Haas und Guy Kretna, mit Musik von Wagner und dem Dirigenten und Komponisten Bertrand Roulet, der ein kleines Orchester und einen Laienchor dirigiert. Die Story, nun ja, Wagner im seidenen Hausrock und mit Barrett, großartig parodistisch gespielt von Albert Hirche, befindet sich in Tribschen in einer Schaffenskrise, jammert Cosima etwas vor, poltert, stöhnt, geht ihr an die Wäsche, König Ludwig läuft durch den Garten, dann tritt Tell auf, er will von Wagner ein Tell-Musikdrama, erinnert ihn in Knittelversen daran, dass es mal eine Tell-Skizze von ihm gab, schießt seinen Pfeil ab und trifft ihn - nicht so richtig. Die Episode versandet, weibliche Figuren sollen Wagner zur Inspiration verhelfen, Mathilde Wesendonck-Undine und dann eine barfüßige Heidi, klappt auch nicht so recht, dazwischen kammermusikalische Wagnerklänge, Siegfried-Motiv, Hornruf, Rheinfahrt, Tristan-Vorspiel, Meistersinger, das hört man gern. Es wird langsam dunkel und kühler, man hüllt sich in die mitgebrachte Decken, „gelassen steigt die Nacht ans Land, lehnt träumend an der Berge Wand“ ,und dann ist das Stück aus, Applaus für die Darsteller und Musikanten, von mir vor allem für das Natur-Bühnenbild, das Waldweidli, zurück durch den dunklen Wald zum Parkplatz und nach Luzern.
Eine Abschiedsfahrt auf dem See
Noch einmal eine Fahrt mit dem Schiff über den glitzernden, im Sonnenlicht dampfenden See, schon mit Abschiedsgefühl, nach Kehrsiten, noch einmal ausgiebig Schwimmen im See. Auf der Rückfahrt ab Hergisweil mit Bus, Stau in der Stadt, die Luzerner Festwochen beginnen mit einem von Claudio Abbado dirigierten Konzert. Auf der Inseli neben der Konzerthalle gibt es eine Live-Übertragung auf Großbildleinwand. Nach Brahms Tragischer Ouvertüre Schönbergs Waldtaube aus den Gurreliedern und dann nach der Pause Beethovens Eroica, die Widmung an Napoleon vom Komponisten ausradiert, sah die Originalpartitur in Bonn auf der großen Napoleon-Ausstellung, das Thema der Festspiele ist Revolution, sehr fein und zugleich dynamisch gespielt – die sechs Fortissimo-Schläge im 1. Satz tönen schmerzlich-scharf, interessant dass Beethoven im Variationen-Schlusssatz einen lutherischen Choral zugrunde legt. Mit der furiosen Coda am See, es ist inzwischen dunkel geworden, endet unsere Luzern-Reise.
|

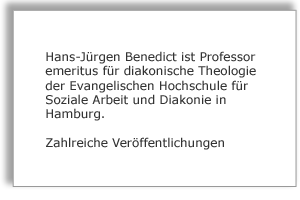 Ein guter Freund hat mir angeboten, in seiner Luzerner Wohnung Urlaub zu machen. Er sei einen Monat weg, der Garten müsse gegossen, der Briefkasten geleert werden. Sonst könne ich alles benutzen, auch seine Bibliothek natürlich. Ich frage meine Partnerin, ob sie mitkommen will. Sie will. Also Aufbruch morgens um 6.30 in Köln mit ihrem alten Polo, vollgeladen mit Wein, Wasser, Bier und haltbaren Lebensmitteln, denn die Schweiz ist ein teures Land für Eurotouristen. Deswegen vorher zu Aldi!
Ein guter Freund hat mir angeboten, in seiner Luzerner Wohnung Urlaub zu machen. Er sei einen Monat weg, der Garten müsse gegossen, der Briefkasten geleert werden. Sonst könne ich alles benutzen, auch seine Bibliothek natürlich. Ich frage meine Partnerin, ob sie mitkommen will. Sie will. Also Aufbruch morgens um 6.30 in Köln mit ihrem alten Polo, vollgeladen mit Wein, Wasser, Bier und haltbaren Lebensmitteln, denn die Schweiz ist ein teures Land für Eurotouristen. Deswegen vorher zu Aldi!
 Am nächsten Tag Ausflug auf den Berg, der die Rigi heißt und nach Ansicht unserer Gastgeber ein Muss ist. In Goldau kaufen wir uns einen Tell-Pass (2 Tage Freifahrt, 5 Tage Halbtax), weil allein die Rundfahrt auf der Rigi 66 CHF kostet. Also mit der Zahnradbahn auf den Rigi-Kulm, den Klassiker unter den Wanderbergen bei Luzern, der viele berühmte Besucher zu verzeichnen hat, darunter Mark Twain, der darüber in seinem Reisetagebuch köstlich berichtet. Wunderbar der Rundblick vom Gipfel über die Seen, unter uns direkt der Zuger See, zur andern Seite auf die Hochalpen bis zu Jungfrau und Matterhorn. Bei klarer Sicht könnte man bis nach Freiburg, ja Straßburg blicken. Ein älterer Musikant bläst das wehmütige Alphorn, wie sagt doch der Schweizer Deserteur in Des Knaben Wunderhorn: „Zu Strasburg auf der Schanz, da ging mein Trauern an. Das Alphorn hört ich drüben wohl anstimmen, ins Vaterland musst ich hinüberschwimmen. Das ging ja nicht an.“ Er hört das Alphorn und wird von Heimweh gepackt, schwimmt durch den Rhein, wird aufgegriffen, zum Tode verurteilt und zur Hinrichtung abgeführt. Das Lied, das Mahler vertont hat, sind seine letzten Gedanken und Worte. Stockend ist der Gang der Musik. Illusionslos spricht der zum Tode verurteilte Schweizer: „Ich soll bitten um Pardon und ich bekomm doch meinen Lohn, das weiß ich schon.“ Noch einmal erklärt er seinen Beweggrund in einer sehnenden musikalischen Bewegung: „Der Hirtenbub ist schuld daran; das Alphorn hat mir’s angetan, das klag ich an.“ Ach ja, so einfach waren und sind die Gründe damals und heute. Das Schicksal tausender Desertierter, die im 2.Weltkrieg von grausamen leidunempfindlichen Militärrichtern abgeurteilt und erst vor kurzem vom Bundestag rehabilitiert wurden (die CDU war stets dagegen), kommt mir in den Sinn, wenn ich dies wehmütige Mahlerlied höre.
Am nächsten Tag Ausflug auf den Berg, der die Rigi heißt und nach Ansicht unserer Gastgeber ein Muss ist. In Goldau kaufen wir uns einen Tell-Pass (2 Tage Freifahrt, 5 Tage Halbtax), weil allein die Rundfahrt auf der Rigi 66 CHF kostet. Also mit der Zahnradbahn auf den Rigi-Kulm, den Klassiker unter den Wanderbergen bei Luzern, der viele berühmte Besucher zu verzeichnen hat, darunter Mark Twain, der darüber in seinem Reisetagebuch köstlich berichtet. Wunderbar der Rundblick vom Gipfel über die Seen, unter uns direkt der Zuger See, zur andern Seite auf die Hochalpen bis zu Jungfrau und Matterhorn. Bei klarer Sicht könnte man bis nach Freiburg, ja Straßburg blicken. Ein älterer Musikant bläst das wehmütige Alphorn, wie sagt doch der Schweizer Deserteur in Des Knaben Wunderhorn: „Zu Strasburg auf der Schanz, da ging mein Trauern an. Das Alphorn hört ich drüben wohl anstimmen, ins Vaterland musst ich hinüberschwimmen. Das ging ja nicht an.“ Er hört das Alphorn und wird von Heimweh gepackt, schwimmt durch den Rhein, wird aufgegriffen, zum Tode verurteilt und zur Hinrichtung abgeführt. Das Lied, das Mahler vertont hat, sind seine letzten Gedanken und Worte. Stockend ist der Gang der Musik. Illusionslos spricht der zum Tode verurteilte Schweizer: „Ich soll bitten um Pardon und ich bekomm doch meinen Lohn, das weiß ich schon.“ Noch einmal erklärt er seinen Beweggrund in einer sehnenden musikalischen Bewegung: „Der Hirtenbub ist schuld daran; das Alphorn hat mir’s angetan, das klag ich an.“ Ach ja, so einfach waren und sind die Gründe damals und heute. Das Schicksal tausender Desertierter, die im 2.Weltkrieg von grausamen leidunempfindlichen Militärrichtern abgeurteilt und erst vor kurzem vom Bundestag rehabilitiert wurden (die CDU war stets dagegen), kommt mir in den Sinn, wenn ich dies wehmütige Mahlerlied höre.

 Nachmittags in das Wagnersche Landhaus in Tribschen. Wunderbar gelegen am See auf einem Hügel, einfacher dreigeschossiger Bau: Wohnhaus Wagners von 1866 bis 1872 : Ort der Fertigstellung der Meistersinger an dem Erard-Flügel. Und des Siegfried-Idylls 1870 zur Taufe des Sohnes mit der berühmten Uraufführung im Treppenhaus als Überraschung für Cosima. 1938 zur Eröffnung der ersten Luzerner Festspielwochen von Toscanini dort wieder aufgeführt. Hier hat Hans Richter die Klavierauszug für Tristan hergestellt und die Partitur der Meisteringer kopiert. Hier war Nietzsche 23mal zu Besuch und verlebte glückliche Stunden der Freundschaft mit Wagner, wurde durch seine Musik quasi neugeboren, er hatte ein Zimmer im 1. Stock, wo Cosima mit den Kindern wohnte. Hier besuchte ihn der junge König Ludwig II und schlief in Wagners Arbeitszimmer. „Wohin ich mich aus meinem Haus wende, bin ich von einer wahren Wunderwelt umgeben, ich kenne keinen schönern Ort auf der Welt.“ Wohl wahr!
Nachmittags in das Wagnersche Landhaus in Tribschen. Wunderbar gelegen am See auf einem Hügel, einfacher dreigeschossiger Bau: Wohnhaus Wagners von 1866 bis 1872 : Ort der Fertigstellung der Meistersinger an dem Erard-Flügel. Und des Siegfried-Idylls 1870 zur Taufe des Sohnes mit der berühmten Uraufführung im Treppenhaus als Überraschung für Cosima. 1938 zur Eröffnung der ersten Luzerner Festspielwochen von Toscanini dort wieder aufgeführt. Hier hat Hans Richter die Klavierauszug für Tristan hergestellt und die Partitur der Meisteringer kopiert. Hier war Nietzsche 23mal zu Besuch und verlebte glückliche Stunden der Freundschaft mit Wagner, wurde durch seine Musik quasi neugeboren, er hatte ein Zimmer im 1. Stock, wo Cosima mit den Kindern wohnte. Hier besuchte ihn der junge König Ludwig II und schlief in Wagners Arbeitszimmer. „Wohin ich mich aus meinem Haus wende, bin ich von einer wahren Wunderwelt umgeben, ich kenne keinen schönern Ort auf der Welt.“ Wohl wahr! Samstag Ausflug nach Morschach, von dort mit der Seilbahn nach Stoos und herrliche zwei stündige Wanderung auf den Fronalpstock. Endlich wieder schönes Wetter, strahlend blauer Himmel. Und ein atemraubender Panoramablick auf Bergwelt und Vierwaldstättersee, der viel schöner ist als der vom Rigi. Kurzer Stopp an der hohlen Gasse in Küssnacht, Ausflug ins Konkret-Mythische. Wir gehen den uralten dunklen und gepflasterten Weg bis zur Tell-Kapelle, der erst in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts gerettet und symbolisch aufgeladen wurde. Schon erstaunlich, wie Schillers dramatische Bearbeitung des legendenhaften Stoffs, der sich in einer Chronik aus dem 16. Jahrhundert zuerst findet, einen Nationalhelden der Schweiz erzeugt – angeregt und unterstützt von Goethe, der hier war und Schiller seine Aufzeichnungen zur Verfügung stellte, vor allem die lokale Topographie. Bei Goethe, der bis zum Gotthard wanderte, ist Tell eher ein Säumer, der den Handelsweg nutzt, erst bei Schiller wird er der einsame Jäger, einerseits ein Naturmensch, Kultur und Politik sind ihm verdächtig, er handelt als Mann der direkten Aktion. Andererseits ist er ein Held mit Gottvertrauen, ich sagte es schon, er wagt es mit Gott in Extremsituationen. Gott selber ist auf der Seite Tells und der Schweizer. Er ist ein „Gott mit uns“ derjenigen, die ihre Freiheit erringen, ihre Familie verteidigen, also eng begrenzt auf die Verteidigung legitimer Rechte. Es geht um das Notwendige und Rechtliche der Hilfe für den Nächsten und der Selbsthilfe gegenüber dem Tyrannen in einem begrenzten Fall. Die beweglichen Kulissen, die im Info-Häuschen die Geschichte der Hohlen Gasse, ursprünglich Teil eines Handelswegs nach Norditalien und die Entstehung des Tell-Mythos erzählen, sind unterlegt mit der flotten Wilhelm Tell-Musik von Rossini.
Samstag Ausflug nach Morschach, von dort mit der Seilbahn nach Stoos und herrliche zwei stündige Wanderung auf den Fronalpstock. Endlich wieder schönes Wetter, strahlend blauer Himmel. Und ein atemraubender Panoramablick auf Bergwelt und Vierwaldstättersee, der viel schöner ist als der vom Rigi. Kurzer Stopp an der hohlen Gasse in Küssnacht, Ausflug ins Konkret-Mythische. Wir gehen den uralten dunklen und gepflasterten Weg bis zur Tell-Kapelle, der erst in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts gerettet und symbolisch aufgeladen wurde. Schon erstaunlich, wie Schillers dramatische Bearbeitung des legendenhaften Stoffs, der sich in einer Chronik aus dem 16. Jahrhundert zuerst findet, einen Nationalhelden der Schweiz erzeugt – angeregt und unterstützt von Goethe, der hier war und Schiller seine Aufzeichnungen zur Verfügung stellte, vor allem die lokale Topographie. Bei Goethe, der bis zum Gotthard wanderte, ist Tell eher ein Säumer, der den Handelsweg nutzt, erst bei Schiller wird er der einsame Jäger, einerseits ein Naturmensch, Kultur und Politik sind ihm verdächtig, er handelt als Mann der direkten Aktion. Andererseits ist er ein Held mit Gottvertrauen, ich sagte es schon, er wagt es mit Gott in Extremsituationen. Gott selber ist auf der Seite Tells und der Schweizer. Er ist ein „Gott mit uns“ derjenigen, die ihre Freiheit erringen, ihre Familie verteidigen, also eng begrenzt auf die Verteidigung legitimer Rechte. Es geht um das Notwendige und Rechtliche der Hilfe für den Nächsten und der Selbsthilfe gegenüber dem Tyrannen in einem begrenzten Fall. Die beweglichen Kulissen, die im Info-Häuschen die Geschichte der Hohlen Gasse, ursprünglich Teil eines Handelswegs nach Norditalien und die Entstehung des Tell-Mythos erzählen, sind unterlegt mit der flotten Wilhelm Tell-Musik von Rossini.