
Paradigmen theologischen Denkens |
Kultur des Digitalen und protestantische GestaltNotwendige AnmerkungenAndreas Mertin
Etwas anderes ist es, wenn Petra Bahr, die offiziell berufene Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), in einem Text für den Deutschen Kulturrat eine "Kultur des Digitalen" beschwört, und damit ihr Amt mit ins Spiel bringt. In diesem Falle artikuliert sich ja nicht eine Privatperson, die zufällig zudem noch evangelisch und Pfarrerin ist, sondern eine Amtsträgerin, die stellvertretend für die Institution und damit auch für die dieser Institution Angehörenden spricht. Hier kann es keine Privatmeinungen (etwa über den Status der Piratenpartei) geben, sondern hier ist die Kompetenz des Amtes gefragt. Petra Bahr spricht als Institutionsvertreterin ja quasi für alle, die als Mitglieder der Evangelischen Kirche ihre Arbeit im Bereich der digitalen Kultur bewusst auch als Teil ihrer evangelischen Existenz begreifen. Und wenn sie sich zur Kultur des Digitalen äußert, wird sie das in der Logik der evangelischen Lehre machen müssen. In irgendeiner Weise muss das, was sie hier ausführt, sich korrelieren lassen zur Existenz und zur Botschaft jenes charismatischen Wanderpredigers, der nach der Zeitenwende mit gesampelten Elementen der jüdischen Lehre neue Texte und Kontexte schuf. Das, was Petra Bahr zur Kultur des Digitalen dann ausführt, hat mit meinem Verständnis der evangelischen Gestalt kultureller Arbeit im Internet wenig zu tun. Für mich, der ich seit gut 15 Jahren meinen Standpunkt zur Kultur in evangelischer Perspektive im World Wide Web kommuniziere, spricht Petra Bahr jedenfalls nicht. Und zwar nicht deshalb, weil sie nur eine andere Ansicht vertreten würde, sondern deshalb, weil sie meines Erachtens überhaupt keine protestantische Perspektive bietet. Der Protestantismus ist einmal angetreten, gegen die Heilsexklusivität einer bestimmten Kaste die Zugänglichkeit des Evangeliums für alle möglich zu machen und durchzusetzen. Nicht mehr der mit diversen Schranken versehene privilegierte Zugang zu den Quellen, sondern die nicht vom Stand, nicht vom Kapital abhängige Unmittelbarkeit der Zugangs war das Ziel. Jeder sollte in der Schrift, in den Schriften lesen können, nicht nur eine begrenzte Gruppe von Klerikern, die allein ob ihres Status die (nicht in der Volkssprache geschriebenen) Quellen lesen durften. Das sollte nicht sein und deshalb wurden die Schranken (bis hin zur physischen Schranke des Lettners) aufgehoben. Der Luther zugewiesene „mythische Schritt“, seine Thesen nicht nur einem kleinen Kreis von Abnehmern seiner theologischen Schriften, sondern durch den Thesenanschlag der gesamten Öffentlichkeit zugänglich zu machen (sozusagen bewusst ‚Raubkopien’ zu ermöglichen, die ja dann auch zu Tausenden durch das Land zirkulierten) ist hier wegweisend. Die erste protestantische Frage ist also nicht „Wie sichern wir das Einkommen der Botschafter?“, sondern: „Wie kommunizieren wir die Botschaft möglichst umfassend?“ Petra Bahr eröffnet ihren Text mit dem Verweis auf die in Schweden erfolgte Anerkennung einer Netzgruppe als offizielle Kirche der Kopisten, die nun das Religionsprivileg der unbegrenzten Vervielfältigung kultureller Güter zu erhalten haben scheint. Nun ist dieser Verweis weniger aussagekräftig als die Verfasserin meint. Zunächst einmal reproduziert er einen Schritt, der in der analogen Kultur schon seit langer Zeit vollzogen wurde, dass man nämlich nur Religionsstatus zu erhalten braucht, um gewisse Privilegien zu genießen. (An sich ist dieser Schritt ja eher eine Kritik an den Religionsprivilegien, als eine bedenkliche Sache.) So haben die Rastafari in einigen Staaten aufgrund ihrer anerkannten Religion das Recht, Cannabis bei sich zu tragen. Und sie sind nicht der einzige Fall einer durch die Religionsprivilegierung möglich gewordenen Gesetzesaufweichung, die EKD ist (z.B. im Arbeitsrecht) selbst ein gutes Beispiel dafür. Zum anderen ist das Phänomen einer Kirche im Netz, aus dem Petra Bahr einen Teil ihrer polemischen Verve zieht, nun gar nicht so neu und schon gar nicht so aufregend. Die „First Church of Cyberspace“ gab es schon in den ersten Jahren des WWW und die erste Gemeinde (mit einem griechisch-orthodoxen Priester übrigens) gab es im Netz, bevor noch das World Wide Web überhaupt entstand. Dass das Internet und später das World Wide Web eine religiöse Aufladung besitzt, war schon denen klar, die es entwickelt haben. „Wir sind wie Götter und können darin ganz gut werden“ lautete das Motto der ersten Konferenz in den virtuellen Welten. Diese genuin technospirituelle Atmosphäre der digitalen Kultur ist also konstitutiv für das Verstehen dessen, was sich später entwickelt hat. Aber es waren nicht nur die Nerds, die diese quasireligiöse Aufladung vorangetrieben haben, auch Wissenschaftler wie der Berliner Kulturwissenschaftler Hartmut Böhme haben das artikuliert: „Die technische Form Gottes. Über die theologischen Implikationen von Cyberspace“ lautete sein Aufsatz in der Zeitschrift „Praktische Theologie“ im Jahr 1996.[1] Darin benennt er die mittelalterliche Diskussion der Eigenschaften Gottes und verweist darauf, dass diese Eigenschaften nahezu vollständig vom Internet erfüllt werden. Der Schritt, diese philosophischen Überlegungen einmal ernst zu nehmen und daraus Konsequenzen zu ziehen, ist also naheliegender, als Petra Bahr uns mit dem Verweis auf die Kopisten glauben machen möchte. Nun fragt die Kulturbeauftragte im nächsten Schritt, wer eigentlich das Kollektivsubjekt „Netzgemeinde“ sei und insinuiert etwas bizarr, diese bilde eine elitäre Kerngemeinde, die allen anderen etwas vorschreiben wolle. Wer jemals die Kultur des Digitalen im Digitalen gepflegt hat, weiß, dass das so nicht stimmt. Selbstverständlich gibt es im Netz Funktionseliten, an denen man sich orientiert. Es gibt darüber hinaus die Lautsprecher und die Leisetreter und eine große Zahl an „Followern“. Es ist eben genau so wie im realen Leben. Warum sollte es auch anders sein? Keinesfalls aber gibt es den kleinen Kreis der Verschwörer, die nun festlegen würden, geschweige denn festlegen könnten, wohin der Weg führt. Man kann im Vergleich der verschiedenen internationalen Ausgaben der Wikipedia gut studieren, wie sich die „Schwarmintelligenz“ auch kulturell diversifiziert und entwickelt. Man kann lange darüber streiten, ob einem alles gefällt, was da passiert, größere Differenzen zur analogen Kultur kann ich nicht feststellen. Petra Bahr unterstellt nun dem von ihr beobachteten Kern an Netzaktivisten, dieser habe festgelegt, dass die normalen Gesetze, die in unserer Lebenswelt gelten, im Internet keine Anwendung finden würden. Das macht sie fest an den Urheberrechten. Dazu gleich mehr. Zunächst aber sehe ich überhaupt nicht, dass diese These stimmt. Ich zähle mich selbst zu den Netz-Citoyen, die ihr Wissen weitgehend kostenlos anderen im Internet zur Verfügung stellen, dort kostenfreie Angebote machen und an Projekten wie der Wikipedia mitarbeiten. Wenn aber Leute meine Texte einfach im Netz klauen und auf ihre Seiten stellen, dann mahne ich sie ab und wenn das nicht hilft, verklage ich sie auf Unterlassung. Ein ganz normaler Vorgang, der deshalb funktioniert, weil die Gesetze im Internet selbstverständlich zur Anwendung zu bringen sind. Fraglich ist aber, wie sinnvoll manche Gesetze sind. Und eben darum wird gestritten. Zurück zum Urheberrecht. Meines Erachtens steht es der Evangelischen Kirche schlecht an, allzu laut in den Chor derer einzustimmen, die eine bessere und gerechtere Honorierung von Urhebern verlangen. Als Autor und Publizist ist es jedenfalls meine Erfahrung mit den Evangelischen Landeskirchen im Bereich der analogen Kultur, dass die Hälfte aller Anfragen mit dem Satz enden, man könne leider kein Honorar zahlen, weil man ja eine kirchliche Institution sei. Wo aber ist der Unterschied zwischen der kirchlichen Kultur der kostenlosen Inanspruchnahme von Leistungen von Urhebern und der Kostenloskultur des Internets? Und das ist nicht das einzige Beispiel. Noch jede Evangelische Akademie erbittet nach einer Tagung höflichst den Vortrag als PDF-Datei, um diese dann dauerhaft ins Netz auf die institutseigenen Seiten zu stellen. Bezahlt wird dafür nicht. Das gehört zur selbstverständlichen Kultur des Digitalen im Bereich der EKD, die ich auch für akzeptabel halte, solange man das gleiche auch anderen zugesteht. In der Sache hört sich die Verteidigung der Urheberrechte immer sehr plausibel an. Selbstverständlich soll ein Werk der Musik nicht einfach geklaut werden. Aber das ist selbst im Netz heute schon strafbar. Selbstverständlich soll ein Text nicht einfach herunter geladen und gegen den Willen des Autors oder des Verlages woanders im Netz publiziert werden. Aber auch das ist heute ohne Problem justitiabel. Schwieriger wird es allerdings schon, wenn es um Bildrechte geht. Man kopiert ja nicht das Kunstwerk von Gerhard Richter oder Paul Klee, sondern ein digitales Abbild davon, das zum Original allenfalls im Rahmen einer Ähnlichkeitsbeziehung steht. Alle Materialität des Originals ist hier verloren gegangen, der haptische Impuls verschwunden, das Sinnliche auf Erinnerungswerte reduziert. Trotzdem tun wir so, als ob es eine substantielle Beziehung zwischen Abbild und Urbild gäbe. Hier setzen meine Bedenken ein.
Genau diese Exzesse des Urheberrechtes haben dazu geführt, dass manche meinten, sich gar nicht mehr daran halten zu müssen bzw. andere Wege zu suchen. Erinnert sei daran, dass ein gewisser Teil der strittigen Texte auch so zustande gekommen ist, dass die Bürger deren Verfasser alimentiert haben, so dass sie die Texte verfassen konnten, und nun im Gegenzug darauf hingewiesen werden, sie sollen doch bitte schön auch noch die exorbitant teuren Aufsatzsammlungen der Fachverlage kaufen. Da stimmt in der Sache etwas nicht. Im analogen Bereich, um das nur schnell an dieser Stelle zu ergänzen, ist es ja nun auch nicht so, dass die Urheber angemessen entlohnt würden. Wissenschaftsverlage pflegen in dieser Frage einen ziemlich urheberfeindlichen und verwertungsfreundlichen Diskurs. Petra Bahr schiebt nun noch eine moralische Keule nach: die Urheber würden verhungern, wenn sie im Internet nicht angemessen vergütet würden. Da kann ich nur lachen. Die, die im Augenblick so laut schreien, sind nun wirklich nicht jene, die verhungern würden, wenn sie das Geld nicht bekämen. Madonnas Tiraden über Raubkopierer sind legendär. Diejenigen aber, die das Geld gut gebrauchen könnten, nutzen in aller Regel das Internet als Kommunikationskanal, um an der kostbaren Ressource Aufmerksamkeit partizipieren zu können. Petra Bahr verteidigt hier einige Privilegierte, statt zu überlegen, wie das Netz für die Verbreitung von Wissen und Kultur genutzt werden kann. Um das Selbstverständliche noch einmal zu akzentuieren: ich bin gegen Tauschbörsen, auf denen Raubkopien verbreitet werden, meine aber, dass hier die aktuelle Gesetzeslage ausreicht. Ich bin nicht der Meinung, dass der Staat und der Gesetzgeber die Vertriebswege und Verwertungsmöglichkeiten bestimmter analoger Institutionen wie den Verlagen über Maßen schützen muss. Die Verlage waren und sind notwendig, aber sie haben einen Teil ihrer Rolle überreizt und sind zum Teil überflüssig geworden (in der Verbreitung wissenschaftlicher Studien z.B.). Wenn sie das nicht erkennen, wird ihnen kein Leistungsschutzrecht der Welt helfen. Woran wir arbeiten müssen, ist die Kultur des Digitalen noch viel weiter voranzutreiben. Was Google aus durchschaubaren Gründen in den letzten Jahren auf eigene Rechnung gemacht hat – die Digitalisierung unserer Kultur – war eigentlich Aufgabe der Gesellschaft und des Staates. Man hat hier versagt und jammert nun, dass Google von seinen Aktivitäten profitieren möchte. Ja, mit Google Books oder Youtube hat Google millionenfach Urheberrecht gebrochen. Niemand kann das bestreiten. Zugleich hat Google Kulturgüter den Menschen zugänglich gemacht, die bisher nur Privilegierten zugänglich waren. Auch wenn es manchem ungerecht erscheinen mag, so müssen wir dies in eine abwägende Beziehung setzen. Als Netzbürger kommuniziere ich mit Google, sperre die Firma aus manchen meiner Arbeitsbereiche aus, aus anderen nicht. Es ist eine Win-Win-Situation. Dieses Gefühl habe ich zumindest bei einigen Rechteverwertungsvertretern aus der analogen Welt, mit denen ich zu tun habe, nicht. Dort fühlte ich mich längere Zeit abgezockt. Ein bisschen ist es so wie mit meinem örtlichen Buchhändler und Amazon. Mit meinem örtlichen Buchhändler verstehe ich mich gut, habe bestimmte Buchreihen bei ihm abonniert und tätige manche ad hoc Käufe. Aber er weiß wenig von meinem Fachgebiet, hat davon auch nichts vorrätig und macht sicher auch keine Werbung für meine Bücher. In der Welt des Digitalen, sprich bei Amazon, ist das anders. Dort gibt es eine Autorenseite, Amazon merkt sich meine Interessen und schlägt mir fachrelevante Neuerscheinungen vor. Das macht Amazon nicht aus Menschenfreundlichkeit, sondern mit dem Ziel, Gewinne zu erzielen. Aber es passt zu meinen Bedürfnissen. Vielleicht wird es irgendwann keine „analogen“ Buchhandlungen mehr geben. Werde ich das bedauern? Vielleicht – vor allem für meinen freundlichen Buchhändler in meiner Heimatstadt. Härter träfe es mich, wenn es keine Antiquariate mehr gäbe. Aber dort bestelle ich schon seit langem über das Internet, denn in meiner Heimatstadt gibt es keine Antiquariate mehr. Lange vor dem Siegeszug der Internetbuchhändler hatten meine Mitbürger beschlossen, dass Antiquariate kein schützenswertes Gut sind und keine kirchlichen Vertreter haben sich für diese eingesetzt, sondern alles dem Markt überlassen. Was kann eine protestantische Perspektive auf die digitale Kultur sein? Zunächst einmal geht es darum, die Verbreitung des Wissens und der Bildung zu fördern. In der realen Welt wird es kein Museum für Religionslehrer und Pfarrer geben – in der digitalen Kultur schon. Wir sind gerade erst in den Anfängen der Erschließung des Weltwissens für alle, die einen Internetanschluss besitzen. Aber weitgehend sind die Hemmschwellen, die Bibliotheken und Kulturinstitutionen darstellen, in der digitalen Kultur entfallen. Ein Bild von Cranach genauestens zu studieren, um den Bildaufbau begreifen zu können, statt hinter einer Chorschranke in 4 Meter Entfernung auf ein Bild zu starren, das ist ein kulturellen Fortschritt. Die Entwicklung von Begriffskombinationen in der deutschen Literatur seit ihren Anfängen unmittelbar verfolgen zu können, weil sie digital verfügbar sind, ist gegenüber der viele Monate währenden Recherche in analogen Bibliotheken ein Fortschritt. Wenn Protestantismus der Versuch ist, eine möglichst breite Basis für Kultur, Bildung und Wissen zu fördern, dann sind die Entwicklungen der jüngsten Zeit überaus begrüßenswert. Auf dem kleinen Netbook, auf dem ich im dahinrasenden ICE gerade diesen Text tippe, habe ich gleichzeitig Tausende von Büchern, Videos und Zigtausende von Bildern greifbar. Das nenne ich kulturellen Fortschritt nicht zuletzt mit Hilfe der Netzgemeinde. Bleibt noch die Frage des Mammons, die Petra Bahr so am Herzen liegt (und den Netzaktivisten angeblich nicht). Offenkundig funktionieren die Bezahlmodelle in den Welten des Internets nicht so, wie manche sich das wünschen. Aber macht es Sinn, die Nutzer im Gegenzug dazu zu zwingen? Auch auf die Gefahr hin, dass sie sich dann von den Angeboten abwenden bzw. sie einfach nicht zur Kenntnis nehmen? Kann das die Lösung sein? Heute schon sind Modelle möglich, die rigide regeln, wer auf bestimmte Güter zugreifen darf. Der Preis dafür ist ein geringerer Verbreitungsgrad. Soll der Verbreitungsgrad steigen, muss die Ökonomie zurücktreten. Ein Konzept wie das von Madonna, die Erträge aus den CD-Verkäufen geringer zu bewerten als die Erträge ihrer personalen Präsenz bei Tourneen, zeigt, dass die Künstler hier bereits experimentieren. Statt also am Überlieferten (auch das ein Gewordenes!) festzuhalten, brauchen wir alternative Wege. Sackgassen scheinen mir aus protestantischer Sicht nur jene Wege zu sein, die den Kulturzugang schmälern und die breite Masse ausschließen. Die Trennung von Amt und Person hat den Vorteil, dass Missverständnisse wie die, die EKD stünde einseitig auf Seiten der am Leistungsschutz-Interessierten, vermieden werden. Diese Position kann sie nicht einnehmen. Sie kann – gut biblisch – die Position vertreten, dass jeder Arbeiter seines angemessenen Lohnes wert ist. Dann muss sie dies überall tun – egal ob digitale oder analoge Kultur und darf nicht selbst Religionsprivilegien in Anspruch nehmen, die diese Position unterlaufen. Letztlich schlägt Petra Bahrs Kritik an der Kirche der Kopisten auf die Kirche selbst zurück: Sinnvoll wäre eine Kultur, in der es derartige Privilegien gar nicht gäbe, sondern jeder zu seinem Recht käme. Anmerkungen[1] Hartmut Böhme: "Die technische Form Gottes. Über die theologischen Implikationen von Cyberspace". Praktische Theologie, Heft 4, 1996, S. 257-261.
|
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/76/am390.htm
|
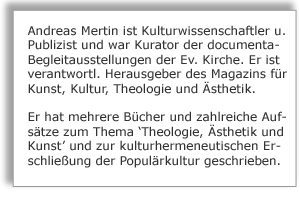 Vielleicht sollte man von vornherein Person und Amt trennen. Was P.B. als Privatperson zu den Folgen der Digitalisierung der Kultur schreibt, mag interessant sein, mag zur Stellungnahme und zum Widerspruch reizen, muss es aber nicht. Ob jemand eine stupende Unkenntnis über die Genese der digitalen Kultur und ihrer kulturgeschichtlichen Voraussetzungen offenbart, ist dann egal, wenn es sich bloß um eine private Meinungsäußerung handelt. Derartige Verwerfungen kursieren zu Tausenden in der analogen wie in der digitalen Welt und sie rufen allenfalls ein Stirnrunzeln oder ein amüsiertes Lächeln hervor, weil eine evangelische Pfarrerin sich zur Verteidigung der Kapitalströme in den Kulturwelten aufschwingt. Wenn sie meint, dass sie das muss, gut, das ist ihr höchst privates Recht.
Vielleicht sollte man von vornherein Person und Amt trennen. Was P.B. als Privatperson zu den Folgen der Digitalisierung der Kultur schreibt, mag interessant sein, mag zur Stellungnahme und zum Widerspruch reizen, muss es aber nicht. Ob jemand eine stupende Unkenntnis über die Genese der digitalen Kultur und ihrer kulturgeschichtlichen Voraussetzungen offenbart, ist dann egal, wenn es sich bloß um eine private Meinungsäußerung handelt. Derartige Verwerfungen kursieren zu Tausenden in der analogen wie in der digitalen Welt und sie rufen allenfalls ein Stirnrunzeln oder ein amüsiertes Lächeln hervor, weil eine evangelische Pfarrerin sich zur Verteidigung der Kapitalströme in den Kulturwelten aufschwingt. Wenn sie meint, dass sie das muss, gut, das ist ihr höchst privates Recht. Wozu das letztlich führt, kann man sehr gut am Fall der Kirche St. Gereon in Köln zeigen. Diese Gemeinde hat Mitte der 80er-Jahre den Künstler Georg Meistermann mit der Gestaltung der Glasfenster beauftragt und Meistermann hat dafür herausragende Arbeiten abgeliefert. Wenn die Kirchengemeinde aber heute einen Blick in ihre eigene Kirche zeigen möchte, bedarf sie der kostenpflichtigen Genehmigung der Rechteinhaber an den Werken von Georg Meistermann. Möchte sie nicht dauerhaft für das Zeigen ihres eigenen Kirchenraumes bezahlen, bleibt ihr nur eine
Wozu das letztlich führt, kann man sehr gut am Fall der Kirche St. Gereon in Köln zeigen. Diese Gemeinde hat Mitte der 80er-Jahre den Künstler Georg Meistermann mit der Gestaltung der Glasfenster beauftragt und Meistermann hat dafür herausragende Arbeiten abgeliefert. Wenn die Kirchengemeinde aber heute einen Blick in ihre eigene Kirche zeigen möchte, bedarf sie der kostenpflichtigen Genehmigung der Rechteinhaber an den Werken von Georg Meistermann. Möchte sie nicht dauerhaft für das Zeigen ihres eigenen Kirchenraumes bezahlen, bleibt ihr nur eine