
50 Jahre danach: Kunst und Kirche |
Epos oder Tragödie?Kunst-Diskurse vor 1950. Teil IIAndreas Mertin
Zur Person: Heinrich Lützeler (1902-1988) war Philosoph, Kunsthistoriker und Literaturwissenschaftler. Er promovierte 1924 über Formen der Kunsterkenntnis und habilitierte 1930 über Grundstile der Kunst. 1940 wurde er von den Nationalsozialisten mit einem Lehrverbot belegt, 1942 erhielt er Schreib- und Sprechverbot(!) für das gesamte „Großdeutsche Reich“. Publizieren konnte er danach nur noch über den Herder-Verlag für das Ausland. Nach 1945 half er beim Wiederaufbau der Bonner Universität und wurde dort zum ordentlichen Professor der Kunstgeschichte berufen. Das Buch „Die christliche Kunst des Abendlandes“ hat neben der Einleitung nur zwei Teile und eine Schlussbetrachtung. Der erste Teil beschäftigt sich mit dem „Epos der christlichen Kunst“, der zweite Teil mit der „Tragödie der christlichen Kunst“. Die Schlussbetrachtung geht über „Die Lage der christlichen Kunst in der Gegenwart“. „Das Epos der christlichen Kunst“: Die Grundstruktur der historischen Entwicklung von Kunst und christlicher Religion setzt Lützeler ähnlich wie Sedlmayr. Für das Mittelalter reserviert er das Stichwort „Christlichkeit“ und sieht dieses mit der Basilika begründet, der Romanik ausformuliert und der Gotik zusammengefasst und aufgelöst. Das Nachmittelalter steht unter dem Stichwort „Weltlichkeit“ und wird mit der Frührenaissance begründet, in der Hochrenaissance ausformuliert und löst sich im Barock auf.
Tragende Figur ist dabei, dass zumindest das Mittelalter eine weitgehende Übereinstimmung von Kunst und Religion prägt, die ihren Höhepunkt in den romanischen Kirchen hat. Sie sind nach Lützeler noch reiner Ausdruck des Christentums, nicht von Ostentation und Weltlichkeit geprägt, sondern an der Sache orientiert bzw. der Sache Religion untergeordnet. Die nachmittelalterliche Zeit dagegen orientiert sich zunehmend an weltlichen Phänomenen, sei es, dass religiöse Motive durch weltliche Momente gestaltet werden, sei es wie in der Renaissance, dass nicht-christliche Motive höher geschätzt werden als christliche. Es geht Lützeler dabei ausdrücklich nicht um eine Bewertung der Kunst, sondern um eine Darstellung unter dem Aspekt der „christlichen Kunst“. Trotzdem bekommt das aus heutiger Perspektive schon etwas merkwürdige Züge, wenn etwa über das Ausbreiten der Sexualität in der Kunst im Sinne des Verlustes der „vom Christentum lange gebändigten Geschlechtlichkeit“ geschrieben wird. Oder wenn im Blick auf die Renaissance von der „Stärkung der widerchristlichen Elemente“ in der Kunst gesprochen wird. Das für die Beschreibung des Verhältnisses von Kunst und Christentum offenkundig zugrunde gelegte Modell ist das, das die Kunst als Ausdrucksform begriffen wird, deren Gelungenheit an der Übereinstimmung mit der Theologie bewertet wird. Wenn man das theologische Modell ändert, käme man folgerichtig auch zu anderen Ergebnissen. Vor dem Hintergrund des von ihm verwendeten Schemas wendet sich Lützeler dann der „Tragödie der christlichen Kunst“ zu. Bereits mit der Auflösung der Gotik tritt die religiöse Kunst in Konkurrenz mit der säkularen Kunst. Diese entwickelt sich zwar weiter, aber eben nicht mehr im christlichen Sinne: gezeigt werden könne zwar „wie die Renaissance die selbstgenugsam in sich ruhende Diesseitigkeit preist, der Barock zu den dionysischen Untergründen des Lebens vordringt, das Rokoko den Sturm des Barocks durch Verfeinerung, Verspieltheit bändigt und bricht, der Impressionismus eine raffinierte Kultur der Sinne heraufführt“[4]. Aber diese Neuschöpfungen seien eben nicht mehr „aus christlichem Geist bestimmt“, sondern am Menschen orientiert. Für die religiöse Kunst der nachmittelalterlichen Zeit gelte, dass diese 1. geradezu nur nebenbei entstünde, 2. der Künstler vereinzelt und nicht mehr vom Gemeinschaftswillen getragen sei und 3. die Kunst selbst unsicher, suchend und gestaltlos werde.[5] Wir befinden uns bei dieser Beschreibung nicht in der Moderne, sondern in der Zeit seit der Frührenaissance, d.h. wir müssen uns mit dem Gedanken vertraut machen, dass damit z.B. auch Masaccios „Zinsgroschen“ gemeint ist. Und tatsächlich wird hier das Wunder ja auch ganz beiläufig und die Menschlichkeit in den Vordergrund geschoben, wenn nicht sogar – wie einige Interpreten vermuten – das religiöse Thema aus politischen Gründen (Erhöhung der Steuern) aufgegriffen. Schon die Frührenaissance und davor allem die nachfolgenden Abschnitte der Kunstgeschichte sind in der Perspektive einer als ideal angesonnenen perfekten Symbiose von Kunst und Christentum Teil der Zersetzungsgeschichte.
Das wird von Lützeler belegt mit der sich seit der Frührenaissance abzeichnenden Tendenz zum Geniekult, dem Vordringen des Politischen, der zunehmenden Berücksichtigung des Alltäglichen, der Verbürgerlichung der Kunst, der (erotischen) Versinnlichung und schließlich dem Verschwinden des Religiösen in der Landschaft. Dass es diese Phänomene gibt, kann gar nicht bestritten werden, irritierend ist ihr angeblicher diagnostischer Wert im Blick auf das Verhältnis von Kunst und Christentum. Zwar weist Lützeler wiederholt darauf hin, dass sich das Ganze unter anderer Perspektive anders, und das heißt positiver darstellt, aber für das Thema christliche Kunst beginnt 1420 die Verfallsgeschichte. Interessant ist der nun folgende Abschnitt über das Infernalische. Wir hatten gesehen, dass argumentativ bei Leo Fremgen und Hans Sedlmayr das Infernalische eine zentrale Rolle spielt – in beiden Fällen als negativ zu bewertendes Ereignis in der europäischen Kulturgeschichte.[6] Bei Lützeler klingt es durchaus ähnlich, wenn er schreibt: „die nun zu entwickelnde Darlegung geht von der Erwägung aus, dass dort, wo der Glaube an den begnadenden und erlösenden Gott verblasst und schwindet, die großen Zwiespalte aller Menschlichkeit grell sichtbar werden und zerstörend quälen, und misst also durch den Aufweis des Satanischen in der Kunst den Abstand der verfinsterten, in kalter Hoffnungslosigkeit erschauernden Welt von der übernatürlichen Harmonie.“[7] Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese „Erwägung“ auch nur verstehen kann – zu sehr ist man heute von der religiös aufgeladenen Sprache der damaligen Zeit entfernt.
Für Lützeler jedenfalls wird in der religiösen Kunst nach dem Mittelalter alles anstrengender und problematischer, es führt geradezu zu einer „metapysischen Ausweitung des Weltleides“.[9] Trotzdem muss man sagen, dass bei Lützeler die Kategorie des Satanischen eher eine deskriptive Kategorie ist (im Sinne etwa von Sartres „Geschlossene Gesellschaft“)[10] und nicht eine moralisch verwerfende. Vielleicht ist es so, dass ihm die (dann vom Existentialismus ausgearbeitete) Sprache für dieses Phänomen fehlt. Das abschließende Kapitel wendet sich „Lage der christlichen Kunst in der Gegenwart“ zu. Für den Historiker ist die Auseinandersetzung mit der Gegenwart immer am Schwierigsten und man merkt dem Kunsthistoriker Lützeler auch das Unbehagen an. Aber dennoch meint er, dass die „heutige religiöse Kunst noch tief verstrickt ist in die Wirrnisse des heutigen Menschen.“[11] Um dann das „Gesetz echter religiöser Zeitkunst“(sic!) auszusprechen: „Was heißt es denn eigentlich, „zeitnahe religiöse Kunst schaffen"? Es setzt voraus, daß eine neue Gottbeziehung da ist, die nach einem neuen künstlerischen Ausdruck verlangt; fruchtbar und erfüllt ist eine neue Weise des Kunstschaffens nur dort, wo der eine ewige Gott neu gefunden wurde aus der Zeit heraus. Es wurde im ersten Teil dieses Buches gezeigt, wie altchristliche Basilika, Romanik und Gotik sich aus einer jeweilig anderen Gottesbeziehung erklären. Ist auch unsere Zeit einer neuen, nur ihr möglichen und deshalb unersetzlichen Verbindung mit dem Ewigen teilhaftig geworden? Bei so strenger Befragung der Tatsachen tauchen Zweifel auf; denn der Gegenwart insgesamt ist das Zeitliche, besonders in der Form des Wirtschaftlichen, näher als das Ewige. So geraten moderne Kirchen leicht nüchtern oder, wo der Architekt mit nicht ganz ehrlichen Mitteln diesen Eindruck vermeiden möchte, theatralisch-kulissenhaft. Anderseits darf man nicht glauben, jedes Werk religiöser Kunst, das man nicht auf den ersten Blick versteht, sei schon darum Verfall: nüchtern oder theatralisch. Man muß sich um neue Kunst bemühen, zumal der heutige Mensch oft stumpfen Auges vor künstlerischen Gebilden steht.“[12] Und dann benennt Lützeler die hoffnungsvollen Aufbrüche mit Namen, die dann ganz andere Perspektiven eröffnen als Leo Fremgen und Hans Sedlmayr. Lützler nennt Thorn-Prikker, aber auch Edvard Munch, Ferdinand Hodler, Oskar Kokoschka und Wilhelm Lehmbruck. Und das sind Namen, die bei Fremgen und Sedlymayr konträr konnotiert worden sind. Für Lützeler sind es aber Künstler, die im Rahnen des von ihm skizzierten Modells für einen neuen Aufbruch stehen (könnten). Es gehört zu den nicht zu verschweigenden Umständen, dass alle Künstler, die Lützeler positiv wie auch kritisch in seinem Diskurs erörtert, auch mit Abbildungen präsentiert werden, so dass der Leser zur eigenen Urteilsbildung eingeladen ist. Und hier ist die Auswahl wirklich beeindruckend. Käthe Kollwitz, Ernst Barlach, Dominikus Böhm, Max Liebermann deuten einen Kosmos der Kunst an, der deutlich jenseits der seinerzeitigen offiziellen Linie liegt. Insgesamt ist Lützeler sicher auch noch den Fragestellungen des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts in der Begegnung von Kunst und Religion verhaftet. Ein Modell wirklicher Autonomie der Kultursphären liegt ihm fern. Trotzdem ist er offen für die säkularen Entwicklungen der Kunst, wenn ihm auch das Vokabular fehlt, anders deutend damit umzugehen. Das führt uns abschließend zur Säkularisierung der Sprache in der Beschreibung der Kunst. Heute kämen nur noch ewig Gestrige auf die Idee, das Infernalische, Dämonische, Satanische als beschreibende Sprache für die Kunst zu verwenden. Es ist, als ob Jahrhunderte zwischen diesen Äußerungen der 40er- und 50er-Jahre und heute liegen. Immerhin gelingt es Lützeler das Ganze so voranzutreiben, dass der denunziatorische Sinn der Rede von der infernalischen Kunst unterlaufen und zerstört wird. Da aber die Sprache vom „Satanischen“, „Infernalischen“, ja von der „Hölle“ heute im gesellschaftlichen Kontext jenseits evangelischer oder katholischer Fundamentalisten seines gesamten semantischen Gehalts beraubt ist, macht ihre Verwendung in beschreibenden Zusammenhängen eben auch keinen Sinn mehr. Geblieben ist dieser Sprachduktus allenfalls noch für pubertäre Computerspiele oder überholte Hollywoodschinken, nicht aber mehr für das Verstehen und Reflektieren der Gegenwart. [Das rückt freilich auch die Stücke von Sartre in eine deutliche Entfernung vom Jetzt.] Was Lützelers Buch deutlich zeigt, ist die Begrenztheit eines Modells, das letztlich in der Übereinstimmung der Kunst mit der theologischen Lehre den Ausweis für die Christlichkeit der Kunst sieht. Es ist das Verdienst der nachfolgenden Generation, damit gebrochen und neue Paradigmen entwickelt zu haben. Heute lässt sich nur noch außerhalb eines seriösen Kontextes derart konfessionell reden, wie es Lützeler noch (als Kunsthistoriker!) vermochte. Ganz lustig ist das an den Stellen, an denen die konfessionelle Bindung des Verfassers als Vorurteil durchschlägt. Etwa wenn er behauptet, eine bis in seine Gegenwart gängige Predigteröffnung reformierter Theologen laute „Ihr meine Mitverdammten“ (47f.). Verifizieren lässt sich das in der gedruckten Predigtliteratur bis 1900 nicht. Gibt man in der Google-Buch-Suche diese Formel ein, stößt man aber auf den Domprediger von Regensburg bzw. den Augustiner-Prediger von Trier, die 1845 bzw. 1847 von ihren „mitverdammten Heiden, Türken und Juden“ sprechen. Und auch ansonsten finden sich in entsprechenden Bußpredigten derartige Formulierungen. Die „Düsternis“ den Reformierten zuzuordnen dürfte eher ein katholisches Klischee sein. Die nächste Generation an Kunsthistorikern wird sich radikal von der konfessionellen und religiösen Bindung lossagen und gerade in der Freisetzung der Kunst deren Beitrag zur Geschichte der Menschheit entdecken. Sie wird die Autonomie positiv beerben. Anmerkungen[1] Fremgen, Leo (1942): Kunst und Schöpfung. Ethik der Kunst. Gütersloh: Bertelsmann. [2] Sedlmayr, Hans (1948): Verlust der Mitte. Die bildende Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts als Symptom und Symbol der Zeit. [1. Aufl.]. Salzburg: Müller. [3] Lützeler, Heinrich (1939): Die christliche Kunst des Abendlandes. 5. Aufl. Bonn: Verlag der Buchgemeinde. Lützeler, Heinrich (1936): Die christliche Kunst Deutschlands. 3., neubearb. Bonn: Verl. der Buchgemeinde. [4] Ebd., S. 130f. [5] Ebd., S. 142. [6] Vgl. Verf., Gott oder Satan? Kunst-Diskurse vor 1950. Teil I, Magazin für Kunst | Kultur | Theologie | Ästhetik, Heft 71. [7] Lützeler, Heinrich (1947): Die christliche Kunst des Abendlandes, S. 202 [8] Ebd., S. 213 [9] Ebd., S. 208 [10] Sartre, Jean-Paul; König, Traugott; Wroblewsky, Vincent von (2009): Geschlossene Gesellschaft. Stück in einem Akt. 47. Aufl. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt. [11] Lützeler, Heinrich (1947): Die christliche Kunst des Abendlandes, S. 225. [12] Ebd., S. 225f. |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/71/am351.htm
|
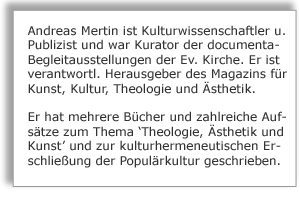 Es gehört für mich zu den faszinierenden Phänomenen, dass bei durchaus ähnlicher Terminologie und natürlich gleichen historischen Umständen man dennoch zu völlig anderen Ergebnissen kommen kann als Leo Fremgen (Kunst und Schöpfung
Es gehört für mich zu den faszinierenden Phänomenen, dass bei durchaus ähnlicher Terminologie und natürlich gleichen historischen Umständen man dennoch zu völlig anderen Ergebnissen kommen kann als Leo Fremgen (Kunst und Schöpfung Lützeler, Heinrich (1939): Die christliche Kunst des Abendlandes. 5. Aufl. Bonn: Verlag der Buchgemeinde.
Lützeler, Heinrich (1939): Die christliche Kunst des Abendlandes. 5. Aufl. Bonn: Verlag der Buchgemeinde.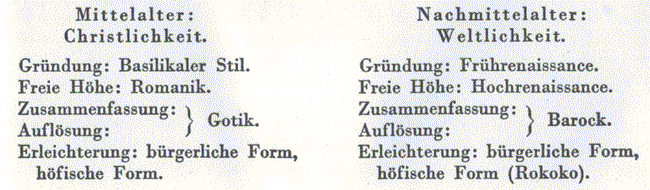

 Wenn ich mir jedenfalls die Höllendarstellung im Hortus Deliciarum der Äbtissin von Hohenburg Herrad von Landsperg aus der Zeit zwischen 1175 und 1195 ansehe, einem religiösen Belehrungsbuch für Nonnen, dann kann ich so gar nicht den Glauben an den begnadenden und erlösenden Gott darin erkennen, sondern sehe vor allem die in kalter Hoffnungslosigkeit erschauernde Welt. Wenn es die in diesem Kapitel ausgeführte Grundthese bei Lützeler ist, „dass früher das Göttliche mildernd in die Hölle eindrang, während jetzt die Hölle zerstörerisch in das Menschliche eindringt“
Wenn ich mir jedenfalls die Höllendarstellung im Hortus Deliciarum der Äbtissin von Hohenburg Herrad von Landsperg aus der Zeit zwischen 1175 und 1195 ansehe, einem religiösen Belehrungsbuch für Nonnen, dann kann ich so gar nicht den Glauben an den begnadenden und erlösenden Gott darin erkennen, sondern sehe vor allem die in kalter Hoffnungslosigkeit erschauernde Welt. Wenn es die in diesem Kapitel ausgeführte Grundthese bei Lützeler ist, „dass früher das Göttliche mildernd in die Hölle eindrang, während jetzt die Hölle zerstörerisch in das Menschliche eindringt“