
Gefühl(e) |
UntugendenWas kann und darf Kirchenkritik heute?Andreas Mertin
Grafs Buch entfaltet sich gut theatralisch in einen Prolog, sieben Akte und einen Epilog. Die sieben Akte benennen jeweils ein Defizit – Graf nennt das Untugend (angesichts der Siebenzahl könnte man natürlich auch von Lastern sprechen) – das sich bei der Kirche bzw. den Kirchen beobachten lasse und er vermutet, dass diese Untugenden in der Summe die verursachenden Faktoren für den Vertrauensverlust der Institution Kirche sind. Ich glaube, dass das auch zutreffend ist, hätte mir aber eine grundsätzliche Reflexion darüber gewünscht, ob der Bedeutungszerfall der Institutionen, der gesamtgesellschaftlich zu beobachten ist und nicht nur die Kirchen betrifft, nicht auch ein, wenn nicht sogar der zentrale Faktor ist. Sprachlosigkeit - Graf beschreibt die protestantische Wort- und Schriftkultur und zeigt, wie in den letzten Jahrzehnten der Protestantismus in seiner Kultpraxis eine Verlagerung von der Schriftkultur zur Symbolkultur vollzieht. Tatsächlich ist das einer der dramatischen Akte im jüngeren Protestantismus. Nicht sicher bin ich bei der von Graf aufgenommenen Zuschreibung des Protestantismus als Wortkultur. Ich halte sie für nicht tief greifend genug. Ich glaube vielmehr, dass der Protestantismus eine höchst komplexe Bewegung vollzogen hat. Er hat die Kultpraxis stärker am Wort orientiert, aber die individuelle Praxis nicht vom Bild und Symbol befreit. Das protestantische Individuum interessiert sich durchaus mehr als das katholische für Bilder und Symbole – nur trennt es das strikt vom Kult und es pflegt einen differenten Umgang mit Bildern und Symbolen. So wie Graf zu Recht auf die Vielzahl von Literaten verweist, die protestantischen Pfarrhäusern entsprungen sind, könnte man ja auch mal schauen, wie viele der zeitgenössischen Künstler aus dem Umfeld protestantischer Pfarrhäuser kommen. Und man wäre über das Ergebnis überrascht. Der Protestantismus, so würde ich sagen, ist eine Religion mit einer lebensweltlich ausdifferenzierten Kultur. Unbestreitbar aber ist, dass seit gut 30 Jahren dieser kulturell ausdifferenzierte Reichtum im Protestantismus schwindet. Und das ist nicht mit sogenannten Predigtkompetenzzentren der EKD zu heilen, sondern beschreibt eine grundsätzliche kulturelle Sprachlosigkeit, die es nicht mehr vermag, etwas anderes auszudrücken als das Eigene im Fremden. Die Sprachlosigkeit ist Ausdruck einer gestörten Wahrnehmungsfähigkeit. Wenn Thies Gundlach schreibt, jedes kulturelle Engagement der Kirche müsse von einem missionarischen Impuls getragen sein, dann ist das präzise der Ausdruck des Sprachlos-Werdens der Institution Kirche. Bildungsferne – Als ich das erste Mal vor 15 Jahren in einer Pfarrkonferenz auf einen jungen Pfarrer stieß, der mit einem gewissen Stolz von sich erzählte, er habe gerade bei meinem Vortrag zum ersten Mal etwas von Hieronymus Bosch gehört, dachte ich zunächst an die sprichwörtliche Ausnahme von der Regel eines gebildeten Pfarrerstandes. Und immer noch würde ich vertreten, dass die evangelischen Pfarrer eine wohltuende Alternative in ihrer Bildungsbeflissenheit zu vielen anderen akademischen Berufsgruppen darstellen. Jedenfalls wissen Pfarrer in aller Regel mehr über die Kultur als die säkulare Kultur über Religion. Dennoch würde ich Graf darin zustimmen, dass es eine Tendenz gibt, die besagt, dass das Interesse für Kultur im Pfarrberuf privatisiert wird. Es ist sozusagen ein höchst privates Hobby des Pfarrers, wenn er sich für Literatur, Musik oder Bildende Kunst interessiert und nicht teil seiner Berufsbeschreibung. Diese Akzentverschiebung muss Ursachen haben. Offensichtlich ist der Link zwischen kultureller Bildung und Pfarrerexistenz nicht mehr evident – den Gemeinden und den Pfarrern nicht. Auf der anderen Seite entwickelt der Protestantismus auch insgesamt keine Selbstreinigungskräfte, wenn es zum Beispiel neuerdings Kirchenvertreter gibt, die die Botschaft expressis verbis zugunsten einer Wohlfühlkirche (sei es eine Rosenkirche, die so schön duftet oder einer Lichterkirche, die so schön leuchtet) aufgeben wollen. Vorreflexive Religiosität hat einen Stellenwert bekommen, die dem Protestantismus unangemessen ist. Moralismus – Hier führt Graf gute Argumente an, die es verbieten, das Ganze nur mal eben zu erörtern oder beiseite zu schieben. Gerade angesichts von PID oder den Patientenverfügungen macht er Gesichtspunkte stark, die aus dem Kern des Protestantischen kommen und deshalb dringend erörterungsbedürftig sind. Dazu zählt vor allem sein Hinweis auf die Rechte des Individuums. Auch sein Hinweis, dass wir im Interesse ökumenischer Gemeinsamkeiten zunehmend bereit sind, naturrechtliche Argumente vorzutragen – die sich dann der gesellschaftlichen Debatte vorordnen sollen – ist aufzunehmen und zu diskutieren. Demokratievergessenheit – Hier scheint Graf zunächst die schwächeren Argumente zu haben, denn war es nicht gerade der Protestantismus, der in Krisensituationen immer wieder Demokratie fördernde und fordernde Gesichtspunkte eingebracht hat? Graf verweist am Beispiel der Umwälzung in der DDR selbst darauf und ich meine, es gäbe gute Gründe, hier die Bilanz etwas positiver einzuschätzen. Ich hätte „Demokratievergessenheit“ nicht zu den Untugenden der Evangelischen Kirche gezählt. Aber ich muss zugeben, dass es Erfahrungen gibt, die Graf unmittelbar Recht geben. Als ich in dieser Zeitschrift einen Evangelischen Bischof als autoritär bezeichnete, weil er sich geweigert hatte, ein von ihm abgegebenes 20minütiges Statement im Rahmen einer Tagung einer Evangelischen Akademie kritisch zu erörtern, schrieb er mir einen Brief, indem er mich als nicht ernst zu nehmend und unzurechnungsfähig bezeichnete. Tatsächlich war er der Ansicht, dass Bischöfe ihre Statements nicht zu diskutieren bräuchten. Mit einer evangelischen Haltung hat das aber auch rein gar nichts zu tun. Wer als prominenter Kirchenvertreter sein Credo verkündet, so schreibt Graf, muss sich seinerseits kritisieren lassen und er fährt fort: „Zur Idee des demokratischen politischen Diskurses passt es nicht, wenn einzelne Akteure, beispielsweise führende Kirchenvertreter, für ihre öffentlichen Sprechakte den Anspruch erheben, man dürfe sie nicht kritisieren“ (87). Man muss nicht so weit gehen wie Rawls, auf den Graf verweist, der meint, Repräsentanten der Kirchen „dächten aufgrund ihrer Glaubensprämissen und dogmatischen Bindungen strukturell autoritär und seien aufgrund ihres weltanschaulichen Absolutheitsanspruchs weder zu rationaler Verständigung fähig noch zu pragmatischer Konsenssuche bereit.“ (89) Aber es gibt unverkennbar diese Tendenz. Selbstherrlichkeit – Im Prinzip überschneidet sich diese „Untugend“ mit der vorhergehenden. Allerdings füllt Graf diesen Abschnitt weitgehend mit der Auseinandersetzung mit neueren Tendenzen der katholischen Kirche (wie ich übrigens überhaupt die Zuschreibung, er kritisiere vor allem die evangelische Kirche nicht teilen kann – er schreibt über „die Kirchen“, er beschreibt „die Kirchen“ und er meint „die Kirchen“). Zukunftsverweigerung – Das ist das für mich spannendste Kapitel in der Lektüre gewesen, weil es mich selbst auch am stärksten in Frage gestellt hat. Zunächst einmal ist es eine fundamentale Auseinandersetzung mit Dietrich Bonhoeffer und zugleich das entschiedene Plädoyer für mehr Liberalität in der theologischen Debatte. Es ist dies zugleich das Kapitel, in dem Graf – anders als es seine Kritiker unterstellen – die breit angelegte Frömmigkeitskultur der Volkskirche vehement verteidigt. Denn Kritik an Bonhoeffer, aber auch an den konservativ-lutherischen Theologen ist vor allen Dingen Kritik an deren Homogenitäts-Träumen, an deren Einheitsdenken. Und hier bin ich geneigt, Graf in Analyse und Diagnose zu folgen. Vielleicht in meinem Fall weniger aus theologischen Einsichten, als vielmehr aus kunstgeschichtlich-ästhetischen Einsichten. Das Betriebssystem Kunst zeigt sehr präzise, wie erfolgreich Gemeindebildung durch Differenzerzeugung (Bazon Brock) sein kann. Und es setzt dabei konsequent auf Individualität bei gleichzeitigem Vertrauen auf das Funktionieren der Systeme. Und – um auf den kritischen Aspekt in Grafs Beschreibung zurückzukommen – tatsächlich haben Teile der Leitungssysteme der Evangelischen Kirche ein Problem mit dem Pluralismus. So schnell wie gesellschaftlich die Postmoderne entdeckt wurde, so schnell wurde sie von der Kirche unter dem Stichwort der Abwehr der postmodernen Beliebigkeit verabschiedet. Gemeint war aber gar nicht die Postmoderne, sondern der moderne gesellschaftliche und religiöse Pluralismus. Und gerade die neueren Bestrebungen der evangelischen wie der katholischen Kirche können ja eher als Konformitätsbestrebungen beschrieben werden. Nicht sicher bin ich mir, ob das tatsächlich zu einem Vertrauensverlust der Bevölkerung (und nicht nur bestimmter Milieus) führt. Ich vermute, dass ein Großteil der Bevölkerung eher an einer konformen, also einheitlich auftretenden Kirche interessiert ist. Nur der Preis, den die Kirche dafür bezahlen müsste, wäre unermesslich hoch: ihr gingen alle kreativen Geister (verstanden als zur Dissidenz neigendes Milieu) verloren. Ein Vorgang, den Graf zutreffend am Beispiel der jungen Theologiestudierenden beschreibt. Sozialpaternalismus – Ich vermute, dass die Skizzierung dieser „Untugend“ größere Teile der Kirche bis ins Mark trifft. Letztlich konstatiert Graf hier „erstaunliche Kontinuitätslinien zum alten autoritären Sozialpaternalismus“ (155f.). Sein Vorwurf lautet: alles Ideologie, seine Antwort: mehr Professionalisierung. Er führt das natürlich viel ausführlicher und präziser aus, aber letztlich geht es darum. Nicht ob einer der gleichen Ideologie anhängt (also z.B. den ACK-Kirchen angehört), sondern wie er die Arbeit macht, ist entscheidend. Und jeder Leser wird sofort an Martin Luthers entsprechende Lehren erinnert, an die Hochschätzung des „weltlichen Berufes“ des Christen wie Graf schreibt. Epilog – Hier akzentuiert Graf noch einmal die These, wie wichtig die Gemeinde-Pfarrer als Vermittlungspersonen sind. Dies ist der Punkt, an dem ich ihm nicht folgen kann. Zum einen ist die Gegenübersetzung von seelsorgerischen Gemeindepfarrern auf der einen Seite und bürokratischen übergemeindlichen Pfarrstellen Unsinn. Krankenhausseelsorger etwa haben mit Menschen in ganz spezifischen Lebenssituationen zu tun, mit denen auch gut ausgebildete Gemeindepfarrer hoffnungslos überfordert sind. Krankenhausseelsorger begleiten Menschen in zentralen Lebensprozessen und sie haben eine Kasualpraxis in einem eminent theologischen (und eben nicht nur formalen Sinne), die die der Gemeindeseelsorger bei weitem übersteigt. Es geht in der Kasualpraxis eben nicht nur darum, Leute unter die Erde zu bringen, sondern im Sterben zu begleiten – und das ist der theologische und seelsorgerliche Alltag von übergemeindlichen Krankenhausseelsorgern. In der Familienberatung lässt sich Analoges beschreiben. Wer mit der Ausdifferenzierung der Moderne geht, wer Professionalisierung anstrebt, muss dies meines Erachtens eben auch für den Pfarrberuf anstreben. Der Pfarrer als Generalist ist seit dem 19. Jahrhundert überholt. Die längste Zeit in ihrem Leben werden Menschen in Deutschland in der Schule mit Religion konfrontiert. Wenn ich in der Lektüre nicht geschludert habe, dann geht Graf nur in einer – positiven – Seitenbemerkung auf die Unterrichtenden des Faches Religion ein. Sind sie aber nicht im gleichen Maße wie Gemeindepfarrer professionelle Religionsvermittler? Landauf, landab wurden in Deutschland die Stellen für Schulreferenten, die kirchlicherseits das Gespräch mit den Religionsunterrichtenden suchten, gestrichen. Summa summarum, ich halte nichts von Lösungen, die das Gemeindepfarramt gegen das übergemeindliche Pfarramt ausspielen. Wir haben sicher sehr viele übergemeindliche Pfarrstellen und Amtsstellen, bei denen man fragen kann, wo sie denn noch der Begegnung mit den Menschen dienlich sind. Aber das sollte nicht dazu führen, die Professionalisierung an der entscheidenden Stelle abzubrechen. Bei aller Wertschätzung für den Hausarzt – ohne Fachärzte geht es nicht. Ich kannte einen guten Teil der in diesem Buch veröffentlichten Texte aus der regelmäßigen Lektüre deutscher Feuilletons und hatte sie mir auf der Festplatte meines Computers entsprechend auch abgespeichert. Trotz ist es gewinnbringend, Grafs Interventionen noch einmal gebündelt zu lesen. Seinen Impetus hat er im Prolog des Buches unter Bezug auf die jüngere Kirchengeschichte so beschrieben:
Und das ist ihm gelungen. Und damit könnte ich meine Vorstellung des Buches abschließen, gäbe es nicht die eingangs beschriebenen Reaktionen der Kirchenvertreter auf sein Buch. Noch bevor das Buch überhaupt von den Lesern gelesen werden konnte, suchten diese es madig zu machen. Und der Stil und der Tonfall war so ungeheuerlich, wie ich es in der öffentlichen theologischen bzw. kirchlichen Debatte im letzten Vierteljahrhundert nicht mehr erlebt habe. Und nachdem ich das Buch nun gelesen habe, frage ich mich, welches Buch eigentlich Thies Gundlach und Petra Bahr gelesen haben, dass sie zu solchen Invektiven greifen und vor allem solche Denkverbote beschwören. Thies Gundlach wirft ein „Das ständige Schwarzsehen in Grafs Buch ‚Kirchendämmerung’ sei völlig überzogen“. Von einem ständigen Schwarzsehen kann allerdings gar keine Rede sein, eher ist es doch kritische Gegenwartsbeschreibung. Gundlachs Begründung für das abwertende Urteil: „Grafs Philippika aber geht in meinen Augen am Kern vorbei: Wir haben eine "Krise des Gottesbewusstseins" … und es gehört selbst zur Trivialisierung des Evangeliums, wenn man alle Austrittszahlen und alle Relevanzverluste auf schlechte Prediger zurückführt. Etwas mehr Theologie hätte man sich schon gewünscht von einem so klugen Menschen. Aber Graf bleibt seit Jahren stecken bei der Kritik an der Institution, was man auch daran erkennt, dass das Buch zumeist ältere Arbeiten versammelt.“ Ich glaube, das könnte man zurecht einen Kassandra-Vorwurf nennen. Aber seit dieser mythologischen Erzählung wissen wir auch, dass jemand, der wiederholt Kritisches vorbringt, deshalb noch nicht Unrecht haben muss. Ganz im Gegenteil. Und in der sachlichen Zusammenfassung ist es schlichtweg falsch. Nicht einmal ansatzweise führt Graf „alle Austrittszahlen … auf schlechte Prediger zurück“. Da wäre es besser gewesen, Gundlach hätte das Buch wirklich einmal studiert, statt uns mit Phrasen abzuspeisen wie den folgenden: „Gibt man also die Rolle des ‚Moralapostels der Libertinage’, weil man jede ethische Positionierung schon für Anmaßung hält, ist man natürlich umzingelt von Moralisten. Und gibt man den Überflieger-Professor, ist man schnell eingekreist von Trivialitäten.“ Man muss nun als Leser das Gefühl haben, Graf habe eine Moral der Libertinage propagiert und sich als Überflieger-Professor inszeniert. Diese Zuschreibung hat nichts mit den Inhalten des Buches zu tun. Petra Bahr wird – wie noch gleich zu zeigen sein wird – die entsprechenden Analysen von Graf als zutreffende Analysen charakterisieren (und sie, nicht er, spricht denunziatorisch von rosaroten Lilifeepredigten). Die implizite Charakterisierung von Friedrich Wilhelm Graf als „Überflieger-Professor“ dient offenkundig nur der Beförderung eines verbreiteten Ressentiments gegen Intellektuelle und der Abwehr der Notwendigkeit, sich mit Argumenten auseinanderzusetzen. Die Verachtung der Intellektuellen, die darin zum Ausdruck kommt ist erschreckend. Und dann geraten wir vom Feld der Denunziation ins Feld der Projektion: „Aber solange Graf in dieser so larmoyant wirkenden Tonlage über seine Kirche und ihre Theologie schreibt, wird er kein Gehör finden. Das ist auch schade, denn kritische Diskurse haben noch keiner Institution geschadet, Verrisse aber sind wirkungslos.“ Wenn das wirklich so wäre, hätte Gundlach sich sicher nicht geäußert. Man müsste ja schon dumm sein, wollte man wirkungslosen Texten Publizität verleihen. Aber da er weiß, dass es nicht stimmt, und weil er Angst vor den Folgen der Analyse hat, möchte er am liebsten, dass Graf „kein Gehör findet“, möchte er gerne, dass dieser wirkungslos bleibt. Aber das hätte er nur gerne, hier wird der unfromme Wunsch kein Gehör finden. Die „Damnatio memoriae“, um die es hier intentional geht, geht glücklicherweise an den medialen Realitäten vorbei. Weitaus schlimmer als die knappen im Interview vorgebrachten Äußerungen von Thies Gundlach sind die schriftlichen Ausführungen von Petra Bahr in der ZEIT-Beilage „Christ & Welt“ 09/2011, in der sie als Kolumnistin und Kulturbeauftrage der EKD eine Replik zu den Thesen von Graf vorbringt.
Werbetechnisch nennt man das den gesunden Biss. Man sagt einen Satz „ach ja, der Herr Professor Dr. Besserwisser“ und kann sich den Rest schenken. Dietz Bering ist in seiner einschlägigen Studie „Die Intellektuellen. Geschichte eines Schimpfwortes“ diesem Verfahren nachgegangen und wer in dem Index seines Buches das Wort Besserwisser nachschlägt, wird schnell fündig. Die denunziatorische Rede von den Besserwissern war ein Spezifikum von Goebbels in der Form des „besserwissenden Intellektuellen“ oder „intellektuellen Besserwissers“ und sollte deshalb heute nicht mehr geführt werden, auch nicht in der Verklausulierung des „Herrn Professor Dr. Besserwisser“. Es ist widerlich. Das Ressentiment richtet sich aber eben auch gegen das Akademische an sich, warum sonst sollte man das „Professor Dr.“ sonst so herausstellen? Das zerstört die Substanz unserer Kultur. Wenn die Überschrift nicht von der Kulturbeauftragten der EKD formuliert wurde (was ich hoffe), sollte sie das in der nächsten „Christ & Welt“ klarstellen und sich davon distanzieren. Wenn die Überschrift von ihr stammt, sollte sie überlegen, was zu tun ist. Es gibt – auch in der Sprache – Grenzen, die man als Kulturbeauftragte der EKD nicht überschreiten darf. Mit Kultur Beauftragte zu sein, heißt eigentlich, die Kultur zu fördern. Und diese Kultur besteht nun gerade auch in der sorgsamen Förderung der kritischen Kompetenz der Intellektuellen und in der fachlichen Kompetenz von Professoren. Was den Inhalt ihrer Ausführungen betrifft, so ist er von einer merkwürdigen Ambivalenz getragen. Wenn man es genau nimmt, sagt sie, Friedrich Wilhelm Graf hat recht – schließlich stellt ein guter Teil ihres Textes bloß eine zustimmende Paraphrase der Äußerungen von Graf dar. Dann fügt sie aber hinzu: Graf sei selbst für die Misere verantwortlich, er sei schließlich Professor der Theologie. Selbst wenn man Theologieprofessoren so in die Pflicht nehmen wollte, nähme das der Kritik ja keinesfalls ihre Brisanz. Weiterhin müsste die Kirche klären, wie sie die von Graf beschriebenen Probleme angehen will. Diese simplifizierende Zurückweisung der Kritik im Sinne von „Du bist doch selbst daran schuld“ bzw. „Du bist doch Mittäter“ wird aber wohl kaum einer ernstnehmen. Zu offenkundig ist es, dass die Vertrauenskrise der Kirchen an den Universitäten zwar beschrieben, nicht aber verursacht wurde und auch nicht gelöst werden kann. Selbstverständlich sind auch die Universitäten ein Teil des Problems; das wird aber an keiner Stelle des Buches von Graf bestritten - ganz im Gegenteil. Aber sich der Herausforderung zu entziehen, indem man den Kritiker zum Angeklagten macht ist doch etwas billig. Ansonsten aber ist Petra Bahrs Replik ein schönes Beispiel für die Wahrheit der Ausführungen von Friedrich Wilhelm Graf, sie ist ein Musterfall von Sprachlosigkeit, Bildungsferne, Moralismus, Demokratievergessenheit, Selbstherrlichkeit, Zukunftsignoranz und Sozialpaternalismus. Dazu nur ein paar Stichworte: Zur Sprachlosigkeit kann man mit gutem Recht die sprachlichen Entgleisungen zählen, die Petra Bahr sich leistet, etwa wenn sie Friedrich Wilhelm Graf als Wutprofessor mit roten Flecken im Gesicht imaginiert. Ich weiß, dass sie auf das neudeutsche Modewort des Wutbürgers anspielen will, nur leider geht diese Assoziation völlig daneben, so dass die sprachliche Analogie zum „Hassprediger“ viel greifbarer wird. Und dann wird es höchst problematisch. Wutbürger begehen nämlich keine „Pöbelei höherer Ordnung“, die Bahr expressiv verbis Graf unterschiebt, sondern das machen Hassprediger. Zur Sprachlosigkeit gehören aber auch sprachliche Gedankenlosigkeiten wie folgende: „An den theologischen Fakultäten wird zwar mit ungebremstem Schaum über die Lage der Kirche hergezogen; aber man fühlt sich für nichts verantwortlich“. Wenn man den Satz auf seinen Kern reduziert, versteht man, was die Verfasserin damit sagen will („An den theologischen Fakultäten wird zwar über die Lage der Kirche hergezogen; aber man fühlt sich für nichts verantwortlich“) – auch wenn ich bestreiten würde, dass es zutrifft. Aber was um Gottes Willen soll der Lyrismus mit dem ungebremsten Schaum? Wenn es keine versteckte Werbung für das Waschmittel Persil sein soll, von dem sich die Sprachfloskel aus den 60er-Jahren bis in die Gegenwart erhalten hat, was sagt es uns dann?
Was hat das nun mit dem Verhältnis von Fakultäten und Kirchen zu tun? Die Fakultäten sollten lieber mit gebremstem Schaum Kirche kritisieren? Ist es allzu verwegen zu vermuten, die Assoziation mit dem Schaum sei hier hineingerutscht, weil man an „Schaum vor dem Mund“ und Tollwut dachte? Wäre das aber nicht infam? Im besten Falle bezeichnet Petra Bahr die Evangelischen Fakultäten in Deutschland als Schaumschläger. Aber damit sollen die sich auseinandersetzen. Ich erspare mir und den Lesern weitere Sprachanalysen, aber vielleicht kann mir ja noch einmal ein Germanist schreiben, was der Satz „Wie eine feuchte Decke liegt ein gigantischer Vertrauensverlust über dem verfassten Christentum“ bedeutet. Was er bedeuten soll, weiß ich natürlich, nicht aber, was die Autorin da zu Papier bringt. Feuchte Decken entziehen dem Körper Wärme – soviel ist klar. Das kann ganz gut sein, wenn wir Fieber haben, ist aber schlecht, wenn wir uns draußen in der Kälte befinden. Hat die Kirche nun Fieber oder befindet sie sich eher in der unwirtlichen Kälte? Wenn ich böse wäre, würde ich vermuten, dass am Anfang da stand: die Kirchen unterliegen einem Vertrauensverlust. Von „unterliegen“ kommt man dann zu „liegen unter“ und von da aus zur Decke. Und da es eine schlechte Decke ist, unter der man da liegt, ist es eben eine feuchte. Und die Vertrauenskrise ist ja was Schlechtes, das der Kirche Wärme entzieht. Aber ist die Vertrauenskrise nicht eher entstanden, weil die Kirche schon lange an Wärme verloren hat? Wie auch immer, stimmig wird das Ganze vermutlich nie, weil es keine metaphorische Beziehung von Vertrauensverlust und feuchten Decken gibt. Und sage mir keiner, das Ganze sei doch bloß eine kühne Metapher. Kommen wir zur Bildungsferne. Eine der wichtigsten Erkenntnisse, die man an Universitäten vermittelt bekommt, ist die notwendige Distanz zum Untersuchungsgegenstand. Fans sind schlechte Wissenschaftler. Die wissenschaftliche Distanz muss alle Loyalitätsverpflichtungen aufheben. Deshalb garantiert das Grundgesetz die Freiheit von Forschung und Lehre. Selbstverständlich bleiben Wissenschaftler an Recht und Gesetz gebunden, aber ansonsten sind sie nur der Wahrheit verpflichtet. Petra Bahr fordert von Graf aber etwas anderes, nämlich Verzicht auf Distanz und stattdessen Loyalität zur Kirche. Sie schreibt, nachdem sie Graf eine „verstörend distanzierte Haltung“ vorgeworfen hat: „Die Haltung der ostentativen Abgrenzung von der verfassten Kirche ist deshalb nicht nur illoyal, sie ist auch fahrlässig.“ Unter Bildungsferne würde ich auch den Satz rechnen, „die Kunst theologischer Auslegung der Gegenwart beherrschen eben nur Theologinnen und Theologen“. Das glaube ich nicht. Selbstverständlich können auch Kulturwissenschaftler und viele andere die Kunst theologischer Auslegung der Gegenwart beherrschen. Die Bibel ist voll von Gestalten, die nicht Theologie studiert haben und doch als Gotteslehrer auftreten. Und auch kirchengeschichtlich werden wir schnell fündig. Und selbst die Universitätsgeschichte kennt solche Crossover. Wenn ich mich recht erinnere, macht niemand Charles Darwin seine Verdienste im Fach Biologie streitig, obwohl er doch nur Theologe war. Das sollte umgekehrt auch nicht geschehen. Seien wir doch offen für die theologischen Auslegungen von Kulturwissenschaftlern und anderen Zeitgenossen. Auch Moralismus im Sinne eines zur Geltung gebrachten vordiskursiven Beurteilungsvermögens lässt sich konstatieren. „Der Vertrauensverlust in die Kirche ist durch das Verstummen öffentlicher Theologie, die ihren Namen verdient, mindestens ebenso befördert worden“ schreibt Petra Bahr. Abgesehen davon, dass Friedrich Wilhelm Graf nun gerade zu jenen gehört, die im Sinne öffentlicher Theologie nicht verstummt sind, sondern sich wirklich unermüdlich zu Wort melden und offenkundig auch gehört werden, abgesehen davon irritiert mich der eingeschobene Zwischensatz. Wer entscheidet darüber wer den Namen ‚öffentliche Theologie’ verdient? Offensichtlich ist nicht alle öffentliche Theologie verstummt, sondern nur die, die ihren Namen verdient. Und wer trifft diese Unterscheidung? Jene, die dann dekretieren, das sei doch alles nur Schwarzseherei, die kein Gehör findet? Ich vermute, wenn den Damen und Herren eine öffentliche theologische Äußerung nicht passt, ist es eine öffentliche Theologie, die ihren Namen nicht verdient. Auf jeden Fall aber ist sie Schuld an der Krise der Kirche. Das leitet über zur Selbstherrlichkeit. Man merkt natürlich, dass manche sich zutiefst getroffen fühlen und was Du nicht willst das man dir tu’, das füge flugs den andern zu: „Unter Weltfremdheit, Eitelkeit und Betriebsblindheit leiden offenbar auch die Gelehrten.“ Da wird kaum ein Stereotyp ausgelassen, es fehlt nur noch der biblische Elfenbeinturm. Selbstherrlich finde ich auch folgende Belehrung: „Ein wenig mehr Demut, sich dann und wann an die eigene Nase zu fassen, anstatt immer nur den anderen eine solche zu zeigen, das stünde der theologischen Zunft gut zu Gesicht.“ Selbstverständlich macht sich Humilitas immer gut, bei wem auch immer. Aber theologisch verwenden wir den Begriff im Mensch-Gottes-Verhältnis und darum geht es hier nicht. Die Demut, die eingefordert wird, ist die gegenüber der Institution Kirche. Ich weiß nicht, ob ich es unter Zukunftsignoranz fassen soll, wenn Bahr dem Kritisierten im Blick auf die Lösung der Probleme Dinge unterstellt, die dieser explizit anders angegangen ist. Natürlich stößt sich Graf an der ungebrochenen Frömmigkeit mancher Theologiestudierender, weil sich daran zeigt, dass sie kein wissenschaftliches, kein professionelles Verhältnis zu ihrem Studiengegenstand entwickeln. Ein ähnliches Phänomen können wir im Augenblick bei Studierenden der Islamwissenschaften beobachten, die dachten, es handele sich um eine bessere Koranschule und nicht um eine Disziplin der Wissenschaft. Aber zu suggerieren, Graf tabuisiere die Frömmigkeit in der Kirche, stellt die Dinge auf den Kopf. Graf fordert gerade eine pluralistische Ausformung der Kirche, die unterschiedliche Frömmigkeitsstile zulässt. Nur von den Theologen fordert er Professionalität im Umgang damit. Und dazu gehört auch, zur eigenen Frömmigkeit in ein professionelles Verhältnis zu treten. Zumindest ein Muster für eine sozialpaternalistische Denkstruktur ist es, wenn Bahr sagt: Schimpft nur über die Kirche, ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt, denn wenn es euch dreckig geht, werdet ihr doch wieder angekrochen kommen. Das ist die Sprache der Macht, die nur mühsam verdeckt, was man eigentlich mit den Kritikern machen möchte. Wenn man die polemischen Sprachstile vergleicht, die ja beide Seiten charakterisieren, dann fällt auf, dass die Polemik von Graf sachorientiert ist, während die Gegenpolemik von Gundlach und Bahr ad personam in einem bewusst verletzenden Stil geführt wird. Es geht nicht darum, eine vielleicht aus ihrer Sicht unzutreffende Kritik abzuwehren, sondern es geht darum, Friedrich Wilhelm Graf als Kritiker zu diskreditieren. Von all den Untugenden ist diese Untugend der verweigerten Kommunikation und Herabsetzung des Gegenübers langfristig die schlimmste. Sie decouvriert die Evangelische Kirche als reinen Machtapparat. |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/70/am349.htm
|
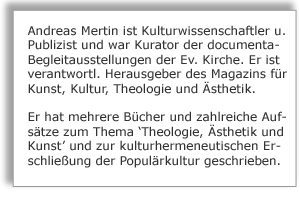 Es ist schon interessant: wenn Friedrich Wilhelm Graf für die Thesen seines jüngst erschienenen Buches „
Es ist schon interessant: wenn Friedrich Wilhelm Graf für die Thesen seines jüngst erschienenen Buches „
 Und das Ungeheuerliche dieses Textes beginnt schon mit der Überschrift: „Herr Professor Dr. Besserwisser“. Darf man daran erinnern, wann die Unkultur solcher Sprachwendungen begonnen hat? Sie begann mit der Dreyfus-Affäre und fand ihren Höhepunkt als es gelang, den Begriff der Kritik, des Intellektuellen und der Wissenschaft so restlos mit Ressentiments zu füllen, dass es reichte, nur „Professor“ zu sagen, um auf ein negatives Gefühl rechnen zu können. „Besserwisser“ zu schreiben und sich gemein zu machen mit jenen, denen ob ihrer strotzenden Kraft nichts besseres einfällt, als den Klassenprimus zu verprügeln, das ist barbarisch.
Und das Ungeheuerliche dieses Textes beginnt schon mit der Überschrift: „Herr Professor Dr. Besserwisser“. Darf man daran erinnern, wann die Unkultur solcher Sprachwendungen begonnen hat? Sie begann mit der Dreyfus-Affäre und fand ihren Höhepunkt als es gelang, den Begriff der Kritik, des Intellektuellen und der Wissenschaft so restlos mit Ressentiments zu füllen, dass es reichte, nur „Professor“ zu sagen, um auf ein negatives Gefühl rechnen zu können. „Besserwisser“ zu schreiben und sich gemein zu machen mit jenen, denen ob ihrer strotzenden Kraft nichts besseres einfällt, als den Klassenprimus zu verprügeln, das ist barbarisch.