
Ästhetische Andacht |
Die Gnade der ZeichenEin theologischer Blick auf Marcel Prousts „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“Walter Schöpsdau „Gott ist schrecklich abwesend im Werk Marcel Prousts“, urteilte François Mauriac in seinem Nachruf von 1922. „Schon vom literarischen Standpunkt ist dies seine Schwäche und seine Grenze; das menschliche Gewissen ist abwesend.“[1] Für den Katholiken Mauriac besteht ein Zusammenhang zwischen der Abwesenheit Gottes und dem Mangel an moralischem Bewusstsein, der allgegenwärtigen Homosexualität in den Beziehungen der Gestalten Prousts und der Zerrüttung jeder Liebe durch Eitelkeit und Eifersucht. Gravierender noch: niemand in der Recherche scheint daran zu denken, Gott zu suchen. Der Pfarrer von Combray interessiert sich für Spuren christlicher Vergangenheit in der Etymologie der Ortsnamen, aber nicht für Theologie. Der Gottesdienstbesuch der Guermantes ist Tradition einer adeligen Familie; von Gott wird nicht gesprochen, auch nicht beim Tod der Großmutter oder der Geliebten Albertine. Die „Essenz der Dinge“[2], deren Betrachtung sich der Erzähler sich in schlaflosen Nächten hingibt, scheint mit der Frage nach Gott nichts zu tun zu haben. Von der Gottesfrage ist die Poesie gelebter Religion zu unterscheiden, die an der Kindheitserinnerung des Erzählers wesentlichen Anteil hat und mit ihrem Verhältnis zur Zeit das Suchen und Finden der verlorenen Zeit präludiert. Die Kirche von Combray, die als einziges vierdimensionales Bauwerk der Stadt auch die Zeit einschließt, strukturiert mit ihrem Glockenschlag und ihrer Liturgie den Tageslauf der Tante Léonie und den Ablauf des natürlichen Jahres. In der Maiandacht entdeckt der Erzähler seine Liebe zum festlich gekleideten Weißdorn, der ihm als geradezu „katholisches Gewächs“ erscheint, wie denn überhaupt die kirchlichen Feste als die einzig wirklichen Feste gelten, da sie nicht wie die weltlichen in einem bloßen Zufallsverhältnis zur Zeit stehen. Auch persönlich brachte Proust der Religion eine positive Wertschätzung entgegen, ohne dass seine letzte Überzeugung eindeutig erkennbar wäre. Seine Anordnung auf dem Sterbebett, dass ihm der Rosenkranz, den eine Jugendfreundin aus Jerusalem mitgebracht hatte, in die gefalteten Hände gegeben werde und ein mit ihm befreundeter Abbé die Totengebete sprechen sollte[3], bewegt sich auf der Linie des gesellschaftlich Üblichen, kann aber auch mehr sein als bloße Form. Er liebt die Kathedralen Frankreichs, die als einzige noch ihrer ursprünglichen Bestimmung dienen und ohne die Feier von Leib und Blut Christi „kein Leben mehr in ihnen“ hätten[4]. In der aufgeheizten Atmosphäre vor der Trennung von Kirche und Staat (1905) beklagt Proust den aggressiven Antiklerikalismus, unter dem auch der Pfarrer von Illiers-Combray („der mir Latein und die Namen der Blumen in seinem Garten beigebracht hat“) zu leiden hatte, und zeigt sich besorgt über die Zukunft des Christentums in Frankreich. Ob hinter der kulturell motivierten Einstellung auch eine Glaubensüberzeug steht, muss angesichts einer späteren Briefstelle zumindest offen bleiben, die ironisch vom Himmel spricht, „an den wir beide leider nicht mehr glauben“ [5]. Die Reflexionen des Erzählers über ein „unbekanntes Vaterland“ des Künstlers und die Unsterblichkeit der Seele im letzten Band der Recherche kommen ohne den Gottesgedanken aus. Die Abwesenheit der Gottesfrage bei gleichzeitiger Präsenz von Religion ist allerdings auch durch die Romanperspektive bedingt, die alle Realität in die Poesie der Erinnerung taucht, weshalb die Recherche auch an den philosophischen Debatten, die in den Salons geführt werden, keinen argumentativen Anteil nimmt. Die Erinnerungsperspektive relativiert alle Geltungsansprüche bis auf den Anspruch der Kunst auf Wiedererweckung des Vergangenen, dem der final mit dem Erzähler verschmelzende Autor ausführliche Überlegungen widmet. Was zu einer theologischen Lektüre der Recherche einlädt, ist die Selbstdeutung des Erzählens und seiner Methode. Der Ich-Erzähler deutet seine Geschichte als „Geschichte einer unsichtbaren Berufung“[6] zum Schriftsteller, die ihm erst nach vielen Jahren, die er in der Erinnerung als verlorene Zeit durchläuft, deutlich wurde. Da die Erinnerung des Protagonisten nach Auskunft Prousts[7] ein fiktives Element darstellt, konvergieren Erzähler und Autor erst gegen Ende, wo sich der Erzähler entschließt, das Werk zu beginnen, das der Autor in diesem Augenblick zu Ende bringt. Ist die Recherche somit keine Autobiographie – Hinweise auf eine mögliche Identität des Ich-Erzählers mit dem Autor wurden von Proust erst nachträglich eingefügt – so erzählt sie doch in den prospektiven Passagen des letzten Kapitels seine Sorge, in der verbleibenden Lebenszeit durch die Niederschrift des Werkes den herannahenden Tod zu überflügeln. Kontingenz als Ausweis von AuthentizitätIn gewisser Weise erzählt jede Erzählung diese Sorge[8]. Sinnbestimmtes Leben ist nur kraft einer allein narrativ antizipierbaren Ganzheit denkbar. Obgleich weder meine Geburt noch mein Tod Teil meiner Erzählung sein können und auch sonst ganze Abschnitte meines Lebens zur Geschichte anderer gehören, gewinnt es Bedeutung nur dadurch, dass die Erzählung mich zum Mit-Autor meines Lebens macht. Sinnstiftend für den Protagonisten der Recherche ist das johanneische Wort vom Weizenkorn, das ihm „das grausame Gesetz der Kunst“ enthüllt, dass aus dem Leiden und Sterben des Künstlers das „Gras des ewigen Lebens sprießt, der derbe, harte Rasen fruchtbarer Werke, auf dem künftige Generationen heiter, ohne Sorge um die, die darunter schlafen, ihr ‚Frühstück im Freien’ abhalten werden“[9]. Zugleich ist das Kunstwerk, dem er seine verbleibende Zeit opfern wird, „das einzige Mittel, die verlorene Zeit wiederzufinden“, und „das wahre Jüngste Gericht“ über sein Leben[10]. Für den Leser ist die Sorge, mit der der Erzähler angesichts seines noch zu schaffenden Werkes auf seine sterbliche Zukunft blickt, durch die Existenz des Buches, das er in Händen hält, überholt und – schöne Paradoxie – gegenstandslos geworden. Das eben noch seine Sorge erzählende Ich ist im Autor schon am Ziel. In Prousts Entscheidung, nach dem ersten Kapitel sofort das letzte niederzuschreiben, um in jahrelanger Arbeit die Distanz zu füllen, findet der Blick des Glaubens etwas von der Zuversicht, dass die Wege des besorgten Ich zu seiner nur antizipativ gegebenen Identität sich von Gott her immer schon als Wege im Ziel erweisen. Allerdings darf die Kontingenz nicht übersehen werden, an deren dünnem Faden die Rettung der Erzählung durch den kranken Autor in der empirischen Wirklichkeit hing. Das Kunstwerk könnte auch nicht sein. Seine Kontingenz ist nicht nur die des Anfangens überhaupt, mit der es in Analogie zur göttlichen Schöpfung tritt, sondern auch die Bedingtheit durch körperliche Verfassung und bei Proust die Evokation durch unverfügbare Zeichen, in denen sich die Wirklichkeit, „unser wahres Leben“, enthüllt. Gerade die Kontingenz der Begegnung steht für die Notwendigkeit dessen ein, was sie zu denken gibt[11], ein Merkmal, das auch vom religiösen Offenbarungsbegriff nicht zu trennen ist.
Das Erlebnis der durch sinnliche Zeichen ausgelösten mémoire involontaire – eine in Tee getauchte Madeleine erweckt im Erzähler die Erinnerung an den Geschmack jener Madeleine, die ihm als Kind seine Tante am Sonntagmorgen anzubieten pflegte – lässt das Wesen wieder lebendig werden, das er damals war, und versetzt den Erzähler in ein als Grund tiefer Freude empfundenes „außerhalb der Zeit“[15]. Der privilegierte Augenblick erweckt einen sinnlichen Eindruck, der zwei zeitlich getrennte Ereignissen miteinander verbindet, und setzt durch das „Wunder der Analogie“ aus Gegenwärtigem und Vergangenem ein Wirkliches frei, das gleichwohl nicht dem Augenblick angehört und nach Bewahrung in der absoluten Zeit des Kunstwerks ruft. Was die „Authentizität“ der Erkenntnis verbürgt, ist gerade die Kontingenz ihres Aufleuchtens, die Gewalt des Eindrucks, den keine bewusste Anstrengung des Geistes herbei zu zwingen vermag. Der Erzähler glaubt das „außerhalb der Zeit“ durch eine Schreibweise festhalten zu können, die mittels der Metapher[16] ein verbindendes Allgemeines so erkennbar macht, wie es im Gnadenerlebnis der mémoire involontaire erfahrbar wurde. Mit ihr ist die Suche nach einem Bleibenden jenseits der Vergänglichkeit abgeschlossen, sodass der Erzähler mit dem Schreiben der Recherche beginnen kann. Dabei sind es nicht die gesellschaftlichen Zeichen oder die Zeichen der Liebe, sondern die stofflichen Zeichen, die sich am unmittelbarsten einer Entzifferung in den immateriellen Zeichen der Kunst darbieten[17]. Wenn der Erzähler nach einem „philosophischen Gegenstand“ für ein literarisches Werk gesucht hatte, fühlte er sich ohnmächtig; seinem Geist war durch die Eindrücke von Formen, Düften oder Farben die „Arbeit“ auferlegt, „zu erfassen, was sich hinter ihnen verbarg“[18]. Drei Bäume rufen ihn an, sie nicht wieder ins Nichts sinken zu lassen, denn „was du heute von uns nicht erfährst, wirst du niemals erfahren“, und „ein ganzer Teil deiner selbst, den wir dir bringen konnten, wird für immer verloren sein“[19]. Aber erst ein weiteres Erlebnis der mémoire involontaire im Hof des Guermantesschen Palais befähigt ihn, im Wettlauf mit dem Tod sub specie aeternitatis die spirituelle Wahrheit der Zeichen zu lesen und so das einzig wahre Buch, das bereits in uns existiert, zu übersetzen und uns zu Lesern unserer selbst zu machen. Die gesellschaftlichen, die erotischen und die sinnlichen Zeichen sind Zeichen von Zeit, die man verliert und verloren hat, aber in den sinnlichen Zeichen des unwillkürlichen Gedächtnisses lässt die Zeit sich wiederfinden, wenn Kunst die jeweilige Essenz der Erfahrungen freisetzt[20]. Sie sind Leben, das auf die Offenbarung der Kunst vorbereitet und wiederum ohne die Kunst nicht in seine Wesen verständlich wäre. Es geht der Recherche nicht um Vorführung des unwillkürlichen Gedächtnisses; sie ist „Bericht von einer Lehre“ und als solche auf Zukunft gerichtet[21]. In der Suche des Ichs nach seiner vergangenen Existenz, die ihm vor der Erleuchtung als verlorene Zeit erschien, entspringt kontingent, ab extra ausgelöst eine Gegenbewegung, in der das Werk seine zukünftige Existenz sucht und das Ich sein überzeitliches Wesen findet. Die Zirkelbewegung vom Werk zur Berufung, die sie erzählt, und von der Berufung zum Werk, das sie hervorruft, ist selbst die Botschaft, eine Botschaft der Kontingenz auch des Kunstwerks, das seinen letzten Anstoß dem quasi-eschatologischen Gehalt eines einzigen Augenblicks verdankt. In der Zirkularität und Unabschließbarkeit des Werkes, das sich als Geschichte der Berufung zu ihm präsentiert, ist die Struktur religiöser Erwählung erkennbar: Freiheit existiert nicht als fixe Größe, sondern im Anruf einer Befreiung, die ihre Geschichte erzählen muss. Was sich als wahre Wirklichkeit erschließt, ist nicht angebbar ohne den Akt des Aufbruchs zu ihr, ohne eine Geschichte von verlorener und wiedergefundener Zeit. Allerdings führt die in der Recherche verkündete Poetik der Metapher als Transportmittel von Wahrheit leicht auf eine falsche Spur. Die Deutung der abstrakten Analogisierung zweier Eindrücke als ekstatische Erfahrung der Ewigkeit scheint den Erzähler in einen Philosophen zu verwandeln, dem sich im letzten Moment die einzige Tür zur Wahrheit öffnet und das Rätsel der Zeit in einem nunc stans auflöst. Tatsächlich bedarf der evokative Schlüsseleindruck aber eines Schreibens, das die Erfahrung befreit und in Worte des Buches in uns überträgt. Da Erfahrung an einen Kontext gebunden ist und Schreiben eine Sukzession von Gedanken- und Handlungsimpulsen verlangt, kann das Werk nicht bloß aus ohnehin seltenen Impressionen nach Art der Madeleine-Episode schöpfen; es muss sich auch auf die Veränderungen im Zeitablauf beziehen und zum Gesellschaftsgemälde werden[22]. Faktisch geht die Schreibweise der Recherche über eine „Teleologie, die mit einem ‚Wesen’ der Dinge im Bunde steht“, hinaus und nähert sich „einer potentiell unendlichen Metamorphose“[23]. Die vom Erzähler behauptete ontologische Macht der Metapher weicht einem Verfahren des Autors, bei dem sich die jeweils gefundenen Metaphern vielmehr direkt aus dem Erzählkontext ergeben[24]. Diese semiotische Struktur ist auch dem Denken eingeschrieben, sofern es seine ontologische Wahrheit nicht durch Vergleich mit der intendierten Wirklichkeit überblicken kann, sondern als Weiterdenken ‚horizontal’ an anderes Denken anschließt und durch Aufdeckung von Übergängen und Aufweis von Anschlussmöglichkeiten zwischen Gedanken seinen Lebensbezug erweisen muss[25]. Selbst der Gehalt der Rede von Gott lässt sich nicht vorab durch eine Theorie der – sei es metaphorischen oder der apophatischen – Sprachform sicherstellen, sondern nur in kontextbezogener Anknüpfung an vorausgehendes Reden von Gott zur Sprache bringen[26]. Denn das Denken hat Gott immer nur als das Zeichen ‚Gott’, das ihm aus anderen Lebenszusammenhängen zugespielt und von ihm im Übergang zu anderen Zeichen gedacht wird. Die ‚vertikale’ Frage, wie Gott ins Denken kommt, beantwortet sich für christliche Theologie durch Rekurs auf eine Lebensform, in welcher die in der Geschichte Jesu Christi erschlossene Erfahrung unbedingter Nähe Gottes eine Transformation der Gottesrede und eine christologische Grammatik ihres Bildergebrauchs erzeugt, die aber darauf angewiesen bleibt, dass Gott nur zusammen mit dem Leben, dessen letzter Horizont er ist, auftritt und sich daher nicht als solcher und für sich thematisieren lässt [27]. Der Realitätsgehalt der Gottesrede ist folglich auch nicht vorab durch die Dialektik eines autonomen, selbstreflexiven Subjekts zu sichern, wie es in subjektivitätstheoretisch ansetzenden Fundamentaltheologien vorausgesetzt wird. Ob von einem ‚starken’ Subjekt dieser Art die Rede sein kann, ist selbst eine durch die Recherche aufgeworfene Frage. Intermittierendes Ich und vokative Identität
Das Ich empfindet nicht nur seine soziale Identität als „eine geistige Schöpfung der anderen“, sondern erlebt auch sich selbst als eine „intermittierende Persönlichkeit“[29], weil ihm die Inhalte des Gedächtnisses, an denen ihm seine Identität aufgehen würde, nicht jederzeit zur Verfügung stehen. Was ihm die Intelligenz als Vergangenheit liefert, ist die „Wahrheit der Vergangenheit“ nicht[30]; es fehlt als das Zeichen ihrer Echtheit das Nicht-Gesuchte und die innere Zwangsläufigkeit der von der mémoire involontaire gewährten Impression. In der Bindung an sinnliche Zeichen – Bücher etwa werden mit der Atmosphäre des Tages ihrer Lektüre erinnert – manifestiert sich eine Kontingenz, die den Geist durch Umstände beeinflussbar macht wie die Pflanze. Daraus schließt der Erzähler, dass sich die Vergangenheit außerhalb des Machtbereichs des Geistes in irgendeinem stofflichen Gegenstand verbirgt, in einer mehr oder weniger lang anhaltenden Vergessenheit, dank der allein wir von Zeit zu Zeit das wiederfinden können, was wir gewesen sind. Da es einzig vom Zufall abhängt, ob das Ich diesem Gegenstand und damit seiner Vergangenheit vor seinem Tod begegnet oder nicht, gibt es viele Wahrheiten, die ihm für immer verloren gehen. Durch die diskontinuierliche, nicht kausal oder temporal zu verstehende Abfolge von moi successifs[31] wird die Unsterblichkeit ebenso zum Problem wie die Liebe. Wir bilden keine einheitliche, für alle gleiche Substanz heraus und wissen selbst nicht, welches unser wahres Ich ist, das wir in einem anderen Leben sein möchten. Wir glauben etwas außer uns zu lieben, während das geliebte Wesen „in mehr oder weniger flachen Schichten unseres Inneren“ lebt, und übersehen, dass unsere Liebe sich aus einer Abfolge von Liebes- und Eifersuchtszuständen zusammensetzt, die die Illusion einer Einheit gewähren. Mit dem erotischen Augenblick, der die Person Albertines aus ihrem zufälligen Kontext löst und das Begehren weckt, ihr Geheimnis kennenzulernen, beginnt eine Sukzession imaginierter Albertinen, in welcher „die wirkliche Albertine“ nur am Anfang vorkommt, und sich auch der Protagonist entsprechend wandelt, je nachdem, welche der Gestalten er in sich heraufbeschwört. Das Vermögen, „zehn Albertinen“ wie aus einem Etui die in ihm enthaltenen Möglichkeiten eine nach der anderen hervorzuziehen, bedeutet Erkenntnis- und Lustgewinn, weil das Mögliche wie in der aristotelischen Poetik mehr Erschließungskraft besitzt als das Wirkliche und Liebe eine Erweiterung und Vervielfältigung des Ichs bedeutet, „die wir als Glück bezeichnen“[32]. Ihr „subjektiver Charakter“[33] macht sie zum Laboratorium, in welchem Gefühle und Handlungen – da ohne notwendigen Zusammenhang mit der geliebten Person – sich auch mit einer anderen verbinden könnten. Selbst der Tod der Geliebten bedeutet keine große Veränderung, da die Gedanken der Liebe sich immer schon in ihrer Abwesenheit formten, und der eigene Tod verliert sein Grauen, da der Erzähler mit dem Ende jeder Liebe schon viele Tode gestorben ist. Als vorgestellte erwecken die Geliebten die Liebe des Protagonisten, aber in ihrer Gegenwart findet er nichts in ihnen, was seiner Liebe glich und sie erklären konnte. Einzig vor der schlafenden Albertine kann er sich dem Traum der Liebe überlassen und muss nicht mehr an der „eigenen Oberfläche“ leben[34]. Wachend dagegen und „in unseren Händen“ wird die Geliebte zur „Ewigfliehenden“[35], die uns der Wunsch, sie zu besitzen, erst recht entzieht. Der Liebende erfährt sich als Gefangenen der Geliebten, die er zu seiner Gefangenen gemacht hat, ihrer Möglichkeiten und Geheimnisse; über ihren Tod hinaus ist seine Liebe mit Misstrauen geschlagen. „Man liebt nur, was man noch nicht vollkommen besitzt“[36], und muss zuletzt doch erkennen, dass man das „Unrecht“ beging, die Geliebte nicht „in sich selbst zu begreifen“[37]. Lebenspraktisch und moralisch ist eine Liebe, die einzig das eigene Ich erweitert um den Preis der Entpersönlichung der Geliebten, unmöglich. Es darf nicht vergessen werden, dass auch sie ihren Ort in der Romanfiktion hat: Auch die Liebe ist im Innenraum des Ichs angesiedelt, das sich nicht auf der Suche dem wahren Wesen des anderen, sondern nach der verlorenen Zeit befindet: „Liebe ist Raum und Zeit, dem Herzen fühlbar gemacht“[38]. In der Subjektivität des Ich verschmilzt die Gestalt der Geliebten mit Erinnerungen an Orte und Landschaften, wogegen ihre reale Vergangenheit den Nachforschungen des Protagonisten das Wesen der Geliebten gerade nicht freigibt. Sein Leiden versetzt ihn allerdings in ein ‚extra nos’ (hors de soi-même) und bringt ihm so „das Leben der anderen“ näher. Auch die Diskontinuität des Ich bildet zunächst ein Element der Romanerzählung, das den theologischen Gedanken der creatio continua psychologisch abwandelt. An die Tradition des nach-cartesischen französischen Okkasionalismus ist zu denken, der den Zeitfluss in eine Folge von Jetztpunkten auflöst, in denen Gott unmittelbar in jedem Augenblick das Zusammenspiel der materiellen und der geistigen Substanz im Menschen bewirkt und die Welt immer neu erschafft. Die allerdings nicht abweisbare Frage nach einem moi individuel identique et permanent, das seinerseits Bezugspunkt und Träger der moi successifs wäre, beantwortet sich im „Schöpfungsakt“ der Kunst, denn „das absolute Ich der Kunst umfasst alle Ichs“[39]. Der Frevel der Freundschaft besteht in einem Übergriff auf das Hoheitsgebiet der Kunst, weil sie – darin ernsthafter als die Liebe – einem fremden Wesen den Teil unserer selbst opfert, der anders als durch das Mittel der Kunst nicht mitteilbar ist. Liebe und Freundschaft dürfen in der Erzählung der Recherche nicht leisten, was dem performativen Akt des Erzählens vorbehalten bleibt. Auch die intermittierende Persönlichkeit ist weniger konstatierbares Faktum als Postulat der Erinnerungspoetik. Liebe als ein Teil unserer Seele, der die nacheinander absterbenden Ichs überdauert, muss sich von den einzelnen Geliebten wieder ablösen, um das „Allgemeingültige“ herauszustellen und den Sinn dieser Liebe „dem universalen Geist zu schenken“[40]. Als Erzähler breitete das Ich die Ohnmacht seiner Diskontinuität aus, um sich im angerufenen und antwortenden Autor zu restituieren. Mit Kategorien Ricœurs[41] formuliert: Die auf der idem-Ebene in Frage stehende Unveränderlichkeit des Ich findet ihre Antwort in der Selbst-Ständigkeit des im Anruf hervortretenden ipse. Derridas Feststellung: „Ich zerstöre das Subjekt nicht, ich situiere es“[42] benennt den gleichen Vorgang: Nur wenn die Möglichkeit des Subjekts nicht vorhersehbar ist, kann es sich selbst als ein Subjekt konstituieren, das sich selbst bedingungslos riskiert[43]. Die Konstitution der Ich-Identität nicht über eine Selbstzuschreibung, sondern über die Berufung zum Werk, führt in die Nähe der theologischen Einsicht in die externe Konstitution des Ich, das nicht substanzhaft gegeben ist, sondern seine Identität aus der Berührung durch die Geschichte und die Anrede Gottes empfängt. Nach der zugespitzten Auffassung Luthers wird die Person im Glauben durch die Gottesbeziehung sogar konstituiert[44]; die aktive göttliche Relektüre des Menschen bringt zugleich eine materiale Offenheit nach vorn an den Tag, die den Menschen dieses Lebens zur pura materia Dei ad futurae formae suae vitam[45] macht. Während der biblisch-theologische Begriff der „Seele“ den Menschen in seinem Angesprochensein durch Gott bezeichnet und zu einer relationalen Rekonstruktion der Metaphysik der Geistseele nötigt, bleibt die Recherche bei einem sensualistisch getönten Substantialismus der Seele stehen, um in der verwandelnden Begegnung des Ich mit den Zeichen einen möglichen Zugang zum Unsterblichkeitsgedanken zu finden. Die Episode der drei Bäume zeigt das Ich der Recherche als ‚schwaches’ Subjekt, das die Wahrheit über sich selbst nicht ohne den Umweg über die Zeichen erfährt. „Etwas erinnert mich an mich selbst. Allerdings erinnert es mich in eins damit an das, was ich in der Begegnung mit ihm hätte werden sollen. Das Selbst ist als das des Anderen zugleich mein eigenes. Eben dies, dass die Unterscheidung von Subjekt und Objekt, von Innenwelt und Außenwelt ihre Trennschärfe verliert, deutet auf einen Überstieg über Welt schlechthin: Unwillkürliche Erinnerung enthüllt sich eine Zeit, die nicht mehr die Zeit dieser Welt ist“[46]. Im Akt der Berufung gibt das Ich der Recherche antwortend, was es von Hause aus nicht hat. Seine „responsive“[47] oder „vokative“[48] Identität realisiert eine unmögliche Möglichkeit und instantiiert die fundamentalsemiologische Regel, dass die Bedingung der Möglichkeit eine Funktion ihrer Unmöglichkeit darstellt. Kunst als TranszendenzerfahrungDie religiöse Konnotation des Geschehens von Anruf und Antwort zeigt sich darin, dass sich das Außen nicht – wie bei Levinas – im anderen Menschen bezeugt, sondern vorethisch im Zeichen einer eucharistischen Kommunion mit Gebäck und Tee. Die Muschelform der Madeleine, die so „sinnenfroh“ wirkt unter ihrem „strengen, frommen Faltenkleid“, weist auf die spirituelle Pilgerfahrt der Recherche voraus; ihr Name lässt die geheimnisvolle Macht der Auferweckung anklingen. Nur „drei oder viermal“ geschah es, dass das auf diese Weise im Erzähler „neu erweckte Wesen“ von etwas kosten durfte, was „vielleicht sehr wohl der Zeit entzogene Fragmente des Daseins waren“. Es bliebe allerdings bei einem bloßen „Vergnügen“, wenn der evozierende Augenblick nicht in die Ausdrucksarbeit der Kunst überginge, zu welcher etwa dem Kunstliebhaber Swann die Kraft fehlte. Da er das Glück, welches das kleine Thema der Sonate ihm anbot, zu seinem Liebeserlebnis in Beziehung setzte, es aber nicht im künstlerischen Schaffen zu finden vermochte, starb er wie viele andere, „bevor die für sie gemachte Wahrheit ihnen enthüllt worden war“[49]. Was affektive Zufallsbegegnungen des gegenwärtigen mit dem vergangenen Ich in der Recherche auslösen, kann daher nicht vom Akt des Schreibens isoliert werden. Nicht die mémoire involontaire für sich, sondern die Poesie der Erinnerung hebt die Tyrannei der Zeit auf und berührt das verlorene – und eben deshalb wahre – Paradies der Wirklichkeit. Ohne transformierende „Wiederschöpfung“ (recréation) der Eindrücke[50] würde das Wesen nicht in Erscheinung treten, das sich in uns von der Essenz der Dinge nährt; nun aber findet die Sorge um den Tod ein Ende, „weil in diesem Augenblick das Wesen, das ich zuvor gewesen war, außerzeitlich wurde“ und daher der Zukunft unbesorgt gegenüberstand. „Eine aus der Ordnung der Zeit herausgehobene Minute hat in uns, damit er sie erlebe, den von der Ordnung der Zeit freigewordenen Menschen wieder neu erschaffen“[51]. Durch ihre Deutung der Zeichen vermag die Kunst jene Einstellung des Besitzstrebens zu verändern, welche die Liebe unmöglich machte. Endet die Liebe mit einem Scheitern der Inbesitznahme, der Vereitelung des Habenkönnens, so konfrontiert die künstlerische Aufgabe mit einem fremden Anspruch, der schon das Habenwollen durchkreuzt[52]. Doch liegt nicht auch in der Sprache der Metapher eine possessive Tendenz? Wenn sie zwischen zwei Objekten oder Empfindungen eine qualitative „Beziehung“ herstellt und durch „das unbeschreiblich wirksame Band einer Wortverbindung“ „ihre Essenz“ den Zufälligkeiten der Zeit entreißt und wenn diese Beziehung in der Welt der Kunst dem Kausalnexus in der Welt der Wissenschaft entsprechen soll, scheint die Metapher das Besondere nur im Allgemeinen, das Fremde im Eigenen und so überall ein Identisches finden zu wollen. Andererseits beansprucht die metaphorische Schreibweise Merkmale, die auch einer theologischen Metapherntheorie wichtig sind: Sie ist ansprechend und entdeckend, bezieht den Leser kreativ ein und hilft die Wirklichkeit, von der wir entfernt leben, wiederzufinden; solche Rückführung auf unser wahres Leben ist schmerzvoll und erfordert Mut, da sie die Vernichtung aller Illusionen über die Objektivität einschließt. Unser eigenes, nicht beobachtbares Leben wird uns vor Augen gerückt, sei es dass die Kunst unserem eigenen Anteil am Eindruck eines Weißdornbuschs nachgeht oder in einer Wendung wie ‚Sie war sehr lieb zu mir’ die darunter liegende Wahrheit ‚Sie zu küssen hat mir Vergnügen gemacht’ entziffert. Während aber das Gleichnis Jesu selbst Ereignis ist, weil das, wovon die Rede ist – das Himmelreich –, in die Rede selbst eingeht und den dadurch Angesprochenen in seiner Existenz neu bestimmt[53], fällt nach der Theorie der Recherche das Ereignis in die vorsprachliche Analogie der Eindrücke, zwischen denen die Metapher als tertium comparationis ein Allgemeines, die „Essenz“ freisetzt. Die Essenz existiert insofern zwar nicht außerhalb des formulierenden Subjekts, aber sie wird ausgedrückt nicht als eine Essenz des Subjekts, sondern des Seins bzw. des Seinsbereichs, der sich in ihr dem Subjekt enthüllt[54]. Sie konstituiert das Zeichen als etwas, das sich zwischen dem aussendenden Gegenstand und dem angerufenen Subjekt ereignet. Als eine Art des Sehens, die uns als Individuen konstituiert, indem sie uns aus uns heraustreten lässt, transzendiert sie die Subjekt-Objekt-Unterscheidung und begründet eine Perspektive, die im Eigenen selbst auf Fremdes, im Identischen auf ein Anderes stößt, das jeden Aneignungsversuch abweist. Solcher Art ist die nicht-possessive Liebe des Protagonisten zu seiner Mutter und seiner Großmutter; auch die Leiden seiner diversen Lieben machen ihn aufmerksam für das eigene Sein der Geliebten und das Leben der anderen. Ein musikalisches Thema, Eindrücke wie die Kirchtürme von Martinville oder dreier Bäume verlocken zum „Bau eines wahrhaften Lebens“[55], werden zum „Versprechen, dass es noch etwas anderes gebe – etwas, was zweifellos die Kunst verwirklichen kann, etwas anderes als das Nichts, das ich in allen Vergnügungen und in der Liebe selbst gefunden hatte“[56]. Kunst erzieht zu mehr Gewissenhaftigkeit als das Leben, denn sie nötigt zu verwerfen, „was nicht Wahrheit ist“, und hofft, dass „die Stunde der Wahrheit vor der des Todes schlägt“[57]. In der Frage, „weshalb wir uns verpflichtet fühlen, das Gute zu tun“, oder was einen atheistischen Künstler dazu zwingt, „zwanzigmal ein Werk von neuem beginnen, dessen Bewunderung seinem von Würmern zerfressenen Leib wenig ausmachen wird“[58], konvergieren ethische und ästhetische Transzendenzerfahrung. Wörtlich wird die Frage „Tot für immer?“ an zwei Stellen ausgesprochen, die über eine weite Distanz miteinander kommunizieren. In der Madeleine-Episode geht es um die Frage nach der Wirklichkeit des vergangenen Ichs, beim Tod des Dichters Bergotte um das Fortleben nach dem Tod. Beide Male wird einem skeptischen „Vielleicht“ die Möglichkeit einer kontingenten Wiedererweckung in der mémoire involontaire und die Ewigkeitsdimension der Essenz entgegengehalten[59], vermittelt durch den Gedanken, dass die wahre Wirklichkeit unseres Ich ebenso wie das kleine Thema der Sonate einer inneren, höheren Welt entstammt, die im Prozess des Wiedererinnerns hervortritt und durch die Kunst dauerhaft wird[60]. Mit seiner unverwechselbaren Handschrift erbringt der Künstler als „Bürger eines unbekannten Vaterlandes“ auch einen „Beweis für die von Anbeginn her individuelle Existenz der Seele“[61]. Ciorans ‚ästhetischen Gottesbeweis’ – Gott muss existieren, sonst wäre Bachs Matthäuspassion eine zerreißende Illusion – antizipiert das Postulat, dass das Kunstwerk einer „spiritualen Wirklichkeit entsprechen“ müsse, „sonst hätte das Leben keinen Sinn“[62]. Ist die Kunst nur Indiz einer anderen transzendenten Wirklichkeit, in der das verloschene Leben des Dichters möglicherweise in einem neuen auferstehen wird, oder ob lebt der Künstler – für eine begrenzte Zeit – überhaupt nur in seinem Werk? Die christliche Symbolik der Episode vom Tod Bergottes – in der Todesnacht „wachten in den beleuchteten Schaufenstern seine jeweils zu dreien angeordneten Bücher wie Engel mit entfalteten Flügeln und schienen ein Symbol der Auferstehung dessen, der nicht mehr war“ – besagt schwerlich, dass der Autor der Recherche Bergotte ein Fortleben im eigenen Werk nicht zugestehe, sondern einzig sich selbst zuerkenne[63]. Wenn Ich-Erzähler und Autor gegen Ende des Romans konvergieren, erscheint die Gestalt Bergottes trotz der Kritik an seiner Schreibweise auch als Präfiguration des Verfassers der Recherche lesbar, dem sich Transzendenz ja nicht nur in der Unbedingtheit künstlerischen Schaffens, sondern auch im Phänomen des Guten bezeugt. Die himmlische Waage, in der das eigene Leben gegen das kleine gelbe Mauerstück in Vermeers Gemälde gewogen wird[64], steht nicht nur für die Frage nach den Zielen, die das Opfer des Lebens rechtfertigen könnten, sondern auch für das Problem der Rechtfertigung des Ästhetischen vor der ethischen Dimension des Lebens. Ästhetische Anamnesis und revelatorische WiederholungDie „Wiederauferstehungen der Vergangenheit“ bleiben nicht einem Erinnern der Vergangenheit verhaftet, vielmehr gilt die „Freude der wiedergefundenen Wirklichkeit“ dem Offenbarungspotential der Essenz, die „eine neue Wahrheit“ birgt[65] und in eine Zukunft weist, in der bei aller Sorge um das Werk die Sorge um den Tod an das Ende gekommen ist. Insofern gehört die Erinnerungsarbeit der Recherche unter diejenige Kategorie von Wiederholung, die Kierkegaard als Erinnerung „nach vorn“[66] bezeichnet und als „moderne“, auf dem Boden das Christentum mögliche Weltanschauung der „heidnischen“ Anamnesis der Griechen gegenübergestellt hat: „Wenn man sagt, das Leben sei eine Wiederholung, dann sagt man: das Dasein, das gewesen ist, entsteht jetzt“[67]. Echte Wiederholung lässt sich für Kierkegaard so wenig arrangieren, wie die Intelligenz bei Proust die Wahrheit des Vergangenen ans Licht bringt. Bei Kierkegaard lautet das Versuchsergebnis einer Reise in die eigene Vergangenheit: „Das einzige, was sich wiederholte, war die Unmöglichkeit einer Wiederholung“[68]. Doch auch der Schriftsteller, dem sich alles zum Gegenstand der Erinnerung wandelt, sodass ihm „Liebe in der Erinnerung die einzige glückliche“ ist, gelangt nicht zur Wiederholung; er kann nicht „gleichzeitig“ werden mit der Geliebten, die ihm vielmehr zum Anlass wird, das Poetische in sich zu erwecken. Der Fall des Autors der Recherche liegt jedoch anders, obwohl auch für ihn die Subjektivität der Liebe ein wirkliches Liebesverhältnis erschwert und ihm überhaupt „die Wirklichkeit sich nur aus der Erinnerung formt“[69]. Denn er sucht nicht den ästhetischen Selbstgenuss in der Poetisierung der Realität zum Erinnerungserlebnis, sondern erfährt die Macht der Zeit, die ihn die „Schönheit einer Sache erst viel später in einer anderen zu erkennen erlaubt“[70]; es sind die Dinge selbst, die ihm mit einem Erinnerungshof begegnen und als Zeichen ihn an ihn selbst erinnern, weil sie auf der gleichen Höhe oder Tiefe mit seiner Vergangenheit liegen. Die wahren Paradiese sind deshalb die verlorenen, weil sich ohne Erinnerung das „tiefe Gefühl von Erneuerung“[71] nicht einstellen würde, das nach der Kunst verlangt, die den Weg zu den Tiefen zurückführt, in denen das, was damals wirklich existiert hat, von uns ungekannt ruht, und das wahre Leben wieder neu erschafft[72]. In der unwillkürlichen Erinnerung wird nicht Vergangenes wiederholt, sondern etwas einst nicht Wahrgenommenes nachgeholt und der „Ewigkeitsgehalt vergangener Zeit“ gerettet. Durch die Gnade der Zeichen, im Anruf der Dinge, in der Öffnung für die Sinnuniversen der anderen empfängt das Ich die Berufung zum „Leben nicht gelebten Lebens“[73]. Damit entspricht die wiedergefundene Zeit dem „Augenblick“ der Wiederholung, der bei Kierkegaard zwischen der Hoffnung („ein entzückendes Mädchen, das einem zwischen den Händen entschlüpft“) und der bloßen Erinnerung („eine schöne alte Frau, mit der einem doch nie im Augenblick gedient ist“) seine Stelle hat: „Die Wiederholung ist ein geliebtes Eheweib, dessen man nie überdrüssig wird“[74], denn sie ist der Bruch mit dem ästhetischen Stadium in der Innerlichkeit der Verantwortung und des Glaubens, der alles Verlorene wiederbekommt, auch sich selbst. Die Recherche schweigt vom Glauben, soweit er inhaltlich religiös bestimmt ist. Sie weiß aber, dass die Begegnung der Zeichen dem Denken vorausgeht[75] und das Subjekt seiner selbst nicht mächtig ist, sondern zu seiner rettenden Erkenntnis der Huld offenbarender Zeichen bedarf. Insofern antizipiert die Recherche den nachmetaphysischen „Verzicht auf die beruhigende Unumstößlichkeit der Präsenz“, mit dem sich das postmoderne schwache Denken in die Spur der jüdisch-christlichen Tradition einschreibt[76]. Das Höchste, das dem Subjekt in diesem Leben zuteil wird, besteht darin, zum Kooperator von Gnade zu werden – nicht in der Anmaßung einer philosophischen Idee, sondern im demütigen Entziffern der im Modergeruch eines Toilettenhäuschens[77], im Klappern eines Löffels oder der steifen Faltung einer Serviette[78] verborgenen und ihn anrufenden Essenz. Immer wieder ist es zu Eingeständnissen genötigt wie „Damals wusste ich noch nicht“ oder „Ich sollte später erfahren“, weil es der Zeit bedarf, in der die Dinge zum Nachhall ihrer selbst werden können, damit das Ich seines Wesens inne werde. Von diesem Geheimnis der Zeit weiß auch der Glaube, für den sich das Ankommen von Offenbarung weder in der Entgegennahme von theoretischen Sätzen noch in der Erinnerung historischer Fakten, sondern unverfügbar in einer kontextualisierenden Relektüre der Zeichen in der Zeit ereignet. „Wie unser Geist sich erneuert und darin wächst, so erneuert sich auch das Antlitz der Schriften, und die Schönheit des Verstehens schreitet mit dem Verstehenden voran“[79]. Anmerkungen[1] Zitiert bei Jean-Yves Tadié, Proust (Dossiers Belfond), Paris 1983, 168. [2] Le temps retrouvé 179. 182 / III 3953. 3958f. Stellenangaben vor dem Schrägstrich beziehen sich, sofern nichts anderes vermerkt ist, auf die französische Taschenbuchausgabe von À la recherche du temps perdu (1913-1927 [posthum]) in acht Bänden (Gallimard Folio); die Angabe nach dem Schrägstrich verweist auf die deutsche Übersetzung von Eva Rechel-Martens in der dreibändigen Suhrkamp-Ausgabe, Frankfurt 2000. [3] Zu beidem kam es nicht, weil der Bruder es ablehnte, ihm die Hände zu falten, und der Abbé um den 18. November 1922 an einer schweren Grippe erkrankt war. [4] Marcel Proust, La mort des cathédrales. Artikel im Figaro vom 16. 8. 1904. [5] Briefe vom 29. 7. 1903 an Georges de Lauris und vom 6. 11. 1908 an Geneviève Straus. [6] Le Côté de Guermantes II 85 / II 1782. [7] Auch im Roman selbst: Le temps retrouvé 152. 349 / III 3915. 4190; vgl. 346 / III 4185.. [8] Paul Ricœur, Das Selbst als ein Anderer, München 1996, 200. [9] Le temps retrouvé 343 / III 4182. [10] Ebd. 186f. 205f. / III 3963-3965. 3990f. [11] Gilles Deleuze, Proust und die Zeichen (frz. 4. Aufl. 1976), Berlin 1993, 80. [12] Angelika Corbineau-Hoffmann, Marcel Proust: À la recherche du temps perdu (UTB 1755), Tübingen / Basel 1993, 6f. [13] Friedrich Nietzsche, Aus dem Nachlass der achtziger Jahre. Werke, hg. von Karl Schlechta (1966) III 534. 540. 751. [14] Claudia Hammerschmidt, Utopie des Schreibens: Marcel Proust und Leopoldo Marechal. Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte / Cahiers d'Histoire des Littératures Romanes 26, 2002, 359-375. [15] Du côté de chez Swann 44 / I 63; Le temps retrouvé 174. 178. III 3946. 3951f [16] Vgl. die kunsttheoretischen Reflexionen ebd. 196-203 / III 3977-3988. [17] Deleuze, aaO. 23. 34f. [18] Du côté de chez Swann 177 / I 238. Große Literatur zeigt die Dinge „in der Reihenfolge der Eindrücke, nicht indem sie zuvor deren Ursachen erklärt“ (Ebd. 222 / I 860; La Prisonnière 364 / III 3271). Die Malerei hat aus dem Gefühlten herauszunehmen, was der Künstler bereits weiß, und „das Aggregat aus Vernunfteinsichten aufzulösen, aus dem sich bei uns ein optischer Eindruck zusammensetzt“ (Le Côté de Guermantes II 107 / II 1812; vgl. À l’ombre des jeunes filles en fleurs 404 / I 1104). [19] Ebd. 287 / III 946 [20] Le temps retrouvé 196 / III 3977. [21] Deleuze, aaO. 7. [22] Le temps retrouvé 205. 238f / III 3989. 4035f. In Prousts Ästhetik macht sich zudem seit 1911 eine Neubewertung der Rolle der Intelligenz bemerkbar; zwar besitzen die durch sie unmittelbar der Wirklichkeit entnommenen Wahrheiten weniger Tiefe und Notwendigkeit, aber die Intelligenz lenkt den Schriftsteller jetzt nicht mehr von der Gestaltung ab, sondern verleiht seinem Werk einen zusammengesetzten Aspekt (Le temps retrouvé, Vorwort des Herausgebers XIIIf). [23] Bernhard Waldenfels, Deutsch-französische Gedankengänge, Frankfurt a. M. 1995, 405. [24] Hammerschmidt, aaO. 365. Damit ist auch die Vorstellung, dass sich zwischen den „Metaphern der Dinge“ und „den ursprünglichen Wesenheiten“ unterscheiden ließe (so noch Friedrich Nietzsche, Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn [1873], ebd. III 312f. 314f) überschritten. [25] Ingolf U. Dalferth, Gedeutete Gegenwart, Tübingen 1997, 136f; 154f. [26] Ingolf U. Dalferth, Die Wirklichkeit des Möglichen, Tübingen 2003, 435. 467f. [27] Ebd. 537. 543. [28] Albertine disparue, 174f. / III 3563. [29] Le temps retrouvé 24 / III 3735. Ursprünglich sollte der auf Maeterlinck zurückgehende Begriff der „intermittence“ im Titel des Gesamtwerkes erscheinen: „Les Intermittences du cœur“ (vgl. Sodome et Gomorrhe 153f / II 2257f.) [30] Du côté de chez Swann 43f / I 62f; Le temps retrouvé 185 / III 3961f. Die Idee der mémoire involontaire war von Proust gegen die biographische Methode des Kritikers Sainte Beuve entwickelt worden (Contre Sainte Beuve, 1971 [posthum]). [31] Le temps retrouvé. Ausgabe von Jean-Yves Tadié (La Pléiade), Paris (1987-1989) IV 175 / III 3704; 204 / III 3987 ; Albertine disparue 14. 175 / III 3336. 3563. [32] À l’ombre des jeunes filles en fleurs 360 / I 1045. [33] Albertine disparue 138 / III 3511. [34] La Prisonnière 62 / III 2851. [35] Ebd. 83. 84 / III 2880. 2882. [36] Ebd. 98 / III 2900. [37] Albertine disparue 78 / III 3426. [38] Ebd. 371-373 / III 3280-3282. [39] Deleuze, aaO. 73. [40] Le temps retrouvé 204 / III 3987f. [41] Ricœur, aaO. 383. [42] Zit. bei Detlef Thiel, Über die Genese philosophischer Texte. Studien zu Jacques Derrida, Freiburg-München 1990, 227. [43] Johannes Hoff, Spiritualität und Sprachverlust. Theologie nach Foucault und Derrida, Ferdinand Schöningh Paderborn 1999, 77. [44] Martin Luther, Zirkulardisputation 1537, WA 39 I (265-333), 282 (fides facit personam). [45] Martin Luther, Thesenreihe „De homine”, WA 39 I (175-177) 177 (35. These). [46] Michael Theunissen, Negative Theologie der Zeit (stw 938), Frankfurt a. M. 1991, 313f. [47] Peter Dabrock, Antwortender Glaube und Vernunft (Forum Systematik 5), Stuttgart-Berlin-Köln 2000, 256-258. 287-289.. [48] Christof Gestrich, Christentum und Stellvertretung, Tübingen 2001, 333-338. [49] Le temps retrouvé 182. 184 / III 3957. 3960. [50] Ebd. 349 / III 4190 [51] Ebd. 178f. / III 3946. 3951-3953; vgl. Du côté de chez Swann 44 / I 63f. [52] Waldenfels, aaO. 388-402. [53] Eberhard Jüngel, Gott als Geheimnis der Welt, Tübingen, 2. durchges. Aufl. 1977, 399f. [54] Deleuze, aaO.38. [55] La Prisonnière 249 / III 3110. [56] Ebd. 251 / III 3112 [57] Le temps retrouvé 216f / III 4003f. [58] La Prisonnière 177 / III 3009. [59] Du côté de chez Swann 43 / I 62; La Prisonnière 177 / III 3009. [60] Le temps retrouvé 184f / III 3960f. [61] La Prisonnière 245 / III 3104. [62] Ebd. 360 / III 3265. Die Frage nach der Wirklichkeit der Kunst und die Frage der Wirklichkeit der Ewigkeit der Seele (ebd.) erscheinen – bei entsprechender Interpunktion (vgl. Deleuze, aaO. 38) – als Parallelen. [63] Corbineau-Hoffmann, aaO. 112 [64] La Prisonnière 176 / III 3009 [65] Le temps retrouvé 181-186 / III 3956-3962. [66] Sören Kierkegaard, Die Wiederholung [1843], in: ders., Die Krankheit zum Tode. Furcht und Zittern. Die Wiederholung. Der Begriff der Angst. Gesamtausgabe der Werke in vier Einzelbänden. Herausgegeben von Hermann Diem und Walter Rest [1951-1959]. (dtv), München 2005, 329. [67] Ebd. 352. [68] Ebd. 378f. [69] Du côté de chez Swann 182 / I 245. [70] Le temps retrouvé 196 / III 3977. [71] Ebd. 177 / III 3950. [72] Ebd. 203 / III 3986 [73] Theunissen, aaO. 313f. [74] Kierkegaard, aaO. 330. [75] Le temps retrouvé 187 / III 3964. [76] Gianni Vattimo, Die Spur der Spur, in: Jacques Derrida/Gianni Vattimo, Die Religion (es 249), Frankfurt a. M. 2001, 107-124, 123 ; vgl. auch die Hinweise auf das Jüdische in Prousts Zeichenwelt in Abhebung gegen die griechische Logos-Welt bei Deleuze aaO. 82-90 . [77] À l’ombre des jeunes filles en fleurs 65 / I 652. [78] Le temps retrouvé 174-176 / III 3944-3949. [79] Johannes Cassian, zit. bei Rudolf Voderholzer, „Die Heilige Schrift wächst irgendwie mit den Lesern“ (Gregor der Große). Dogmatik und Rezeptionsästhetik. MThZ 56, 2005, 162-175. |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/67/ws1.htm
|
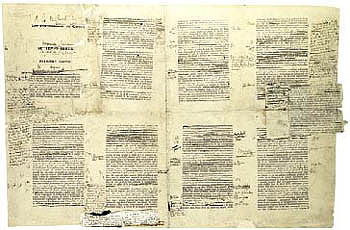 Mit dem Anspruch, ein Kunstwerk als Summe eines inneren Lebens hervorzubringen, scheint die Recherche die Tradition des Romans des 19. Jahrhunderts fortzuschreiben
Mit dem Anspruch, ein Kunstwerk als Summe eines inneren Lebens hervorzubringen, scheint die Recherche die Tradition des Romans des 19. Jahrhunderts fortzuschreiben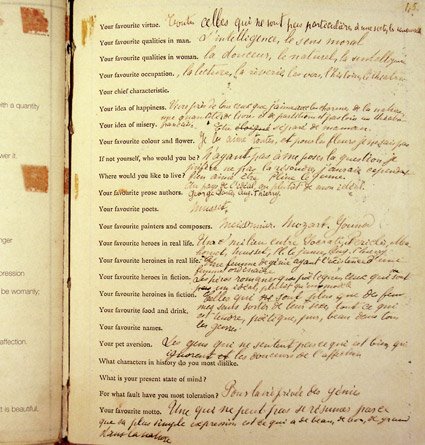 Wenn dem Erzähler sein Leben als etwas erscheint, „dem der Zusammenhalt durch ein in seiner Identität fortbestehendes individuelles Ich abging“
Wenn dem Erzähler sein Leben als etwas erscheint, „dem der Zusammenhalt durch ein in seiner Identität fortbestehendes individuelles Ich abging“