
Ästhetisierung von Religion? |
Ohne Stil
Postpopularkulturelle GedankenAndreas Mertin
"Best of ...."-Events, das kann man nicht nur bei MTV, VIVA, RTL oder Sat 1 beobachten, dienen in aller Regel dazu, die wichtigsten Beiträge zu einer Sache, einer Epoche oder eben auch einem Forschungsansatz hervorzuheben, um das Ganze dann dem Museum oder im schlimmsten Fall dem Vergessen zu überantworten. Diese Kritik an der Entwicklung der Popularkultur-Theologie, die ich pars pro toto an einem Beitrag festmachte, ist auf Widerspruch gestoßen. Zum einen wurde moniert, meine Kritik des Titelbildes sei überzogen, denn faktisch habe es keine Korrespondenz zu den Schuhen von Vincent van Gogh gegeben, sondern es sei einfach nur eine Koinzidenz der Bildsujets. Deshalb könne auch nicht von einem maßlosen Anspruch die Rede sein. Nun zeigt die aktuelle Ausstellung "Van Goghs Schuhe. Ein Streitgespräch" im Wallraf-Richartz-Museum in Köln, dass vor Vincent van Gogh Schuhe als Bilder extrem selten waren und auch danach eher rare Sujets sind. Wer also Schuhe auswählt (und nicht gerade Reklame für Schuhe macht), befindet sich immer in einem bestimmten Werkkontext. Ich unterstelle einmal, dass Walker Evans Foto "Burroughs Arbeitsschuhe" von 1936 wesentlich unbekannter ist als die weltberühmten Schuhe Vincent van Goghs in ihrer Deutung von Martin Heidegger, die zumindest den Amerikaner Meyer Schapiro und den Franzosen Jaques Derrida dazu brachten, eigene Interpretationen vorzulegen. Aber ich gebe zu, dass man auch unter kulturell Gebildeten nicht mehr voraussetzen kann, dass derartige Zusammenhänge auch bewusste oder gewusste Zusammenhänge sind. Aber man kann darauf hinweisen, in welche geistesgeschichtlichen Zusammenhänge man gerät, wenn man so ein Bild verwendet. Zudem hebt sich ja damit die Kritik nicht auf. Der Titel „Best of …“ zielt auf die popularkulturelle Verwendung des Wortes in der Musikindustrie in Abgrenzung etwa zu einer Werkauswahl in der Literaturgeschichte. Best of - Greatest Hits - das ist zwar einerseits die ganz normale Sprache der Kulturindustrie, zum anderen aber eben auch ein erhobener Anspruch. Mir ist von Fanseiten diverser Musikgruppen vertraut, welch vehemente Kritik sich erhebt, wenn auf einer Best of - Compilation eben nicht alles Best of ist oder etwas Wichtiges fehlt. Da war meine diesbezügliche Kritik eher harmlos. Ich finde, man sollte diese ganze an Superlativen orientierte Marktsprache hinter sich lassen oder wirklich nur das Beste vom Besten bieten. Aber das war nur eine Marginalie im Blick auf die weitere Kritik. Diese bezog sich nun auf den Umstand, dass ich nicht jeden einzelnen Aufsatz des Buches referiert hatte, sondern den Eröffnungsaufsatz pars pro toto herangezogen hatte. Das halte ich weiterhin für legitim und zwar aus zwei Gründen. Den einen entnehme ich der Wahrnehmungstheorie: "Da in der visuellen Wahrnehmung das Gesichtsfeld nicht zeilenweise abgetastet wird, sondern heuristisch punktuell, lernt der geübte Betrachter, welche Teile einer Wahrnehmung er besonders fixieren muss, um das Ganze zu erkennen." Mir ging es darum, aufzuzeigen, wo Populartheologie mit flotten Sätzen an ihre Grenzen kommt, sei es, indem sie einen unsinnigen Popanz aufbaut, den sie dann leichter Hand zerfleddert, sei es, indem sie unhaltbare Sätze über historische Tatbestände aufstellt, um umso leichter das Gegenteil vertreten zu können. Zum anderen war ein gewisser Teil der im Buch abgedruckten Aufsätze – meiner eingeschlossen – zuerst im Magazin für Kunst | Kultur | Theologie | Ästhetik erschienen und damit bereits von mir einer Würdigung unterzogen worden. Fast die Hälfte aller Autoren des Buches haben in den letzten 10 Jahren Beiträge zu unserer Zeitschrift geliefert. Ich konnte also voraussetzen, dass die Leser der Rezension das wussten und einzuordnen vermochten. Die Kritik an meinen eigenen Ansätzen zum Themenkomplex Popularkulturtheologie hatte ich ja an prominenter Stelle in den Rezensionstext eingebaut. Dem kritisierten Autor war das vielleicht alles nicht bekannt, er ist nur nahezu zufällig auf die Rezension des Buches gestoßen und meinte nun, hier habe sich jemand ausgetobt, der von Popularkulturtheologie nichts verstünde. Aufklärerisch wandte er sich nun an mich mit der Unterstellung, ich hätte seinen Text entweder nicht gelesen oder nicht verstanden. Das hat natürlich den Charme des Satzes "Stimmt es, dass sie bis gestern ihre Frau geschlagen haben?" Entweder sagt man nein - dann schlägt man sie immer noch; oder man sagt ja, dann ist man überführt. Nun kann niemand bei der Lektüre meiner Kritik unterstellen, ich hätte den Text nicht gelesen. Wer so etwas behauptet, sollte es auch beweisen, was schwer möglich sein dürfte, da ich ihn gelesen habe. Ich habe im gleichen Heft 61 einen Autor der Jungen Freiheit der Nichtlektüre des von ihm besprochenen Textes überführt, indem ich zeigen konnte, dass er andauernd Sachverhalte aus dem Text zitiert, die dort gar nicht enthalten waren, sondern aus Vorurteilen und Sekundärquellen stammten. Er zitierte Sätze, die im zitierten Text nicht vorkamen. Das trifft in meinem Fall nicht zu. Bleibt im Blick auf meine Rezension nur die Variante, ich hätte den Text nicht verstanden. Und sicher ist es das, was der Autor auch meint und mir unterstellt. Nun gäbe es in der Tradition Schleiermachers ja noch viele andere Möglichkeiten, zum Beispiel die, ich hätte den Text anders verstanden als der Autor oder ganz keck, ich hätte ihn sogar besser verstanden als dieser. Aber lassen wir diese schleiermachersche Versuchung der Rechtfertigung der kritischen Lesart zunächst einmal beiseite, so bliebe doch die Frage, warum der kritisierte Autor den Leserinnen und Lesern des Magazins nicht so viel Verstand zutraut, sich selbst ein Urteil zu machen? Sapere aude ist der Leitspruch der europäischen Aufklärung. Wenn allerdings der Autor meint, dass er der einzige ist, der die intentio auctoris vertreten und durchsetzen kann, dann scheint er mir nicht auf der Höhe der Zeit zu sein (und will es vermutlich auch gar nicht). Wenn Lektüre nach Derrida immer auch Intervention ist, dann ist die Differenz von intentio auctoris und intentio lectoris und intentio operis präzise zu bedenken und vor allem anzuerkennen, denn letztere kann, wie es so schön heißt, die Aussageabsicht des Verfasser durch stilistische Schwächen desavouieren. Konkret ging es in der Gegenkritik um die Frage, ob der eröffnende Satz des Textes „Pop und Protestantismus – ein einziger Widerspruch“ als Meme kenntlich gemacht werden muss oder nicht. Wenn ich etwas zitiere, sei es eine Meme, einen Satz, ein Gerücht, eine Stimmung - wie mache ich im stilsicheren Gebrauch der deutschen Sprache dem Leser kenntlich, dass es sich um ein solches handelt? Hier ist die deutsche Stilistik eigentlich klar und im Blick auf die wissenschaftliche Literatur sogar unerbittlich, selbst popularkulturelle Lexika wie die Wikipedia wissen das: "Die sinngemäße Wiedergabe fremder Äußerungen (Entlehnung) erfolgt zur Abgrenzung von eigenen Aussagen zweckmäßigerweise im Konjunktiv. Sie wird zusätzlich gekennzeichnet durch den Namen des Verfassers und/oder Anmerkungen wie: 'in Anlehnung an'; 'sinngemäß nach'; 'vgl. hierzu: …'" [Wikipedia, Art. Zitat). Man könnte auch sagen „wie allgemein behauptet“ oder „wie häufig anzutreffen“. Nun kann man natürlich postmodern sagen, was kümmert mich das Regelwerk, aber dann darf man nicht protestieren, wenn andere den Text anders lesen. Wer Sinn erzwingen will, muss sinnvoll sprechen. Natürlich gehört es zu den verstörenden Erfahrungen eines Autors, wenn andere seine Texte anders lesen, als er es sich mal ausgedacht hat. Aber diese Erfahrung ist eine Grunderfahrung aller Kommunikation. Es war mal der Stolz der jüngeren Lesegeschichte, genau solche Differenzen herauszuarbeiten und zu schauen, welche neuen Lesarten sie ergeben. Der Autor von heute aber ist sein bester Interpret und stellt fest (im doppelten Wortsinn), wie seine Worte zu gelten haben. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Einmal unterstellt, es sei die intentio auctoris beim ersten Satz einsichtig und nachvollziehbar gewesen, der Autor habe also ein frei floatierendes Urteil zitiert, ohne dies kenntlich zu machen, aber eben für jeden einsichtig, dann lautet mein Gegenargument im Rezensionstext lediglich, dass dieser Satz mir als Meme nicht bekannt ist, das heißt, das die dialektische Argumentation des Autors m.E. ihrer Grundlage entbehrt. Hier hätte es dem Autoren tatsächlich geholfen, wenn er - was in wissenschaftlichen Texten an sich üblich ist - einen Nachweis für die allgemeine Verwendung des Satzes geführt hätte. So aber drehe und wende ich mich und kann niemanden erblicken, der den ersten Satz des Textes aussprechen möchte. Dass Protestantismus purer Zeitgeist und darin ganz und gar popularkulturell sei, das lese ich allerdings fast jeden Morgen, wenn ich nur ins Feuilleton blicke. Das Gegenteil habe ich bisher nicht vernommen. Die Klage „Sinnlichkeit und Protestantismus – ein einziger Widerspruch“ gehört zum Standardrepertoire protestantischer Flagellanten und gegenreformatorischer Eiferer, aber um diese Klage ging es in der Einleitung nicht. Aber warum gehe ich dem überhaupt nach? Nun, der Autor schrieb mir, ganz so zufällig sei er gar nicht auf die Rezension in unserem Magazin gestoßen, vielmehr sei er gestoßen worden, denn er habe eine Reihe von Hinweisen auf den Artikel erhalten, deren harmlosester Kommentar gelautet hätte: "Was ist denn mit dem los?", wobei er mir die härteren Kommentare freundlicherweise ersparen wollte. Das führt mich nun zu den Leserinnen und Lesern des Magazins für Theologie und Ästhetik. Wenn einige von Ihnen wirklich der Meinung waren, ich wäre in der Kritik des Textes zu weit gegangen und hätte den Autor unangemessen angegriffen, dann wäre es ehrenhaft gewesen, wenn Sie öffentlich mit Argumenten für den Autor eingetreten wären und ihn verteidigt hätten. Das hätte Stil, dem das Magazin für Theologie und Ästhetik immer Raum gegeben hat. Als ich Jörg Herrmann seinerzeit wegen bestimmter Tendenzen in seiner Dissertation in unserem Magazin scharf angegriffen habe, obwohl ich die Genese seiner Arbeit über Jahre kritisch mit begleitete, hat er zu Recht mit einer deutlichen Antwort reagiert, die dann auch im Magazin abgedruckt wurde (https://www.theomag.de/14/jh4.htm). Das war selbstverständlich, denn so führt man Auseinandersetzungen, Kritik und Gegenkritik. Aber das bezieht sich nicht nur auf Kritiker und Kritisierte, sondern betrifft jeden, der das Gefühl hat, dass einem Anderen Unrecht widerfährt. Die Interventionen zugunsten von Theo van Gogh, Navid Kermani oder Herta Müller in dieser Zeitschrift geschahen aus genau diesem Gefühl heraus. Das ist unsere Aufgabe. Es wäre also gut gewesen, die betreffenden Leserinnen und Leser, so es sie gibt, hätten zur Feder gegriffen und ihre Sicht der Dinge dargestellt, statt dem Autor denunziatorisch Meldung zu machen und ihm das schwierige Geschäft der Erwiderung zu überlassen, weil ein Rezensierter üblicherweise nicht gegen eine Rezension polemisiert. Auf was soll man sich denn verlassen, wenn man sich nicht einmal mehr auf Gerechtigkeitsgefühl der Leser verlassen kann? Denn dem Autoren muss nun klar sein, dass die kommunikativen Elstern im Zweifelsfall nicht für ihn eingetreten wären. Ein ungutes Gefühl. |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/63/am307.htm
|
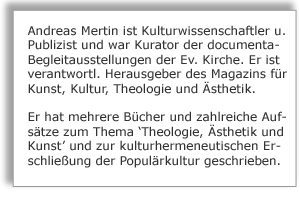 In Heft 61 des Magazins für Kunst | Kultur | Theologie | Ästhetik habe ich ein
In Heft 61 des Magazins für Kunst | Kultur | Theologie | Ästhetik habe ich ein