
Film und Geschichte |
Die schwarze Sonne der ShoahGeschichte und Erinnerung in Claude Lanzmanns FilmästhetikMartin Bauer
So drängen sich in wirkungsgeschichtlicher Hinsicht Vergleiche zur Fernsehserie „Holocaust“ auf. Gerade vor diesem Hintergrund wird aber deutlich, dass Shoah zu den eindringlichsten cinematografischen Auseinandersetzungen mit der Vernichtung der europäischen Juden gehört. Der Film hat wohl jeden seiner Zuschauer verändert.
Ich komme auf diese im Grunde trivialen Aspekte deshalb kurz zu sprechen, weil ein nahe liegendes und für die weiteren Überlegungen bedeutsames Missverständnis problematisiert werden muss. So unstrittig es nämlich ist, dass Shoah mit der Aufklärung historischer Wirklichkeiten befasst ist, so fragwürdig wäre andererseits doch die Behauptung, dass der Film ein Dokumentarfilm über das Geschehen in den nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslagern sei. Sicherlich darf mit Blick auf Shoah gesagt werden, dass die Filmbilder Vergangenheit vergegenwärtigen, doch gehorcht der von Lanzmann gewählte Modus dieser Vergegenwärtigung keineswegs den Genre-Gesetzen einer Dokumentation.
Natürlich zeigt der Film einzelne Schauplätze, er zeigt Ortsschilder, er stellt Fahrten nach, macht Zuggeräusche vernehmbar, er zeigt das Antlitz von Opfern und das unscharfe, mit einer Schwarz-Weiss Kamera, die in einer Aktentasche versteckt war, aufgenommene Gesicht eines Täters. Franz Suchomel, der als SS-Unterscharführer seit 1942 zum Wachpersonal des Konzentrationslagers Treblinka gehörte, ergreift das Wort. Erst nach Zahlung einer stattlichen Geldsumme hatte er sich bereit erklärt, Lanzmann Rede und Antwort zu stehen – allerdings unter der Bedingung, dabei nicht gefilmt zu werden. An diese Absprache wollte sich Lanzmann nicht halten. Wir sehen Züge und Gleisanlagen, ein verfallenes Krematorium und gegen Ende des Films ein Modell des Warschauer Ghettos. Und ganz am Anfang auch einen Fluss, über den ein schmales Boot gleitet – als sei es der mythische Fluss „Lethe“, der Fluss des Vergessens, den die Sterblichen nach Auskunft der griechischen Mythologie an der Grenze zwischen Leben und Tod überqueren. Von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, auf die am Ende noch einzugehen sein wird, bietet der Film freilich nichts an, was in einer sich wissenschaftlich begreifenden Historiographie als Quelle gelten könnte. Lanzmann verwendet keine Archivalien, mit denen Aussagen authentifiziert, keine Fotos, die als Belege in die Kamera gehalten würden. Nur ein einziger Fachhistoriker tritt auf, der junge Raul Hilberg, der – nebenbei bemerkt – von Haus aus kein Historiker war, sondern als Schüler des aus Deutschland vertriebenen Juristen Ernst Fraenkel ursprünglich zum Politikwissenschaftler ausgebildet wurde. Die historiographische Aufarbeitung der Shoah ist tatsächlich zunächst nicht von Historikern, sondern von Politologen ausgegangen. Hilberg sitzt bezeichnenderweise aber nicht vor den Bücherregalen einer Bibliothek, der Ortschaft, die Filmdokumentationen so lieb ist, sondern an einem Tisch seines Wohnhauses in Vermont. Er führt vor, was ein kundiger Historiker dem minutiösen Studium von Zugfahrplänen entnehmen kann. Schließlich macht er auf das mehr als erstaunliche Faktum aufmerksam, dass das NS-Regime zur Finanzierung der Vernichtungspolitik keinen eigenen Etat eingeplant hat. Die Opfer hatten die Kosten für ihre Verschleppung und Ermordung selbst aufzubringen. Über weite Strecken des Films erteilt Lanzmann seinen Interviewpartnern das Wort, d. h. jenen Augenzeugen, die – nach einem in der Geschichtswissenschaft geflügelten Wort – die „natürlichen Feinde des Historikers“ sind. Schon an dieser Entscheidung ist die Grundkonzeption des Filmes ablesbar: Claude Lanzmann hat in Shoah nicht Geschichte, sondern den Prozess des Erinnerns inszeniert. Diese schlichte These soll im Folgenden begründet werden. Dazu muss ich in einem ersten Schritt auf Lanzmanns Kritik der Geschichtswissenschaft eingehen, in einem zweiten darlegen, als was er das Ereignis der Shoah seinerseits begriffen hat, um schließlich in einem dritten Schritt auszuführen, welche filmästhetischen Konsequenzen er daraus gezogen hat. Am Ende dürfte nachvollziehbar sein, warum ich meine, dass Lanzmann Geschichte im Rückgriff auf Darstellungsformen inszeniert, die durch das ursprüngliche, geradezu archaische Ethos geprägt sind, das bei der Geburt der abendländischen Historiographie Pate gestanden hat. Lanzmanns Kritik der GeschichtswissenschaftAuch wenn Lanzmann – nicht ohne den ihm eigenen Sinn für Provokationen – gelegentlich bemerkt hat, Shoah sei ein Detektivfilm und in einigen Sequenzen sogar ein Western, hat er keinen Zweifel daran gelassen, dass sein Film eine Lektion in Sachen Geschichte erteilen soll. Immerhin bezeichnet er Shoah selbstbewusst als „die beste Mauer gegen das Vergessen“.[1] Gleichzeitig legt Lanzmann allergrößten Wert darauf, Shoah nicht aus der Position eines Historikers gemacht zu haben. Tatsächlich hat er gravierende Einwände gegen jeden Versuch vorgebracht, die Massenverbrechen des Dritten Reiches historisch verstehen zu wollen. Er hält nicht nur die Beantwortung von Fragen nach dem Warum, sondern die Fragestellung als solche schon für „obszön“. So äußert er sich in einem Interview, das Lanzmann aus dem Nouvel Observateur anlässlich der Publikation seiner Autobiographie in Frankreich unlängst gegeben hat: „Warum konnte das geschehen? Warum ist das den Juden widerfahren? Die Frage ist völlig obszön. Alle Gründe, die man benennen kann, sind vielleicht notwendig, aber nicht hinreichend.“[2] Die in diesen Sätzen zum Ausdruck gebrachte, geschichtsskeptische Haltung spitzt er in demselben Gespräch auf die Behauptung zu, seine Weigerung, die Shoah zu verstehen, sei für ihn die einzig mögliche Weise gewesen, weiterzumachen bei der Arbeit an dem Film: „Diese Blindheit war die reinste Weise des Blicks, die Klarsicht selbst.“[3] Halten wir diese Paradoxie fest! Für Lanzmann verlangt Klarsicht methodologisch eine bewusst gewählte Blindheit. Eine Methode, die Blindheit explizit zur Bedingung von Einsicht erklärt, versteht sich bestimmt nicht von selbst. Doch vertritt Lanzmann ganz offenkundig die Überzeugung, dass die Absicht, Ursachen für die exzessive Gewalt der Nationalsozialisten, für die Planung und Durchführung der so genannten „Endlösung“ zu identifizieren, unter zwei Hinsichten fragwürdig ist. Erstens) ist sie ethisch zu verurteilen und zweitens) epistemologisch, d.h. aus erkenntnistheoretischen Gründen. Lanzmann meint, es könnten allenfalls notwendige, jedoch keine hinreichenden Bedingungen für den Genozid an den Juden ausgemacht werden. Im Rückgriff auf eine begriffliche Unterscheidung von Gottfried Wilhelm Leibniz, den Lanzmann während seines Philosophiestudiums nach eigener Auskunft besonders intensiv gelesen hatte, behauptet er, dass eine wirklich erschöpfende, sowohl die notwendigen als auch die hinreichenden Bedingungen auflistende Erklärung der Shoah ausgeschlossen sei. Genau besehen macht Lanzmanns Geschichtsskepsis eine veritable Kritik der Geschichts-wissenschaft geltend. Soweit sich die Historiographie als eine Wissenschaft versteht, die – den Naturwissenschaften vergleichbar – kausal-explanatorische Ansprüche einlösen will, also geschichtliche Ereignisse, Handlungen und Entwicklungen auf Ursachen zurückführt, deren Kenntnis den Gang der Geschichte zu erklären vermag, weist Lanzmann eine geschichtswissenschaftliche Analyse der Shoah zurück. Selbstverständlich bestreitet er nicht, dass der Genozid an den Juden Ursachen gehabt hat, die ermittelt werden könnten. Allerdings bezweifelt er, dass die Geschichtswissenschaft in der Lage sei, die Gesamtheit solcher Kausalbeziehungen zu erfassen. Soll ein kausal-explanatorischer Anspruch der Geschichte als erklärender Wissenschaft überzeugend eingelöst werden, müssten alle relevanten Ursachen benannt werden. Da dies nach Lanzmanns Dafürhalten unmöglich ist, läuft die geschichtswissenschaftliche Ambition, die Shoah kausal zu erklären, ins Leere. Seit dem 19. Jahrhundert erwägen die Historiker aber noch ein anderes, mögliches Selbstverständnis ihrer wissenschaftlichen Praxis. Nach dieser Alternativversion ist die Historiographie keine kausal erklärende Wissenschaft, die sich in der Konkurrenz zu den Erklärungsleistungen der Naturwissenschaft bewähren muss, sondern eine Geisteswissenschaft. Als Geisteswissenschaft wäre die Geschichtsschreibung jedoch keine erklärende, sondern eine verstehende Wissenschaft. In der Bezugnahme auf die Differenz zwischen dem Erklären und dem Verstehen hat Wilhelm Dilthey zwischen Geistes- und Naturwissenschaften unterschieden und Max Weber nach ihm die Historiographie als eine verstehende Sozialwissenschaft definiert. Deren Erkenntnisinteresse zielt nicht auf die Ermittlung von Ursache-Wirkungsbeziehungen, die sich idealerweise zu einer Theorie systematisieren lassen, die Gesetze aufstellt. Als verstehende Sozialwissenschaft zielt die Historiographie demgegenüber auf die Interpretation des Sinnes und der Bedeutung geschichtlicher Tatsachen. Weil sich diese Bedeutung aber erst im Rückblick erschließt, ist dem Zeugnis der Zeitgenossen mit Vorsicht zu begegnen. Deshalb gilt der Augenzeuge als ein Feind des Historikers. Gerade ihm fehlt die nötige Distanz, um jene Sinnbezüge herzustellen, die den geschichtlichen Tatsachen ihre Bedeutung verleihen. Im Gegensatz zum Zeithorizont der Augenzeugen ermittelt die Historiographie als verstehende Geisteswissenschaft die Bedeutung geschichtlicher Ereignisse aus dem zeitlichen Abstand. Sie sondiert die Kontexte, innerhalb derer den Ereignissen ihre geschichtliche Bedeutung zuwächst, womit die Geschichtswissenschaft methodisch ins Feld der Hermeneutik gehört. Ihre genuine Kompetenz ist das Sinnverstehen und ihre charakteristische Darstellungsform die Erzählung. Beides stand dem Romantiker Friedrich Schlegel vor Augen als er schrieb, der Historiker sei „ein rückwärtsgewandter Prophet“.[4] Fassen wir die Historiographie als eine hermeneutische Wissenschaft auf, lässt sich die Stoßrichtung des ethischen Einwands von Lanzmann präziser angeben. Um die Shoah zu verstehen, müsste eine Geschichtswissenschaft, die hermeneutisch vorgeht, von der grundlegenden Hypothese ausgehen, die Vernichtung von sechs Millionen Juden sei ein interpretationsbedürftiges, im Kern sinnhaftes Faktum. Nur wenn Ereignissen die Möglichkeit von Sinn attestiert wird, gibt es Arbeit für das Verstehen. Eben diese notwendige Sinnunterstellung weist Lanzmann angesichts der Shoah als obszön zurück. Folglich kritisiert er die Geschichtswissenschaft sowohl in ihrem erklärenden wie in ihrem verstehenden Anspruch. Ich glaube, dass es dafür zwei unterschiedliche Motive gibt. „Tout comprendre“, sagt man in Frankreich, „c’ést tout excuser.“ (Alles verstehen, heißt alles entschuldigen.) Weigert sich Lanzmann, die Shoah zu verstehen, so deshalb, weil ein derartiges Verstehen seiner Meinung nach Gefahr läuft, die Täter zu exkulpieren. Das Verstehen könnte gar nicht anders verfahren, als ihren monströsen Handlungen bestimmte Motive und Überzeugungen zu zuschreiben. Es müsste Zwecke unterstellen, aus denen sich die angewandten Mittel herleiten. Kurz, die Geschichtswissenschaft würde am Ende nicht umhin können, eine dem Geschehen der Shoah eigene Rationalität zu postulieren, die rekonstruierbar wäre. Und tatsächlich hat die so genannte funktionalistische Schule innerhalb der NS-Historiographie – in Deutschland etwa durch einen Historiker wie Götz Aly vertreten – einen solchen Deutungsansatz entwickelt. Dass einem verdienstvollen Geschichtswissenschaftler wie Aly apologetische Absichten fremd sind, muss nicht eigens betont werden. Aly würde sich den Vorwurf, die Täter kraft seiner Deutungen entlastet, womöglich sogar entschuldigt zu haben, mit triftigen Argumenten verbitten. Dennoch hat gerade sein Ansatz vehemente Kritik auf sich gezogen, denn jeder Versuch, die Funktionslogik der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik zu rekonstruieren, muss die Binnenperspektive der Opfer aus systematischen Gründen ausblenden. Auch Götz Alys zweifelsohne minutiös recherchierte Einsichten waren nicht ohne Blindstellen zu gewinnen. Mithin darf durchaus gefragt werden, ob der Preis, den eine funktionalistische Deutung der Endlösung zu zahlen hat, moralisch in Ordnung geht oder zu hoch ausfällt. Vielleicht wollen wir ja gar nicht wissen, ob es eine konsistente Handlungslogik der Vernichtung gibt, wenn die Bedingung dafür, den Gang der entsetzlichen Ereignisse Stück um Stück zu verstehen, der Verzicht auf das Mitgefühl für die Leiden der Ermordeten wäre? Selbstverständlich muss man dabei nicht so weit wie Lanzmann gehen und es geradewegs für obszön halten, die Motive von Mördern und Schreibtischtätern zu ermitteln. Dennoch bleibt sein Bedenken plausibel, eine subtile Analyse der Täter und der ihr Handeln steuernden Imperative sei angesichts des ungeheuren Ausmaßes ihrer Verbrechen moralisch anstößig. Golo Manns Kritik an der Hitler Biographie von Joachim Fest betrifft exakt diesen Punkt. Er hat dem Historiker Fest nicht mangelnde Sorgfalt bei der Erledigung seiner geschichtswissenschaftlichen Aufgaben angekreidet, sondern dem Hitlerbiographen den moralischen Vorwurf gemacht, seinem Protagonisten in einer mehr als tausend Seiten umfassenden Monographie gewissermaßen zu viel der Ehre erwiesen zu haben.[5] Der Versuch, die Shoah geschichtlich zu verstehen, lässt sich aber nicht nur deshalb als fragwürdig verwerfen, weil er der Rationalisierung eines industriell organisierten Massenmords Vorschub leistet. Lanzmanns Kritik der Geschichtswissenschaft beruht noch auf einem weiteren, nicht minder prinzipiellen Einwand. Dieses Bedenken klingt in Äußerungen an, die aus einem Gespräch mit Lanzmann stammen, das in der Berliner Zeitung veröffentlicht wurde: „Eines schönen Tages begann das Töten. Und es gibt einen Bruch, eine Kluft zwischen den sogenannten Gründen und der Ermordung von Kindern und nackten Frauen. Mit der Frage ‚Warum’ entzieht man sich der Realität. (…) Wer ‚Warum’ fragt, sieht der Wahrheit nicht ins Gesicht.“[6] In diesen Worten scheint Lanzmann seine bereits angeführten Zweifel an kausalen Erklärungen des Genozids bloß zu variieren. Doch ist bemerkenswert, mit welchem Nachdruck er die Unverbundenheit von Gründen und Taten konstatiert wird. Lanzmann sagt, sie seien durch „eine Kluft“ getrennt. Hat das Töten aber, wie ein unüberhörbarer Zynismus feststellt, „eines schönen Tages“ einfach begonnen, ist der Konsequenz kaum noch auszuweichen, die Lanzmann zieht: Wenn es tatsächlich keine nachvollziehbare Verknüpfung zwischen subjektiven Motiven und den mörderischen Vernichtungsaktionen gibt, wenn die Mörderei tatsächlich derart kontingent, derart beliebig beginnt, dann muss eine Deutung, die dennoch daran festhält, nach dem Warum zu fragen, die nackte Faktizität des genozidalen Verbrechens verkennen. Sie unterschiebt völlig entgrenzten Gewalttätigkeiten Motivationen, die so nicht bestanden haben, also auch nichts verstehbar machen. Unter einer solchen Perspektive erscheint die Geschichtswissenschaft als eine Veranstaltung, die unter dem Vorwand, den Genozid aufklären zu wollen, dessen Wirklichkeit ignoriert. Wo angesichts von Gewaltpraktiken, die ihren Zweck nur noch in sich selbst haben, nach Gründen, Ursachen und Motiven gefragt wird, schiebt sich nach Lanzmanns Überzeugung ein verzerrender Filter vor die Realität selbstzweckhafter Gewalt. Der Wahrheit wird dann, wie Lanzmann betont, gar nicht ins Gesicht gesehen. Vielmehr verwandelt sich die Wissenschaft, um einen Gedanken des Ethnologen und Psychoanalytiker Georges Devereux ins Spiel zu bringen, in eine Methode, Angst abzuwehren.[7] Es ist eine als wissenschaftliche Geschichtsschreibung kamouflierte Angstabwehr, die Lanzmanns moralischen Einspruch provoziert.
Lanzmanns Sicht auf die ShoahNun drängt sich allerdings die Frage auf, welche Wahrheit Lanzmann meint, welche geschichtliche Wirklichkeit er vor den historisch Gebildeten unter ihren Verächter retten will? Damit wird der zweite Schritt fällig, also die Beschäftigung mit dem Problem, wie Lanzmann, wenn er den Warum-Fragern eine Verleugnung der Wirklichkeit vorwirft, seinerseits die Shoah sieht. So weit mir bekannt ist, hat Lanzmann diese für seine Arbeit als Filmautor von Shoah zentrale Frage nie direkt und ausdrücklich beantwortet. Selbstverständlich würde er mit Fug und Recht behaupten, der Film selbst formuliere seine Antwort. Was wir dort gezeigt bekommen, legt aber genauso wie alle bisher herangezogenen Aussagen von Landsmann den Schluss nahe, dass er die Shoah, anders als Hannah Arendt, nicht als eine geschichtliche Erscheinung der „Banalität des Bösen“ betrachtet, sondern als eine Manifestation des absolut Bösen, wobei „absolut“ im Wortsinne zu verstehen ist, nämlich als das grundlos Böse. Insofern wäre Lanzmann zufolge die Shoah, um noch einmal den von ihm geschätzten Philosophen Leibniz heranzuziehen, kein „mal physique“, also kein natürliches Übel oder Böses, das mit Verstandeskräften zu begreifen wäre, sondern ein „mal metaphysique“, d.h. ein übernatürliches, eben ein metaphysisches Böses. Und vor einem solchen Phänomen kann die menschliche Vernunft nur versagen. Denn es stellt nicht bloß die Geschichte, sondern die Welt als Ganze, als Kosmos oder auch als Schöpfung, kurz und neutraler gesagt: als eine intelligible, als eine verstehbare Ordnung in frage. Wer sich weigert, das absolut Böse zu verstehen, ist – so gesehen – tatsächlich von höchster Klarsicht. Warum? Weil er sich weigert, ein Faktum in der Absicht zu missdeuten, auch nach Auschwitz die geschichtliche Welt und die menschliche Natur noch für vernünftig halten zu können. Er verabschiedet sich, anders gesagt, von der optimistischen Annahme, dass Sein und Sinn der Welt konvergieren. Ihm will nicht mehr einleuchten, dass diese Welt trotz aller Übel die beste aller möglichen Welten sei. „Ich war ein Pferd mit Scheuklappen“, hat Claude Lanzmann über seine Arbeit an der Fertigstellung von Shoah gesagt, „das weder nach links noch nach rechts geschaut, sondern sich mit dem konfrontiert hat, was ich ‚die schwarze Sonne’ der Shoah nenne.“[8] Dieses lichtlose Zentralgestirn ist Lanzmanns Metapher für die Realität des absolut Bösen. Als wen wir uns den Filmemacher Lanzmann vorzustellen haben, ist damit amtlich. Offenkundig weder als einen Historiker mit Ariflex noch als einen Dokumentarfilmer in pädagogischer Mission. Er hat keine Bilder gesucht, die historisches Wissen visualisieren, um es einem breiten Publikum nahe zu bringen. Lanzmann stand vor einem ganz anderen Problem. Er wollte etwas sichtbar machen, das sich seiner eigenen Auffassung zufolge der Darstellbarkeit entzieht. Ist der Film eine Lichtspielkunst, kann eine schwarze Sonne kein möglicher Gegenstand des Kinos sein. Wie hat Lanzmann dieses Dilemma beseitigt? Diese Frage führt zum dritten Schritt, also zum Übertritt auf filmästhetisches Gelände. Lanzmanns FilmästhetikAuf Alfred Hitchcock geht die These zurück, dass die einzige ästhetische Form, die das 20. Jahrhundert hervorgebracht habe, die Montage sei. Hitchcock erkennt im Filmschnitt, d.h. in dem Verfahren, Einzelbilder nebeneinander zustellen und dadurch eine Bildfolge zu erzeugen, eine in der Entwicklung der darstellenden Künste völlig neue Technik, eine Geschichte zu erzählen. Indem die Montage vorgefundene oder vorgefertige Bilder zu narrativen Sequenzen zusammenfügt, erzeugt sie eine visuelle Wirklichkeit, die über das in den Bildern selbst abgebildete Reale hinausweist. Nun wäre es zweifelsohne eine Verkürzung, wollte man das Wesen einer Kunst mit ihrer je eigenen Technik identifizieren. Wie die Sprache so ist auch die Kunst stets eine Synthese von Technik und Vision. Deshalb ist die Behauptung, die Filmkunst sei der Filmschnitt allenfalls eine halbe Wahrheit. Dennoch lohnt es sich, zumindest einen Moment lang darüber nachzudenken, was das Material des Filmschnittes, also das fotografische Einzelbild, für die Repräsentation von Vergangenheit leistet. In seinen essayistischen Arbeiten zur Fotografie hat der Literaturwissenschaftler und Zeichentheoretiker Roland Barthes eine für unsere Fragestellung wichtige Behauptung aufgestellt. Nach Barthes besteht die Bestimmung der Fotografie darin, dem Betrachter eines Fotos den Eindruck zu vermitteln: „Es ist so gewesen.“[9] Aus diesem Grund vertritt er die Auffassung, der Inbegriff der Fotografie verkörpere sich in einem alten, vergilbten Foto.[10] Dies verknitterte Stück glänzenden Papiers veranschaulicht, was die Fotografie als eine im 19. Jahrhundert, der Epoche des Historismus, erfundene Kulturtechnik bewirkt. Sie evoziert für ein wahrnehmendes Subjekt einen vergangenen Augenblick. „Ja,“ bestätigt der Betrachter des alten Fotos, „so ist es gewesen.“ Nun liegt das Spezifikum der fotografischen Evokation von Vergangenheit darin, dass sie diesen Augenblick zwar re-präsentiert, ihn wiedervergegenwärtigt, genau genommen allerdings – und darauf ist in unserem Zusammenhang der Akzent zu legen: als einen vergangenen Augenblick. Für den Betrachter der Fotografie dringt die Vergangenheit keineswegs unvermittelt in die Gegenwart bewussten Erlebens ein, so als sei sie nicht mehr Vergangenheit, nein, sie wird gerade als vergangene Gegenwart seinem Bewusstsein gegenwärtig. Worum es in diesem Zusammenhang geht, lässt sich mithilfe einer Kontrastierung schärfer fassen. In seinem Romanzyklus Auf der Suche nach der verlorenen Zeit beschreibt Marcel Proust in einer berühmt gewordenen Szene, wie sich im Bewusstsein des Erzählers, ausgelöst durch den Geschmack eines in Tee getauchten Plätzchens, einer Madeleine, ein aller willentlichen Erinnerung entzogener Augenblick wiedereinstellt.[11] Inspiriert durch die Gedächtnistheorie des Philosophen Henri Bergson interpretiert Proust das Phänomen der unwillkürlichen Erinnerung als die Erfahrung einer Epiphanie. Was diese Epiphanie, diese Wiedererscheinung eines vergangenen Bewusstseinsinhalts, ausmacht, ist der Umstand, dass die Vergangenheit für das die unwillkürliche Erinnerung erfahrende Subjekt Gegenwart wird. Die Vergangenheit ist gegenwärtig, aber gerade nicht als ein vergangener Augenblick. Vielmehr besitzt die wiedererscheinende Vergangenheit die Fülle der Erlebnisqualitäten einer gegenwärtigen Erfahrung. Deshalb kennzeichnet Proust die Epiphanie einer temps retrouvé, einer wiedergefundenen Zeit, als Glückserfahrung. In ihr wird die Vergänglichkeit der Zeit für einen ekstatischen Moment neutralisiert. So entsteht der Eindruck, als sei die Grenze, die gewöhnlich alle Vergangenheit unwiederbringlich von jeder Gegenwart scheidet, durchlässig. Die Vergangenheit findet sich in Gegenwart transformiert. Ausgehend von dem Unterschied zwischen Evokation und Epiphanie ließe sich die Rede von einer Gegenwart der Vergangenheit differenzieren. Mit ihr kann in Wahrheit nämlich Zweierlei gemeint sein: Entweder handelt es sich bei der Gegenwart der Vergangenheit um eine epiphanische Wiedervergegenwärtigung. Dann ist Vergangenheit in einer Weise gegenwärtig, die übrigens nicht nur Proust, sondern nach ihm auch Virginia Woolf oder Samuel Beckett literarisch gestaltet haben. Allesamt Schriftsteller, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts vom psychischen Phänomen der Epiphanie oder des Dèja vu geradezu besessen waren. Bei Proust ist bedeutsam, dass er das Bewusstseinsphänomen der Epiphanie an die unwillkürliche, eigentlich wäre zu sagen, an die unwillentliche Erinnerung gekoppelt hat. Wir können Epiphanien nicht durch Willensakte herbeiführen. Wird Vergangenheit auf epiphanische Weise zur Gegenwart, haben wir es mit einem Vorgang zu tun, der per definitionem unverfügbar ist. Gerade in dieser Unverfügbarkeit lag für Proust die Erklärung dafür, dass ein solches Erscheinen von Vergangenheit als ebenso real wie beglückend erlebt wird. Die Epiphanie sprengt das Zeitkontinuum und konfrontiert mit einer Vergangenheit, von der wir nicht einmal wussten, dass sie je Teil der Gegenwart unseres Erlebens gewesen ist. Oder es handelt sich – jetzt beziehe ich mich auf die zweite, mögliche Bedeutung des Ausdrucks „die Gegenwart der Vergangenheit“ – um eine Evokation im Sinne Barthes’. Dann ist die Vergangenheit jedoch als vergangene Gegenwart präsent. Auch hier steht für das erlebende Bewusstsein außer Zweifel, dass es so gewesen ist. Aber im Gegensatz zur Epiphanie ist die Evokation tatsächlich eine Repräsentation von Vergessenem. Dieses Vergessene kommt uns beim Anblick des alten Fotos als Vergessenes zu Bewusstsein. Und zugleich macht die Fotografie klar, dass eine Technik zu Gebote steht, kraft derer Erlebnisse vergangener Gegenwart wieder aufgerufen werden können. Jeder Schnappschuss aus dem letzten Sommerurlaub beruht auf der im Allgemeinen natürlich unreflektierten Voraussetzung, dass ein Augenblick festgehalten werden soll, um in einer noch unbestimmten Zukunft auf ihn als eine dann vergangene Gegenwart zurückblicken zu können. Von daher ist die Fotografie eine Mnemotechnik im Wortsinne und der Fotoapparat tatsächlich eine technische Prothese, die das notorisch eingeschränkte Leistungsvermögen des Gedächtnisses unerhört steigert. Genau so hat Roland Barthes sie, hier wäre nach dem Aufkommen digitaler Bildtechniken zu präzisieren, die analoge Fotografie denn auch begriffen. Barthes Konzeption hat den Vorzug, den Unterschied zwischen Evokation und Epiphanie herauspräparieren und die Fotografie als eine evokative Erinnerungstechnik vorstellen zu können. Außerdem lässt sich aus ihr noch eine weitere Behauptung entfalten, die sich zwanglos an Barthes Beobachtung anschließt, die analoge Fotografie repräsentiere die Vergangenheit im Modus eines So-ist-es-gewesen. Er stellt nämlich die kritische These auf, dass sich der Film eigentlich parasitär zur Fotografie verhalte. Darin, dass der Film aus dem fotografischen Material bewegte Filmsequenzen montiert, identifiziert Barthes einen Missbrauch der Fotografie:[12] Der Film macht sich das „So ist es gewesen“ der Fotografie gewissermaßen illegitimerweise zu eigen. Er usurpiert damit die evokative Kraft der Fotografie für sich. Gerade der aller Filmkunst eigene Realismus verdankt sich diesem Transfer. Das „So ist es gewesen“ einer einzelnen Fotografie überträgt sich im Kino auf die Gesamtheit der laufenden Bilder. Auf diese Weise profitiert das Kino von Voraussetzungen, die es nicht selber schafft, sondern der Fotografie entlehnt. Und genau diese Entlehnung erlaubt es dem Film, Geschichte in einer Weise zu inszenieren, die bis zu dem Punkt führen kann, wo die Vergangenheit nicht als vergangene Gegenwart, also evokativ, sondern tatsächlich epiphanisch, d.h. als gegenwärtige Vergangenheit repräsentiert wird. Jeder historische Ausstattungsfilm liefert den Beleg dafür, dass Vergangenheit im Kino als Gegenwart zur Erscheinung kommen soll. Die eigentümliche Faszination, die von derartigen Inszenierungen historischer Stoffe ausgeht, beruht gerade darauf, dass sämtliche Zeichen getilgt werden, die dem Kinozuschauer zu Bewusstsein bringen könnten, dass er gerade einer cinematografischen Suggestion aufsitzt, dass er Bilder, die Evokationen sind, wahrnimmt, als ereigne sich vor seinen Augen eine Epiphanie. In einer Stellungnahme zu Bernd Eichingers Produktion Hitlers Untergang hat Woody Allen gesagt, er habe den Film ganz wunderbar gefunden, sich beim Zuschauen allerdings gefragt, ob auf dem Nachtisch von Eva Braun im Bunker der Reichskanzlei wirklich ein Photo von Bruno Ganz gestanden habe. Besser, schärfer und vernichtender lässt sich der fingierte Verismus derjenigen Inszenierungen von Geschichte nicht kritisieren, die Vergangenheit präsentieren als sei sie erlebbare Gegenwart. Allens Witz trifft den Nagel auf den Kopf und führt zugleich auf Lanzmanns Filmkunst zurück. Denn dessen Filmästhetik ist in zwei bedeutsamen Hinsichten asketisch. Sie verzichtet nämlich sowohl auf die Evokation von Vergangenheit wie auf deren Epiphanie. Folglich missbraucht Shoah die Fotografie auch nicht in dem Sinne, den Barthes erkannt und an der Filmkunst kritisiert hat. Die Geste eines So-ist-es-gewesen ist Shoah gänzlich fremd. Warum? Weil Lanzmann seinen Film sowohl als entschiedener Kritiker einer geschichtswissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem absoluten Bösen wie auch als ein radikaler Bildskeptiker gestaltet hat. Aus den dargelegten Gründen kann es nach Lanzmann keine Fotografie und schon gar keine Sequenz bewegter Bilder geben, auf der die Realität des absolut Bösen sichtbar würde. Zur Weigerung, die Shoah zu verstehen, muss die Weigerung gehören, Bilder zu zeigen, die den Anspruch erheben, deren historische Wahrheit zu veranschaulichen. Was Lanzmann demgegenüber tut, ist gerade den Filmschnitt als ein Verfahren zu nutzen, das den Vorgang der Erinnerung selbst thematisiert. Lanzmann hat begriffen, dass die filmische Montage gestattet, nicht nur anzudeuten, sondern buchstäblich zu zeigen, wie die Vergangenheit durch Auslassung, durch Lücken, durch Brüche und Diskontinuitäten vergegenwärtigt wird. Shoah repräsentiert die Vergangenheit nicht, vielmehr vergegenwärtigt der Film, dass sie uns nur im Medium fragmentierter und fragmentierender Erinnerungsakte zugänglich ist. Insofern kann es dem Film gar nicht um eine oder die Geschichte gehen, vielmehr muss er sich auf den Vorgang stets prekären Erinnerns konzentrieren. Aus diesem Grund erzählt Shoah auch keine lineare Geschichte. In diesem Film besitzt das epische „Und“, das ein Vorher mit einem Nachher verbindet, womöglich sogar kausal, keinen Ort. Lanzmann treibt seinen programmatischen Ikonoklasmus dadurch auf die Spitze, dass er sich die Verwendung von Dokumentarmaterial, das ja in Hülle und Fülle zur Verfügung gestanden hätte, versagt. Abgesehen von der Karte des Lagers Treblinka, auf die Unterscharführer Suchomihl mit einer abgeschnittenen Angelrute weist, die Lanzmann ihm als Zeigestock an die Hand gegeben hatte, und abgesehen von dem aus dem Off vorgelesenen Schreiben Walter Rauffs, in dem der im Reichssicherheitshauptamt beschäftigte „Gruppenleiter technische Angelegenheiten“ die technische Optimierung der Gaswagen beschreibt, tauchen „Quellen“, wie eingangs unterstrichen, nicht auf. Im Grunde zeigt der Film immer und immer wieder, dass Lanzmann einem dokumenten- oder quellengestützten Erinnern völlig misstraut. Sobald ein Interviewpartner auf etwas zu sprechen kommt, das als das Wissbare, als die doxa, als die bereits geläufige Narration der Endlösung bezeichnet werden könnte, unterbricht er ihn und stellt die gleiche Frage: was haben Sie gesehen? Lanzmann setzt mithin auf die Kraft des mündlichen Berichts und auf Bilder, die ausschließlich und bezeichnenderweise zeigen, wie Schauplätze von damals heute, d.h. zum Zeitpunkt der Dreharbeiten, aussehen. Er evoziert die Vergangenheit nicht als vergangene Gegenwart, schon gar nicht als epiphanische Gegenwart. Was wir demgegenüber sehen, sind die Spuren, die ein vergangenes Geschehen hinterlassen, mit denen es sich in die Gesichter der Opfer und Täter eingezeichnet hat. Die Zeit des Films ist das Jetzt solcher Spuren und die leiblich-stimmliche Gegenwart seiner Gesprächspartner. Was und nach welcher Logik sie erinnern, wird für den Zuschauer vor allem durch die Schnitte und Gegenschnitte sinnfällig, mit denen Lanzmann diese Spuren und Auskünfte kontextualisiert. Uns wird nicht gesagt, dieser Zeuge lügt oder irrt sich gerade: Wir haben es aus der angebotenen Schnittsequenz zu ermitteln, wenn wir es denn überhaupt ermitteln. Da also nicht Geschichte im Vordergrund steht, sondern das Gedächtnis, wird die Erinnerung als ein stets subjektives und zerbrechliches Vermögen thematisch, folglich notgedrungen auch das Vergessen – vorsichtiger gesprochen: dasjenige, was sich der Anstrengung des Erinnerns entzieht oder ihr verweigert. Wir sehen, welche Widerstände, ja welche affektiven Qualen einzelne Interviewpartner überwinden müssen, um weiter sprechen, um Zeugnis ablegen zu können. Lanzmann veranschaulicht, dass die Erinnerung – weit davon entfernt, ein bloß kognitiver Prozess zu sein – immer auch ein affektiver Vorgang ist. Wenn Sören Kierkegaard geschrieben hat, alle Erkenntnis sei gestimmte Erkenntnis, so erfährt der Zuschauer bei Lanzmann, dass dies auch auf die Erinnerung zutrifft. Gerade diese Facetten des Erinnerns reflektiert die Wissenschaft in aller Regel nicht. Auf die Widerstände, die sich der Erinnerung in den Weg stellen, kommt die Geschichtswissenschaft nicht zu sprechen. Und wenn doch, dann in methodologisch gewissermaßen schon gezügelter Form, also durch die so genannte „Quellenkritik“. Das Wort Historie geht auf das griechische Verb „historein“ zurück. Damit wurde, lange bevor die Berufsgruppe der Historiker entstand – sie traten erst relativ spät, nämlich im 5. Jahrhundert vor Christi Geburt auf – die Tätigkeit eines Zeugen vor Gericht bezeichnet. Ihm obliegt es, ausschließlich und nur von dem zu berichten, was er mit eigenen Augen gesehen hat. Aussagen, die sich auf bloßes Hörensagen beziehen, sind im Gerichtsverfahren untersagt. Deshalb muss sich ein Zeuge gegebenenfalls auch Nachfragen gefallen lassen, mit denen die Zuverlässigkeit seiner Aussagen und seine persönliche Glaubwürdigkeit überprüft werden. Noch bei Herodot, der als Vater der abendländischen Geschichtsschreibung gilt, schwingt dieses Verständnis von „historein“ nach. Er hat den direkten Augenschein als die beste Methode der Geschichtsschreibung bewertet und als zweitbeste die Sammlung von Berichten zuverlässiger Augenzeugen.[13] Sollte man in einem Wort sagen müssen, wie Lanzmann die Geschichte der Shoah inszeniert hat, so wäre zu antworten, aus dem Geiste Herodots: Shoah ist ein imaginäres Tribunal, vor dem Zeugen auftreten, die aus ihrer Erinnerung und nur aus ihrer Erinnerung berichten, wie die Dinge geschehen sind. Ein abschließendes Urteil wird nicht gefällt. Anmerkungen[1] Siehe Interview mit Claude Lanzmann, Spex, Nr. 313, März/April 2009. [2] „Pourquoi est-ce que c'est arrivé aux juifs? Cette question est totalement obscène. Toutes les raisons qu'on peut donner sont peut-être nécessaires mais non suffisantes.“ Siehe “Les cents vies de Claude Lanzmann”, Interview mit Claude Lanzmann, Nouvel Observateur, 5. März 2009. [3] „Et c'était la seule façon de procéder, cet aveuglement était le mode le plus pur du regard, la clairvoyance même.“ Ebd. [4] Siehe Friedrich Schlegel, Athenäums-Fragment 80, in: Friedrich Schlegel, Kritische Ausgabe seiner Werke: Charakteristiken und Kritiken I (1796 - 1802), hrsg. von Ernst Behler, Jean J. Anstett und Hans Eichner, Paderborn 1974, Bd. II, S. 176. [5] „Sie haben Hitler zu gross gemacht, Sie haben ihn nicht schlecht genug gemacht, Sie haben seine positiven Ideen zu ernst genommen;“ Golo Mann, Briefe 1932 – 1992, hrsg. Von Tilmann Lahme und Kathrin Lüssi, Veröffentlichungen der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, Bd. 87., Göttingen 2006, Brief an Joachim Fest vom 9. Februar 1974, S. 219-221, hier S. 220. Zum Phänomen Hitler siehe auch Brief an J. Fest vom 25. November 1986, S. 301-305, insbesondere S. 303. Dieser Brief wurde später auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 6. Juni 2006 abgedruckt. Instruktiv zudem die von Golo Mann verfasste Rezension über Fests Hitler-Biographie „Hitler – zum letzten Mal?“ Zu Joachim C. Fests großer Biographie“ in der Süddeutschen Zeitung vom 13./14. Oktober 1973. [6] Berliner Zeitung, Magazin, 29. Januar 2009, das Gespräch mit Lanzmann führte Natascha Freundel [7] vgl. Georges Devereux, Angst und Methode in den Verhaltenswissenschaften, Frankfurt am Main 1998. [8] „J’étais un cheval avec des oeillères, ne regardant ni à droite ni à gauche, mais affrontant ce que j'appelle le «soleil noir» de la Shoah. “, siehe Nouvel Observateur, a.a.O. [9] „Meine Hypothese (seit langem, doch nie vollständig ausgearbeitet; was ich in einer kommenden Arbeit – und zwar bald – tun will) = Das Noema der Photographie ist beim ‚Es-ist-so-gewesen’ zu finden.“ Siehe Roland Barthes, Die Vorbereitung des Romans, Vorlesung am Collège de France 1978-1979 und 1979-1980, hrsg. von Éric Marty, Texterstellung, Anmerkungen und Vorwort von Nathalie Léger, Frankfurt am Main 2008, S. 128. Die angekündigten Analysen werden dann in ders., Die helle Kammer. Bemerkungen zur Photographie, Frankfurt am Main 2008, entwickelt. Siehe dort S. 86f. [10] „Ich möchte behaupten, das Sein der Photographie liege nicht in den Hochglanzphotos von Paris Match oder der Zeitschrift Photo, sondern im gealterten Photo.“ Siehe Roland Barthes, Die Vorbereitung des Romans, a.a.O., S. 130. [11] Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, Édition établie et présenté par Pierre Clarac et André Ferré, Bd. I, Paris 1954, S. 46-48. [12] „Der Film missbraucht das Noema der Photographie. In Wirklichkeit ist es nicht so gewesen, sondern die Wirklichkeit ist vollständig umgearbeitet, manipuliert worden, nach Art einer chemischen ‚Synthese’; Erfahrung bei Dreharbeiten: a) Umstellung der Reihenfolge bei der Aufnahme und bei der Wiedergabe = Montage; b) Dissoziation von Bild und Ton: Nachsynchronisierung.“ Roland Barthes, Die Vorbereitung des Romans, a.a.O., S.129. [13] siehe Arnaldo Momigliano, „Die griechische Geschichtsschreibung“, in: ders., Ausgewählte Schriften zur Geschichte und Geschichtsschreibung, hrsg. von Glenn W. Most unter Mitwirkung von Wilfried Nippel und Anthony Grafton, Band 1, Die Alte Welt, hrsg. von Wilfried Nippel, Stuttgart/Weimar 1998, S. 19 -59, insbesondere zu Herodot und Thuykidides, S. 24f. |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/61/mb1.htm
|
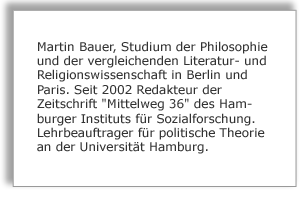 Dass Claude Lanzmanns preisgekrönter Film Shoah Epoche gemacht hat, dürfte unstrittig sein. Nach elfjährigen Vor- und Dreharbeiten in Europa, Israel und den Vereinigten Staaten fand die Premiere des Mammutwerks vor knapp einem Vierteljahrhundert im November 1985 statt. Ein Jahr später wurde der vierteilige Film über die Vernichtung der europäischen Juden zum ersten Mal in Deutschland gezeigt, auf dem „Forum des jungen Films“ während der Berlinale. Seither ist der neuneinhalbstündige Film, der sich im Wesentlichen auf Interviews mit Zeitzeugen konzentriert, nur noch sehr selten in bundesrepublikanischen Kinos zu sehen gewesen. Die meisten Bundesbürger werden Shoah im Fernsehen gesehen haben, wo er verschiedentlich in dritten Programmen ausgestrahlt wurde.
Dass Claude Lanzmanns preisgekrönter Film Shoah Epoche gemacht hat, dürfte unstrittig sein. Nach elfjährigen Vor- und Dreharbeiten in Europa, Israel und den Vereinigten Staaten fand die Premiere des Mammutwerks vor knapp einem Vierteljahrhundert im November 1985 statt. Ein Jahr später wurde der vierteilige Film über die Vernichtung der europäischen Juden zum ersten Mal in Deutschland gezeigt, auf dem „Forum des jungen Films“ während der Berlinale. Seither ist der neuneinhalbstündige Film, der sich im Wesentlichen auf Interviews mit Zeitzeugen konzentriert, nur noch sehr selten in bundesrepublikanischen Kinos zu sehen gewesen. Die meisten Bundesbürger werden Shoah im Fernsehen gesehen haben, wo er verschiedentlich in dritten Programmen ausgestrahlt wurde. 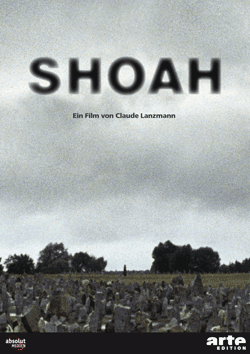 Die unbestreitbare Wirkungsmacht des Films ist sicherlich auch dem Bewusstsein geschuldet, dass Shoah eine der letzten Dokumentationen dessen gewesen ist, was in Vernichtungslagern wie Chelmo, Auschwitz, Sobibor und Treblinka geschah. Viele der Zeugen, die Lanzmann vor die Kamera gebeten oder mit versteckter Kamera überlistet hatte, sind inzwischen verstorben. Deshalb werden ihre Aussagen mittlerweile als Vermächtnisse wahrnehmbar. Die Berichte der Opfer, die Einlassungen der Täter und die Passsagen des Films, in denen sich Zuschauer des damaligen Geschehens vor der Kamera äußern, haben freilich nicht nur die geschichtliche Wirklichkeit der Vernichtungspolitik des NS-Regimes auf beispiellose Weise in Erinnerung gerufen. Claude Lanzmann hat zudem die Widerstände, die Abgründe und Traumatisierungen, die Ignoranz und Gleichgültigkeit sichtbar gemacht, die zu überwinden sind, soll Erinnerung an das Geschehene möglich werden. Deshalb ist Shoah ein Dokument der je individuellen Anstrengung, Zeugnis für die Nachgeborenen abzulegen. Nicht zuletzt zeigt der Film aber auch, wie auf Seiten der Täter Erinnerung verweigert, Wissen geleugnet und Beteiligung abgestritten wird. Weil Shoah sich dem Gedächtnis der Zeugen zuwendet, ist das Werk notwendigerweise auch ein Film über das Vergessen geworden, dasjenige, das jedem Erinnernden widerfährt, wie dasjenige, das vorgeschoben und simuliert wird. Denn als ein subjektives Archiv des Erinnerns verfährt das private Gedächtnis stets selektiv. Es ist, pointiert gesagt, die Einheit von Erinnern und Vergessen, eine Charakterisierung, die im Übrigen nicht nur für das private, sondern auch für das öffentliche Gedächtnis zutrifft. Was überhaupt und in welcher Form es erinnert wird, geht letztlich auf Entscheidungen zurück, die politisch ausgehandelt werden. Jede Nation ist in ihrer kollektiven Identität immer auch durch kollektiv verbindliche Erinnerungsräume definiert.
Die unbestreitbare Wirkungsmacht des Films ist sicherlich auch dem Bewusstsein geschuldet, dass Shoah eine der letzten Dokumentationen dessen gewesen ist, was in Vernichtungslagern wie Chelmo, Auschwitz, Sobibor und Treblinka geschah. Viele der Zeugen, die Lanzmann vor die Kamera gebeten oder mit versteckter Kamera überlistet hatte, sind inzwischen verstorben. Deshalb werden ihre Aussagen mittlerweile als Vermächtnisse wahrnehmbar. Die Berichte der Opfer, die Einlassungen der Täter und die Passsagen des Films, in denen sich Zuschauer des damaligen Geschehens vor der Kamera äußern, haben freilich nicht nur die geschichtliche Wirklichkeit der Vernichtungspolitik des NS-Regimes auf beispiellose Weise in Erinnerung gerufen. Claude Lanzmann hat zudem die Widerstände, die Abgründe und Traumatisierungen, die Ignoranz und Gleichgültigkeit sichtbar gemacht, die zu überwinden sind, soll Erinnerung an das Geschehene möglich werden. Deshalb ist Shoah ein Dokument der je individuellen Anstrengung, Zeugnis für die Nachgeborenen abzulegen. Nicht zuletzt zeigt der Film aber auch, wie auf Seiten der Täter Erinnerung verweigert, Wissen geleugnet und Beteiligung abgestritten wird. Weil Shoah sich dem Gedächtnis der Zeugen zuwendet, ist das Werk notwendigerweise auch ein Film über das Vergessen geworden, dasjenige, das jedem Erinnernden widerfährt, wie dasjenige, das vorgeschoben und simuliert wird. Denn als ein subjektives Archiv des Erinnerns verfährt das private Gedächtnis stets selektiv. Es ist, pointiert gesagt, die Einheit von Erinnern und Vergessen, eine Charakterisierung, die im Übrigen nicht nur für das private, sondern auch für das öffentliche Gedächtnis zutrifft. Was überhaupt und in welcher Form es erinnert wird, geht letztlich auf Entscheidungen zurück, die politisch ausgehandelt werden. Jede Nation ist in ihrer kollektiven Identität immer auch durch kollektiv verbindliche Erinnerungsräume definiert.