Zwischen Eventmovie und Geschichtssoap

Neue Formen der filmischen Inszenierung von Geschichte zwischen Fiktion und Dokumentation
Kay Hoffmann
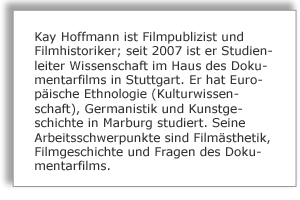 Seit den 90er Jahren findet eine starke Annäherung zwischen Dokumentarfilm und Spielfilm statt. Dokumentarfilmer haben sich viel vom Spielfilm abgeschaut. Dies gilt für die Dramaturgie, ihre Narration und die Auswahl ihrer Protagonisten. Es betrifft jedoch auch die Gestaltung der Filme, vom Schnitt über das Sound-Design bis hin zur Musik, die an die Emotionen der Zuschauer rührt. Diese Komponenten machen den Erfolg eines Dokumentarfilms im Kino aus, der inzwischen ein Millionen-Publikum erreichen kann. Im Fernsehen entstanden zahlreiche hybride Formen wie Doku-Drama, Doku-Soap, Zeitreisen bis hin zur Doku-Fiktion und auf historischen Ereignissen basierende Eventmovies oder die Reality-Formate, die eher der Unterhaltung zuzurechnen sind. Seit den 90er Jahren findet eine starke Annäherung zwischen Dokumentarfilm und Spielfilm statt. Dokumentarfilmer haben sich viel vom Spielfilm abgeschaut. Dies gilt für die Dramaturgie, ihre Narration und die Auswahl ihrer Protagonisten. Es betrifft jedoch auch die Gestaltung der Filme, vom Schnitt über das Sound-Design bis hin zur Musik, die an die Emotionen der Zuschauer rührt. Diese Komponenten machen den Erfolg eines Dokumentarfilms im Kino aus, der inzwischen ein Millionen-Publikum erreichen kann. Im Fernsehen entstanden zahlreiche hybride Formen wie Doku-Drama, Doku-Soap, Zeitreisen bis hin zur Doku-Fiktion und auf historischen Ereignissen basierende Eventmovies oder die Reality-Formate, die eher der Unterhaltung zuzurechnen sind.
Diese Entwicklung zur emotionaleren Gestaltung des Dokumentarfilms ist jedoch keine Einbahnstraße. Der Kinospielfilm adaptierte ebenso Strategien des Dokumentarischen, um authentischer zu wirken und den Geschichten dadurch mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen. Die Nutzung dokumentarischen Archivmaterials ist ebenso beliebt wie die Verwendung von grobkörnigem, etwas unscharfem Super 8-Amateurmaterial mit seiner spezifischen Farbigkeit. Liegt zu einem Ereignis, das damit dokumentiert werden soll, keine entsprechendes Material vor wird es entsprechend nachinszeniert. In manchen Sequenzen wird mit einer übertrieben wackeligen Handkamera gearbeitet, um eine vermeintliche Nähe zum Protagonisten herzustellen, Authentizität vorzuspiegeln oder um Spannung aufzubauen.
Auch für die Entwicklung gibt es aus den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Beispiele. Selbst in einem Blockbuster wie „Titanic“ setzte Regisseur James Cameron schon in den 90er Jahren auf eine dokumentarisch anmutende Rahmenhandlung von der letzten Überlebenden des Untergangs. Wolfgang Petersen verwendete für „In the Line of Fire“ in seiner Geschichte vom Duell eines Secret Service Veterans mit einem Attentäter authentisches Material aus amerikanischen Vorwahlkämpfen und ließ es so digital bearbeiten, dass man es für authentisch wirkende Wahlkampfauftritte im Spielfilm verwenden konnte. Dank moderner Effekttechnik wurde Tom Hanks als „Forrest Gump“ in historisches Archivmaterial integriert werden und traf berühmte Zeitgenossen wie John F. Kennedy oder Elvis Presley persönlich. Bei Woody Allens Klassiker „Zelig“ war dies 1983 nur mit Fotos möglich gewesen und einer ausgefeilten Montage. In diesen Beispielen hatten diese dokumentarischen Sequenzen jedoch eine andere Qualität, da sie damals wie ein Trick behandelt und als Effekt gefeiert wurden.
Eine neue Qualität erreichten im Spielfilmbereich die so genannten Dogma-Filme. Ein entsprechende Manifest, das international wahrgenommen wurde und rege Diskussionen auslöste, wurde im März 1995 von den dänischen Regisseuren Lars von Trier, Thomas Vinterberg, Kristian Levring und Søren Kragh-Jacobsen in Paris vorgestellt. Darin forderten sie auf die zunehmende Wirklichkeitsentfremdung des Spielfilms, auf Effekte und technische Raffinessen völlig zu verzichten. Die nach Dogma-Regeln gedrehten Filme sollten unter den Bedingungen von Dokumentarfilmen entstehen, das heißt ohne Stativ, ohne zusätzliches Licht usw. Der Kameramann kannte oft nicht das Drehbuch und sollte spontan auf die jeweilige Situation reagieren. Selbst wenn dies Prinzip nicht immer durchgehalten wurde, weckten die Dogma-Filme eine neue Aufmerksamkeit für die Wahrhaftigkeit und Realitätsbezug der Bilder im Spielfilm.

Einige aktuell im Kino gestartete Spielfilme sind gute Beispiele für die Annäherung zum Dokumentarischen und die Entwicklung der vergangenen Jahre. Der französische Spielfilm „Entre les murs“ („Die Klasse“) von Laurent Cantet wurde 2008 bei den Filmfestspielen in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet. Im Mittelpunkt steht der Alltag einer Schule in einem sozialen Brennpunkt in Paris, deren Schüler überwiegend aus Migrantenfamilien kommen. Der Film basiert auf einen Tatsachenroman des Lehrers François Bégaudeau, der im Film dann auch selbst die Hauptrolle des Lehrers übernimmt. Die Produktionsfirma und der Regisseur veranstalteten zunächst einen Schauspielworkshop mit rund 50 Schülern, von denen dann 28 im Film mitspielen. Die Darsteller sind echte Schüler, die von ihrer Mimik und Gestik authentisch wirken, Szenen improvisieren dürfen, ihre Sprache sprechen, jedoch dabei bestimmte, im Drehbuch entwickelte Rollen übernehmen. Insbesondere ihre Improvisation und die Rasanz der Dialoge war eine Herausforderung für die Kameraleute. Im Klassenzimmer wurde mit drei elektronischen hoch auflösenden High Definition-Kameras gedreht, um verschiedene Aspekte gleichzeitig aufnehmen zu können: den Lehrer, die agierenden Protagonisten und Atmosphärisches. „So wirkt ‚Die Klasse’, wenn man den Film nicht als erzählerisches Ganzes, sondern Szene für Szene betrachtet, tatsächlich wie eine besonders sorgfältig geschnittene Reportage. Wie sehr man sich täuschen kann. Denn Cantets Film ist alles andere als ein aufgeschnapptes Stück Alltag. Er ist eine hochverdichtete, haargenau strukturierte Version jener Realität, von der er erzählen will, und nur die besondere Geschicklichkeit des Regisseurs lässt uns immer wieder vergessen, dass es sich bei der ‚Klasse’ um einen Spielfilm handelt“, kommentierte Andreas Kilb[1] in der Frankfurter Allgemeinen. Auch der italienische Spielfilm „Gomorra“ (2008) von Matteo Garrone basiert auf einen Tatsachenroman des Journalisten Roberto Saviano, in der er die organisierte Kriminalität in Süditalien aufdeckt. Nach dem Erscheinen des Buches musste er unter Polizeischutz gestellt werden. Es ist ein spannender Episodenfilm, der den Alltag der kleinen Leute aus den abbruchreifen und heruntergekommenen Vororten Neapels schildert. Dabei wird zugleich deutlich, wie korrupt die von der Mafia kontrollierte Gesellschaft ist. Der Regisseur arbeitete mit Laiendarstellern und drehte viele der Einstellungen mit einer Handkamera, die den Film dokumentarisch erscheinen lassen. Auch in diesem Beispiel sind die Grenzen zum Fiktivem und Authentischen fließend.
 Der für den Oscar nominierte Film „Der Baader Meinhof Komplex“ (2008) von Uli Edel bemüht sich um ein möglichst den historischen Fakten entsprechendes Bild der RAF und ihrer Gewaltakte. Der Film wurde vom deutschen Erfolgsproduzenten Bernd Eichinger produziert, der in Zusammenarbeit mit dem früheren Spiegel-Chefredakteur Stefan Aust das Drehbuch schrieb und dessen gleichnamiges Buch als Grundlage nahm. Daneben wurden Dokumentationen wie die SDR-Produktion „Der Polizeistaatsbesuch“ (1967) von Romand Brodmann, Artikel und Fotoreportagen studiert und aufwändig reinszeniert, die Tonbandprotokolle der Prozesse abgehört und im originalen Gerichtssaal in Stammheim gedreht. Obwohl dies deutlicher als die zuvor genannten Beispiele ein Spielfilm ist, der versucht, eine Entwicklung von zehn Jahren auf Spielfilmlänge zu komprimieren und die Attentate pyrotechnisch perfekt zu gestalten, musste durch ein juristisches Verfahren, ausgelöst von der Familie Ponto wegen der falschen Darstellung der Ermordung des Bankiers Jürgen Ponto, geklärt werden, inwieweit der Spielfilm dokumentarische Züge aufweist. Der Ponto-Anwalt bezeichnete ihn als Doku-Film. Das Gericht entschied schließlich, die Persönlichkeitsrechte seien durch die Darstellung nur in einem so geringen Maß tangiert, dass der Schutz der Kunst- und Informationsfreiheit überwiege. Ein anders lautendes Urteil hätte die Verfilmung von in der Öffentlichkeit stehenden Personen oder historischen Ereignissen in Zukunft sehr erschwert, wie schon die juristischen Auseinandersetzungen um „Contergan – nur eine einzige Tablette“ oder den ‚Kannibalen’ von „Rohtenburg“ gezeigt hatten. Der für den Oscar nominierte Film „Der Baader Meinhof Komplex“ (2008) von Uli Edel bemüht sich um ein möglichst den historischen Fakten entsprechendes Bild der RAF und ihrer Gewaltakte. Der Film wurde vom deutschen Erfolgsproduzenten Bernd Eichinger produziert, der in Zusammenarbeit mit dem früheren Spiegel-Chefredakteur Stefan Aust das Drehbuch schrieb und dessen gleichnamiges Buch als Grundlage nahm. Daneben wurden Dokumentationen wie die SDR-Produktion „Der Polizeistaatsbesuch“ (1967) von Romand Brodmann, Artikel und Fotoreportagen studiert und aufwändig reinszeniert, die Tonbandprotokolle der Prozesse abgehört und im originalen Gerichtssaal in Stammheim gedreht. Obwohl dies deutlicher als die zuvor genannten Beispiele ein Spielfilm ist, der versucht, eine Entwicklung von zehn Jahren auf Spielfilmlänge zu komprimieren und die Attentate pyrotechnisch perfekt zu gestalten, musste durch ein juristisches Verfahren, ausgelöst von der Familie Ponto wegen der falschen Darstellung der Ermordung des Bankiers Jürgen Ponto, geklärt werden, inwieweit der Spielfilm dokumentarische Züge aufweist. Der Ponto-Anwalt bezeichnete ihn als Doku-Film. Das Gericht entschied schließlich, die Persönlichkeitsrechte seien durch die Darstellung nur in einem so geringen Maß tangiert, dass der Schutz der Kunst- und Informationsfreiheit überwiege. Ein anders lautendes Urteil hätte die Verfilmung von in der Öffentlichkeit stehenden Personen oder historischen Ereignissen in Zukunft sehr erschwert, wie schon die juristischen Auseinandersetzungen um „Contergan – nur eine einzige Tablette“ oder den ‚Kannibalen’ von „Rohtenburg“ gezeigt hatten.
Dieser Trend zum realistischeren Spielfilm steht in einem engen Verhältnis zur Entwicklung des Dokumentarfilms im Kino, der sich seit den 90er Jahren ein neues Image aufgebaut hat und im Kino zum Teil ein Millionenpublikum erreichen kann. Verabschiedet wurden langweilige, langatmige, belehrende Formen, die den Zuschauer von bestimmten Ideen und Gesellschaftskonzepten überzeugen wollten. Der im Sommer 2009 verstorbene Dokumentarfilmer Peter Krieg („Septemberweizen“) bezeichnete diese Betroffenheits-Dokumentationen der 70er und 80er Jahre einmal als das einzige Schlafmittel, das man durch die Augen aufnähme. Seit der Einführung des dualen Fernsehsystems und Etablierung von kommerziellen Programmen ab 1984 muss jedes Fernseh-Programm sich dem Konkurrenzdruck stellen, überzeugen und das Publikum faszinieren. Viele Zuschauer sind der nichts sagenden Talkshows und Serien im Fernsehen überdrüssig und verlangen immer häufiger nach Realität. Auch beim Dokumentarfilm ist der Druck gewachsen, sich dem Wettstreit um die Einschaltquoten zu stellen. Dies bedeutet, dass sich Regisseure viel mehr Gedanken machen müssen, wie sie einen Stoff aufarbeiten, damit er von den Zuschauerinnen und Zuschauern akzeptiert wird. Der Dokumentarfilm hat sich lange Zeit dadurch verkauft, dass er vermeintlich wahre Bilder vom wirklichen Leben lieferte, d.h. er rühmte sich mit Etiketten wie authentisch, glaubwürdig, wahrhaft usw. Den Machern ist durchaus bewusst, dass auch die Produktion von Dokumentarfilmen ein künstlerischer Prozess ist, bei dem sie sowohl bei der Planung, wie beim Drehen und beim Schnitt ihren Gestaltungswillen verwirklichen. Das Vertrauen in den Abbildcharakter von Wirklichkeit im Dokumentarfilm wird seit den 90er Jahren durch die digitale Bildbearbeitung – oder um es polemisch auszudrücken: Bildmanipulation – zusätzlich in Frage gestellt. Sie macht es inzwischen möglich, sich jedes gewünschte Bild zu bauen. Bildern war nie und ist auch in Zukunft nicht zu trauen.
Die Geschichte des dokumentarischen Films macht deutlich, dass der Abbildungscharakter einer vorgefundenen Realität schon immer hinterfragt werden musste. Dies ergibt sich schon aus der verwendeten Filmtechnik. Die Kameras waren bis in die 20er Jahre sehr schwer, benötigten ein Stativ und ermöglichten deshalb nur Schwenks – eine Mobilität war zunächst nicht gegeben. Das Filmmaterial war nicht sehr lichtempfindlich, entweder musste bei Sonnenschein gedreht oder die Szene aufwändig mit starken Scheinwerfern ausgeleuchtet werden. Das Magazin in der Kamera umfasste zunächst 30 m bis max. 60 m, also Aufnahmen mit einer Länge von einer bis zwei Minuten. Jede Einstellung musste deshalb präzise vorbereitet werden, damit beim Drehen auch die gewünschten Ereignisse zu sehen waren.
 Lange Zeit wurde die Dualität zwischen Fiktion und Dokumentarischem idealtypisch an französischen Filmpionieren festgemacht. Der ehemalige Zauberer und Varietékünstler Georges Méliès galt demnach als Urvater des Spielfilms, die Brüder Lumière mit ihren Klassikern „Ankunft eines Zuges“ (1895) oder „Arbeiter verlassen die Fabrik“ (1895) wurden der dokumentarischen Seite zugeordnet. Doch diese klare Trennung wird inzwischen massiv hinterfragt. Filmhistoriker haben nachgewiesen, dass von den Aufnahmen der Lumières verschiedene Fassungen existieren, bei denen sich jedoch die dramaturgischen Strategien wie scheinbar zufällig durch das Bild geschobene Fahrräder oder durch das Bild laufende Hunde gleichen. Bereits diese frühen Bilder waren also inszeniert. Auf dem Bahnhof von La Ciotat findet sich die halbe Familie Lumière ein, um auf die Ankunft des Zuges zu warten und blickt dabei demonstrativ nicht in die Kamera. Auch nutzten sie Kameratricks, indem sie das Material rückwärts laufen ließen, wie für den Abriss und überraschenden Wiederaufbau einer Mauer. Andererseits ‚dokumentierte’ Georges Méliès ähnlich wie die Brüder Skladanowsky in Berlin einige Bühnennummern aus dem Varitetéprogramm, in das die Filmprogramme zunächst integriert waren. Die frühen Wochenschauen zeigten Ansichten von Ereignissen, die künstlerisch nicht gestaltet wurden. Ein Problem für die Kameraleute war über Jahrzehnte die Attraktivität des Apparates. Sobald er aufgestellt wurde, blieben die Leute auf der Straße stehen, grüßten oder winkten in die Kamera oder umrundeten sie mehrfach, um möglichst oft im Bild zu sein. Die Erfahrung, sich selbst auf der Leinwand übergroß sehen zu können, machte die Attraktivität von so genannten Lokalaufnahmen aus, die Unternehmen und Kinobesitzer produzierten und erfolgreich vorführten. Lange Zeit wurde die Dualität zwischen Fiktion und Dokumentarischem idealtypisch an französischen Filmpionieren festgemacht. Der ehemalige Zauberer und Varietékünstler Georges Méliès galt demnach als Urvater des Spielfilms, die Brüder Lumière mit ihren Klassikern „Ankunft eines Zuges“ (1895) oder „Arbeiter verlassen die Fabrik“ (1895) wurden der dokumentarischen Seite zugeordnet. Doch diese klare Trennung wird inzwischen massiv hinterfragt. Filmhistoriker haben nachgewiesen, dass von den Aufnahmen der Lumières verschiedene Fassungen existieren, bei denen sich jedoch die dramaturgischen Strategien wie scheinbar zufällig durch das Bild geschobene Fahrräder oder durch das Bild laufende Hunde gleichen. Bereits diese frühen Bilder waren also inszeniert. Auf dem Bahnhof von La Ciotat findet sich die halbe Familie Lumière ein, um auf die Ankunft des Zuges zu warten und blickt dabei demonstrativ nicht in die Kamera. Auch nutzten sie Kameratricks, indem sie das Material rückwärts laufen ließen, wie für den Abriss und überraschenden Wiederaufbau einer Mauer. Andererseits ‚dokumentierte’ Georges Méliès ähnlich wie die Brüder Skladanowsky in Berlin einige Bühnennummern aus dem Varitetéprogramm, in das die Filmprogramme zunächst integriert waren. Die frühen Wochenschauen zeigten Ansichten von Ereignissen, die künstlerisch nicht gestaltet wurden. Ein Problem für die Kameraleute war über Jahrzehnte die Attraktivität des Apparates. Sobald er aufgestellt wurde, blieben die Leute auf der Straße stehen, grüßten oder winkten in die Kamera oder umrundeten sie mehrfach, um möglichst oft im Bild zu sein. Die Erfahrung, sich selbst auf der Leinwand übergroß sehen zu können, machte die Attraktivität von so genannten Lokalaufnahmen aus, die Unternehmen und Kinobesitzer produzierten und erfolgreich vorführten.
Die bewusste Gestaltung des gedrehten Materials entwickelte sich in den 20er Jahren. Die Avantgarde entdeckte für sich die dokumentarische Aufnahme, entwickelte Theorien und ließ sich von internationalen Kollegen beeinflussen. Es fand zwischen Deutschland, der Sowjetunion, Frankreich, Italien, den Niederlanden und den USA ein reger Austausch statt – ob dies ausgefallene Kamerapositionen, den schnellen, rhythmischen Schnitt oder die Arbeit mit expressiver Vertonung und Musik oder die Themen betraf. Schon damals wurde die dokumentarische Funktion des Abbildes in Frage gestellt. Am bekanntesten ist wahrscheinlich Bertolt Brechts Aussage, dass ein Foto der Krupp-Werke von außen nichts darüber aussage, was in der Fabrik wirklich passiere an Produktion und Ausbeutung. Damit sprach er sich gegen einen naiven Realismusbegriff aus, der in der bloßen Abbildung die Wahrheit der Realität zu erkennen glaubte, und setzte ihm einen soziokulturellen Realismusbegriff entgegen. Auch der britische Dokumentarfilm-Pionier John Grierson sprach sich gegen eine solche Einschränkung aus und definierte den Dokumentarfilm als „creative treatment of actuality“, beinhaltete also die künstlerische Bearbeitung und inhaltliche Verdichtung des Materials. Dziga Vertov, der mit „Der Mann mit der Kamera“ (1929) einen der großen Klassiker des Avantgardefilms realisierte, forderte in seinen theoretischen Texten eine „kommunistische Dechiffrierung“ der vorgefundenen Wirklichkeit. Er forderte eine höchst mögliche Authentizität bei der Aufnahme, indem die Kamera Alltagssituationen aufnehmen sollte, ohne dass dies von den Gefilmten bemerkt werden sollte. Allerdings müsse der Filmemacher in der Montage eine politische und soziale Position beziehen und das Material entsprechend dechiffrieren.
In den 20er Jahren wurde der dokumentarische Film in Deutschland als Kulturfilm bezeichnet. In „Das Kulturfilmbuch“ wurde 1924 eine erste Bilanz dieses Genres gezogen und die verschiedenen Spezialgebiete erläutert. Wie selbstverständlich wurde Fritz Langs Spielfilm „Die Nibelungen“ als Kulturfilm diskutiert. Die Grenzen waren schon damals fließend. Dies zeigt auch der Film „Nanook of the North“ (1922) von Robert Flaherty, der das ursprüngliche Leben des Eskimos porträtiert und als Meilenstein des Dokumentarfilms gilt. Inzwischen ist auch hier bekannt, dass Flaherty genau wusste, welche Bilder er wollte. Seine Protagonisten für die Rolle der edlen Wilden wurden monatelang gecastet und Nanook eine Frau an die Seite gestellt, mit der er nicht verheiratet war. Die Eskimos mussten ihre Gewehre zur Seite legen und noch einmal traditionell mit Speeren jagen. „Vermutlich würde man ‚Nanook’ heutzutage als Spielfilm deklarieren. Dessen Wahrhaftigkeit liegt jedoch ganz entscheidend im Umgang mit den Inuit begründet“, analysiert Martina Knoben[2] in der Süddeutschen Zeitung und zieht einen Vergleich zu Cantets „Die Klasse“. Viele der Kulturfilme der 20er und 30er Jahre beinhalten neben real gedrehten Aufnahmen ebenfalls inszenierte und animierte Sequenzen. Heute würde man dies als hybride Formen bezeichnen, die damit ebenfalls eine längere Tradition haben und nicht erst in postmodernen Zeiten entstanden sind. Die Bedingungen, unter denen dokumentarische Filme entstanden, blieben im Prinzip bis Ende der 50er Jahre ziemlich ähnlich. Zwar entwickelte die Münchener Firma ARRI 1936 eine 35 mm-Handkamera, die Aufnahmen ohne Stativ und eine Kontrolle des Bildes über einen Sucher erlaubte. Damit die Tonaufnahme nicht gestört wurde, mussten die Kameras geräuschgedämpft werden durch eine sperrige Umhüllung, dem Blimp. Von daher wurde auch im Dokumentarfilm oft mit Stativ gedreht. Für Innenaufnahmen benötigte man in der Regel weiterhin Licht. Die Kameramagazine hatten eine Kapazität von 120 m, also ungefähr vier Minuten Länge. Häufig wurden dokumentarische Filme wegen dem Aufwand der Tonaufnahme stumm gedreht und erst im Schnitt mit Geräuschen, Kommentar und Musik verbunden. Verstärkt wurde mit 16 mm-Kameras gearbeitet, die handlicher waren. Eine synchrone Tonaufnahme war auch damit erst Ende der 50er Jahre möglich. Das war eine revolutionäre Wendung im Dokumentarfilm, da jetzt die Beobachtung des Alltags mit O-Ton möglich wurde. In den USA entwickelte sich daraus der Stil des Direct Cinema. Die Gruppe um Richard Leacock, Don Allen Pennebaker und Robert Drew entwickelten entsprechendes Equipment und das Konzept der „living camera“, die den Alltag in erster Linie beobachten und nicht in das Geschehen eingreifen sollte. Ziel war eine möglichst unmittelbare, nicht beeinflusste Darstellung der Wirklichkeit. Sie produzierten wichtige Filme wie „Primary“ (1960) über den Vorwahlkampf John F. Kennedys, „The Chair“ (1962) über die Todesstrafe und zahlreiche Musik-Dokumentationen. Häufig wird übersehen, dass sie hauptsächlich Themen mit einer gewissen dramaturgischen Spannung wählten und ebenfalls wesentlich mehr Material drehten, aus dem sie im Schneideraum ihren Film destillierten. Von daher sind auch die Filme des Direct Cinema bewusst gestaltete Produkte. Zum Verhältnis zur Fiktion sagte die amerikanische Regisseurin Jill Godmilow einmal ganz richtig: „Beide Genres sind hochgradig konstruierte Texte: Spielfilme werden geschrieben, bevor sie gedreht werden, und Dokus werden häufig im Schneideraum geschrieben. Beide Filmarten werden unzählige Male ‚neu geschrieben’, bevor wir sie auf der Leinwand sehen.“[3]
Insbesondere im Fernsehen findet seit zehn Jahren eine zunehmende Vermischung der Formen statt, die zu einer starken Präsenz dokumentarischer Formen im weitesten Sinn im Programm führen. Es ist keine Frage, dass es immer neue Experimente geben wird für die Vermischung von inszeniertem und dokumentarischem Material. Dies wird insbesondere im Fernsehen täglich praktiziert und ist dort auch sehr erfolgreich, wenn man beispielsweise an die zeitgeschichtlichen Programme denkt, die Geschichtsthemen populär gemacht haben und die Vergangenheit in bundesdeutsche Wohnzimmer bringen. Um Einschaltquoten zu erzielen verzichtet man darauf, vorhandenes Material zu kontextualisieren, sondern bindet es in eine spannende, dramaturgische Erzählung, die Emotionalität wecken und so die Zuschauer packen soll. Eine große Bedeutung kam dabei der amerikanischen Serie „Holocaust“ zu, die 1979 ausgestrahlt wurde und die westdeutsche Bevölkerung aufrüttelte. Als ob es vorher noch keine belehrenden Dokumentarsendungen über das Thema gegeben hätte, schien erst diese Produktion ihnen die Augen zu öffnen, was im Dritten Reich geschehen war. Der Historiker Rainer Wirtz kommentiert in einem von ihm mitherausgegebenen Buch über die Popularisierung von Geschichte: „Alle Ingredienzien späterer Fernsehproduktionen mit historischen Themen einschließlich des Event-Fernsehens waren darin enthalten; Personalisierung, Dramatisierung und Emotionalisierung. Eine Nation war damals tief betroffen. Geschichte im Fernsehen konnte offenbar viel eindrucksvoller präsentiert wenn, wenn die Strenge der Dokumentation verlassen wurde.“[4] Genau diese Aspekte nutzt Guido Knopp für seine historischen Dokumentationen im ZDF, die 1995 mit „Hitler – eine Bilanz“ begannen und in den Folgejahren in verschiedenen Serien das Dritte Reich in dieser personalisierten und dramatisierten Form präsentierten. Seine Sendungen waren erfolgreich, er konnte sie zur Hauptsendezeit ausstrahlen und gewann ein jugendliches Publikum, das sich plötzlich für Geschichte interessierte. In einem Interview 2006 bekannte er, dass die Primetime-Tauglichkeit an die Maßgabe gebunden sei, „dass Geschichte spannender sein kann als jeder Krimi, dass sie szenisch dargestellt wird, Menschen an den Wendepunkten ihres Lebens zeigt.“[5]. Für seine Redaktion produzierten Christian Frey und Oliver Halmburger den Film „Stauffenberg - Die wahre Geschichte“ über das Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944. Der Beginn des zweiten Teils dieses Films zeigt sehr typische Elemente aus dem Werkstatt Knopp. Ein hoher Anteil an Inszenierung, die personalisierte Geschichte, dass es einen gibt, der die Geschichte verändert, die Reduktion historischen Materials auf symbolische Bilder, eine dramatisierende Stimme des Sprechers – hier Christian Schult –, die standardisierte Präsentation von Zeitzeugen vor neutralem Hintergrund und schließlich der Einsatz modernster Technik wie hier der Animation oder dem virtuelle Anflug auf Orte des Geschehens, die an Google Map erinnern. Wer 2008 den amerikanischen Spielfilm „Valkyrie“ („Operation Walküre – Das Stauffenberg-Attentat“) von Bryan Singer mit Tom Cruise in der Rolle des Stauffenberg gesehen hat, kann bestätigen, dass es nur noch graduelle Unterschiede gibt zwischen diesen beiden Filmmen, die wahre Geschichte zu erzählen.
Ebenso verwischen sich bei den so genannten Event-Movies, die sehr häufig als Liebesdrama einer Frau zwischen zwei Männern erzählt werden vor dem Hintergrund eines großen historischen Ereignisses wie das Bombardement auf Dresden, den Untergang der „Gustloff“, die Vertreibung aus Ostpreußen, die Luftbrücke nach Berlin oder das Grubenunglück von Lengede. Sie werden aufwändig inszeniert und perfekt durchkomponiert. Nico Hoffmann, der in diesem Genre erfolgreiche teamworx-Produzent verriet dem Stern, dass die Musik auf die Werbeunterbrechungen Rücksicht nehmen: „Wir komponieren teilweise die Musiken so, dass sie eine Affinität mit den Werbeblöcken bekommen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Werbung die Dramaturgie zerstört.“[6]. Die Fakten werden ebenfalls harmonisiert, weich gezeichnet und für einen globalen Fernsehmarkt homogenisiert. Inwieweit sie dokumentarische Anteile haben und ob die präzise Rekonstruktion und das Bemühen um Authentizität sie zu realistischen Darstellung von Geschichte machen, muss diskutiert werden. Historiker bezweifeln dies und kritisieren die Glätte dieser Produktionen. Geschichte ist ein vielschichtiger Prozess und immer eine subjektive Interpretation von Vergangenheit. Die Produktionen erzählen gradlinig, verzichten auf die Erwähnung von Zweifeln, Brüchen, offenen Fragen oder Widersprüchen. Dies könnte die Zuschauer irritieren oder überfordern. Historiker befürchten dabei jedoch auch die Deutungshoheit über das öffentlich präsentierte Geschichtsbild an die verantwortlichen Filmregisseure und Fernsehredakteure zu verlieren. Dies wurde sehr deutlich beim Deutschen Historikertag 2006 in Konstanz, als dies Thema diskutiert wurde. Wolfgang Benz kritisiert, dass nicht nachvollziehbar sei, aus welchem Kontext und woher die dokumentarischen Bilder in diesen Produktionen stammen. Norbert Frei spricht von „gefühlter Geschichte“ und in einem Artikel für die Süddeutsche Zeitung von einem „Kopfsalat der Zeitzeugen“. Diese erweisen sich als Kronzeugen, wobei häufig deutlich wird, dass die Jahrzehnte ihre Erinnerung beeinflusst haben. Für das Dritte Reich besteht inzwischen das Problem, dass die Zeitzeugen aus erster Hand immer weniger werden. Von daher behilft man sich mit Kindern, Enkeln und anderen Zeugen, die die Versionen der Vorgenerationen aus dem Hören Sagen berichten.
Seit Ende der 90er Jahre gibt es im Fernsehen das Format der Dokusoap. Es verbindet Elemente des Dokumentarfilms mit denen der Daily Soap. Es sind in der Regel Mehrteiler mit mindestens fünf Folgen. Die Handlungen verschiedener Protagonisten, die zum Teil aufwändig gecastet werden, werden wie bei einem Zopf ineinander verflochten. Am Ende gibt es einen so genannten Cliffhanger, einen Spannungsmoment, der die Zuschauer motivieren soll, die nächste Folge ebenfalls zu sehen. Dies Format wurde in England entwickelt, war erfolgreich und wurde auch in Deutschland adaptiert. Ein besonderes Format, ebenfalls aus England, ist die „living history“ oder wie man es hier nennt, Zeitreise Formate. Akteure von heute werden in eine historische Situation geschickt und müssen sich dort bewähren. Der SWR und die Produktionsfirma Zerofilm waren dabei mit „Schwarzwaldhaus 1902“ Wegbereiter dieses Formats, das bei den Zuschauern sehr gut ankam. Die Berliner Familie Boro wurde 2002 für zehn Wochen auf eine Zeitreise geschickt. Sie wohnte auf einem alten Bauernhof im Schwarzwald, der historisch detailgetreu auf das Jahr 1902 zurückgebaut wurde. Die Familie lebte dort unter den Bedingungen, die vor hundert Jahren herrschten und wurde ständig von einem Kamerateam begleitet. Als Regeln des Projekts wurde beschrieben: Familie Boro sollte unter den Bedingungen von 1902 leben. Das heißt: vor dem Einzug in das Haus mussten sie alles abgeben, was es 1902 noch nicht gab. Handys, Armbanduhren, Turnschuhe – alles blieb in der Zeitschleuse. Das galt auch für Besucher wie Tierarzt, Arzt, Pfarrer oder Nachbarn; wer kam musste durch die Zeitschleuse und zumindest seine elektronischen Geräte abgeben. Das einzig moderne am Hof waren damit die technischen Apparaturen des Fernsehteams. So ganz konnte man diese Illusion jedoch nicht aufrechterhalten, denn die Boros sollten ihre Milchprodukte auf einem heutigen Markt verkaufen. Dabei scheiterten sie an den strengen Bedingungen der Lebensmittelhygiene und es wurde ihnen amtlich verboten, die Produkte zu verkaufen. Damit war ihnen die Möglichkeit genommen, Geld zu verdienen. Es folgten weitere Serien zu einem Landhaus um 1900 und 1920, die Überfahrt auf einem Segelschiff wie im 19. Jahrhundert in „Windstärke 8“ oder der Ausflug in die Steinzeit. Dieses Format wurde dann auch von Privatsendern übernommen mit Leben in einer mittelalterlichen Burg. Dies ist wahrscheinlich die direkteste Form, Leute von heute mit den Lebensbedingungen der Vergangenheit zu konfrontieren. Formal das interessanteste dabei ist die Tatsache, dass die Bedingungen vom Fernsehen gestellt wird, die aus hunderten von Bewerbern ausgesuchten Protagonisten natürlich nach den Medienbedingungen von heute besetzt wurden, es also auch eher eine gestellte Wirklichkeit war, die jedoch als authentische Zeitreise in die Vergangenheit verkauft wurde.
Die Weiterentwicklung ist ein Format, dass sich dann gleich Doku-Fiction nennt und weitgehend inszeniert ist und den Anteil dokumentarischer Elemente und Experten- und Zeitzeugeninterviews noch einmal reduziert. Auf Tagung „Ohne Spiel kein Deal“ des Stuttgarter Haus des Dokumentarfilms wurde diskutiert, ob dies die Zukunft des dokumentarischen Fernsehens sein könnte.[7] Der Regisseur Günther Klein, der für das ZDF in der Reihe Giganten den Film über Goethe gedreht hat, präsentierte zehn Thesen zu diesem Format, die auf der Tagung kontrovers diskutiert wurden. Sie zeigen jedoch sehr deutlich, dass bei den Filmemachern die Forderung nach dramatisierter, emotionalisierter und personalisierter Darstellung von Geschichte schon verinnerlicht ist. In seinem Film über Goethe, der in der Sendereihe „Die Giganten“ entstand, finden sich ähnliche Elemente wie in dem ZDF-Film zu Stauffenberg. Es wird eine künstliche Spannung aufgebaut, sehr emotional erzählt und Geschichte personalisiert. Natürlich darf auch die Liebe nicht fehlen. Günter Klein nennt dies „emotional dressing“.
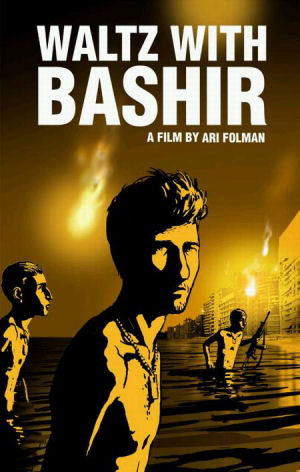 In welche Richtung kann die Geschichtsdarstellung noch gehen? Eine wachsende Bedeutung kommt der Computeranimation und den digitalen Effekten zu. Dies zeigt sich daran, dass es immer häufiger Animationsfilme wie „Waltz with Bashir“ (2008) von Ari Folman oder „Persepolis“ (2007) von Marjane Satrapi und Vincent Paronnaud gibt, die ihre dokumentarischen Geschichten mit Bildern aus dem Rechner erzählen. Doch die neue Technik ermöglicht ganz andere Produkte. 2004 experimentierte Discovery Channel mit einem ganz neuen Format. Es heißt „Virtual History“. Als erstes Thema haben sie bezeichnenderweise ebenfalls das Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 gewählt. Sie erzählen, was die vier Führer Hitler, Stalin, Roosevelt und Churchill an diesem Tag erlebt haben. Um neue, noch nie gesehene Bilder präsentierten zu können, nutzten sie neueste Techniken der Computeranimation. Zunächst wurden die Gesichter dieser Führer in historischen Aufnahmen analysiert. Dann wurden Schauspieler ausgewählt, die der Physionomie von ihnen am nächsten kamen. Dann wurden mit ihnen bestimmte Szenen im Studio gedreht und ihnen danach eine virtuelle Maske aufgesetzt, auf die die Köpfe aus dem historischen Material aufgetragen wurden. Danach wurde das Material künstlich gealtert mit Kratzern, Unruhe usw., dass es nun wie historisches Material aussieht. So ließen sich vermeintlich private Aufnahmen der Führer der Welt drehen. Inzwischen kann man sich die Bilder bauen, die man braucht. Ein interessanter Aspekt ist, dass sich die Produktion gleich zu Beginn mit Schrifttafeln die Authentizität meint behaupten zu müssen, um das Experiment zu legitimieren. Die Produktion war vor allem sehr teuer. Deshalb wurden nur wenige Minuten pro Staatsmann realisiert, die in dem Programm dafür ständig wiederholt werden und sich dadurch sehr schnell abnutzen. In welche Richtung kann die Geschichtsdarstellung noch gehen? Eine wachsende Bedeutung kommt der Computeranimation und den digitalen Effekten zu. Dies zeigt sich daran, dass es immer häufiger Animationsfilme wie „Waltz with Bashir“ (2008) von Ari Folman oder „Persepolis“ (2007) von Marjane Satrapi und Vincent Paronnaud gibt, die ihre dokumentarischen Geschichten mit Bildern aus dem Rechner erzählen. Doch die neue Technik ermöglicht ganz andere Produkte. 2004 experimentierte Discovery Channel mit einem ganz neuen Format. Es heißt „Virtual History“. Als erstes Thema haben sie bezeichnenderweise ebenfalls das Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 gewählt. Sie erzählen, was die vier Führer Hitler, Stalin, Roosevelt und Churchill an diesem Tag erlebt haben. Um neue, noch nie gesehene Bilder präsentierten zu können, nutzten sie neueste Techniken der Computeranimation. Zunächst wurden die Gesichter dieser Führer in historischen Aufnahmen analysiert. Dann wurden Schauspieler ausgewählt, die der Physionomie von ihnen am nächsten kamen. Dann wurden mit ihnen bestimmte Szenen im Studio gedreht und ihnen danach eine virtuelle Maske aufgesetzt, auf die die Köpfe aus dem historischen Material aufgetragen wurden. Danach wurde das Material künstlich gealtert mit Kratzern, Unruhe usw., dass es nun wie historisches Material aussieht. So ließen sich vermeintlich private Aufnahmen der Führer der Welt drehen. Inzwischen kann man sich die Bilder bauen, die man braucht. Ein interessanter Aspekt ist, dass sich die Produktion gleich zu Beginn mit Schrifttafeln die Authentizität meint behaupten zu müssen, um das Experiment zu legitimieren. Die Produktion war vor allem sehr teuer. Deshalb wurden nur wenige Minuten pro Staatsmann realisiert, die in dem Programm dafür ständig wiederholt werden und sich dadurch sehr schnell abnutzen.
Die vielfältige Annäherung von Dokumentarfilm und Spielfilm ist offensichtlich. Die Zuschauer haben im heutigen Medienzeitalter längst gelernt, Bildern zu misstrauen. Der Dokumentarfilm kann ein Thema nicht mehr in einer eindimensionalen Sichtweise behandeln und den Anspruch einlösen, zeigen zu wollen, wie etwas war oder ist. Im Idealfall macht er deutlich, dass das Gezeigte nur eine Version verschiedener Möglichkeiten ist. Die Renaissance sehr persönlich erzählter Dokumentarfilme ist sicher auch darauf zurückzuführen, dass es heutzutage keine einfachen Antworten mehr geben kann, sondern alles relativ scheint – selbst die Realität wird von uns immer subjektiv interpretiert und wahrgenommen.
Anmerkungen
[1] Andreas Kilb: Konjunktiv Imperfekt? So redet doch kein Mensch!, in: FAZ, 15.1.2009
[2] Martina Knoben: Vom Unbehagen in der Fiktion, in: SZ, 13.1.2009
[4] Rainer Wirtz: Alles authentisch: so war’s, in: Thomas Fischer / Rainer Wirtz: Alles authentisch? Popularisierung von Geschichte im Fernsehen, Konstanz 2008, S. 10
[5] Zitiert in Wirtz, S. 11
[6] Zitiert in Wirtz, S. 26
[7] Die Tagungsergebnisse sind dokumentiert in: Haus des Dokumentarfilms (Hg.): Ohne Spiel kein Deal?, Stuttgart 2008
|

