
Film und Geschichte |
Hauptsache authentischBeobachtungen zur Darstellung deutscher Geschichte in jüngeren KinofilmenCristina Nord
Ich möchte an dieser Stelle nicht akribisch aufzählen, an welchen Stellen „Der Baader Meinhof Komplex“ von der Wirklichkeit abweicht. Damit würde ich die Authentizitäts-Aussage letztlich anerkennen, indem ich sie allzu ernst nehme. Was mich viel mehr interessiert, ist die Frage, warum die Behauptung überhaupt so gut funktioniert – im Marketing, in den Medien und in der Folge an den Kinokassen. Woher rührt die Paradoxie, dass ein so poröses Konzept wie „Authentizität“ im jüngeren deutschen Geschichtsfilm so überaus erfolgreich ist? Und warum wird die Authentizitätsbehauptung, obwohl alles andere als hieb- und stichfest, so gerne eingesetzt? Im Fall von „Der Untergang“ war es ja ähnlich – da sagte Bernd Eichinger in einem Kurzinterview mit dem „Spiegel“ im April 2003: „Wir machen einen großen epischen Film fürs Kino. Allerdings halten wir uns dabei streng an die Dokumente. An Stenogramme der Lagebesprechungen und an die Aufzeichnungen von Zeitzeugen. Was historisch nicht belegt ist, kommt nicht vor. Wir machen keine Soap-Opera und auch kein Doku-Drama. [...] Ich denke, unser Film wird authentischer als alle vorherigen.“[4] Was historisch nicht belegt ist, kommt nicht vor – von Hitlers Selbstmord etwa gibt es keinen Zeugenbericht, also bekommen wir ihn nicht zu sehen. Sie erinnern sich möglicherweise, wie sehr sich Wim Wenders in einem Text, der im Oktober 2004 in der „Zeit“ erschien, genau über diese Auslassung aufregte. Ich möchte eine etwas längere Passage aus diesem Text zitieren, weil mir Wenders' Argumentation – und auch seine Wut - einleuchten.
Der Selbstmord ist als solcher nicht dokumentiert, also erspart uns der Film den Anblick – was für eine fadenscheinige Ausrede für eine Auslassung, die, wie Wenders zu Recht beklagt, von postumer Ehrfurcht kündet: Hitler bleibt auf seltsame Weise unantastbar, jedenfalls so unantastbar, dass Eichinger und Hirschbiegel es nicht wagen, die Leiche zu zeigen. Interessant ist, dass diese Unantastbarkeit dann am besten suspendiert wird, wenn die Authentizitätsbehauptung vollständig außer Kraft gesetzt ist, wenn man ins Universum der pulp fiction und des B-Movies eintritt. Quentin Tarantinos Spielfilm „Inglourious Basterds“ gibt jede Ehrfurcht vor der Geschichte von vornherein auf. Bei ihm wird Hitler, gespielt von Martin Wuttke, buchstäblich zu Klump gehauen. Indem der Film den Verlauf der Geschichte umschreibt, bietet er seinem Publikum eine antifaschistische Wunscherfüllung; er verwandelt die Ohnmacht, die man angesichts des realen Verlaufs der Geschichte empfindet, in Aggression und Selbstermächtigung. „Der Untergang“ will uns noch heute darüber schaudern lassen, dass Hitler tot ist, „Inglourious Basterds“ dagegen sorgt dafür, dass wir uns freuen, weil Hitler stirbt.
Es gibt viele Interpretationen von „Der Untergang“ und anderen populären deutschen Film- und Fernsehproduktionen, die in diese Richtung weisen – eine Umschichtung von Verantwortung findet statt, eine Entlastung, die Deutschen werden nach und nach von einem Täter- zu einem Opfervolk. Ich glaube, dass die Authentizitätsbehauptung in diesem Zusammenhang für die Filmemacher von großem Nutzen ist – denn sie stellt ein wunderbares Mittel dar, sich gegen den Vorwurf zu wappnen, man deute Geschichte um. Die Authentizitätsbehauptung garantiert Neutralität und Gültigkeit zugleich. Dabei dient sie auch als eine Art Schutzschild, unter dem sich allerlei ideologische Setzungen wie Schmuggelgut transportieren lassen. Wenn es in der Wirklichkeit so gewesen ist wie im Film, wenn also die Filmemacher sich strikt auf der Seite der Fakten bewegen, dann sind sie fein raus – sie müssen erst gar nicht in den Diskurs einsteigen, der sich um Ereignisse der Geschichte rankt. Sie müssen keine sichtbare Haltung entwickeln, sie müssen nicht klar und deutlich Stellung beziehen (so wie etwa Claude Lanzmann mit „Shoa“ klar und deutlich Stellung bezog), sie können sich im Wettstreit der Erinnerungen und Geschichtserzählungen auf eine vermeintlich sichere Position zurückziehen: Was wollt ihr denn, ist doch alles so, wie's war. Einfach nur zu zeigen, wie es war, bedeutet in dieser Logik, dass man sich allerlei Mühen sparen kann – zum Beispiel all die selbstreflexiven, bisweilen bis zum Bilderverbot reichenden Anstrengungen, die die Filmemacher des Neuen Deutschen Films in den 70er Jahren auf sich nahmen, wenn sie die Nachwirkungen des Nationalsozialismus oder den Deutschen Herbst verhandelten. Einfach nur zu zeigen, wie es war, bedeutet, dass man sich keine Gedanken darüber machen muss, was man wie zeigt – man kann Hakenkreuzfahnen in die Kamera halten oder Menschenmassen zu Ornamenten aufmarschieren lassen, ohne auch nur einen Gedanken darauf zu verwenden, dass eben dies Teil der Selbstinszenierung, der Propaganda, der Verführungskunst der Nationalsozialisten war. Ich kann mich erinnern, dass ich, nachdem ich Dennis Gansels „Napola“ gesehen hatte, den dringenden Wunsch verspürte, meine Sehnerven entnazifizieren zu lassen, so viele rot leuchtende Hakenkreuzfahnen hatten sich mir aufgedrängt. Der Filmwissenschaftler Thomas Elsaesser hat – wenn auch in einem anderen Zusammenhang - einmal bemerkt: „In jedem Fall ist das Bewältigen der Bilder intensive psychische Arbeit [...] selbst deren Neutralisierung oder Ausblenden aus dem Gedächtnis kostet Energie.“[6] Im Englischen spricht man von „memory contest“, um die miteinander konkurrierenden Geschichtserzählungen zu beschreiben, die an die Stelle der großen, objektiven, unpersönlichen Geschichte getreten sind. Ein allgemeines Beispiel für einen solchen Wettstreit wäre die Auseinandersetzung um die Darstellbarkeit, um die Narrativierbarkeit der Nazi-Vernichtungs-Maschinerie, wie sie in der Frontstellung von „Shoa“ einerseits und „Schindlers Liste“ andererseits zum Ausdruck kommt. Im Kleinen kann „memory contest“ aber auch heißen, dass Ignes Ponto, die Witwe des von der RAF ermordeten Bankiers Jürgen Ponto, öffentlich mit „Der Baader Meinhof Komplex“ hadert. Vor dem Landgericht Köln wollte sie eine einstweilige Verfügung gegen den Film erwirken. Die Sequenz, die die Ermordung ihres Mannes darstellt, sollte entfernt werden, da sie vom wirklichen Hergang der Ereignisse abweiche. Das Gericht sah in seinem Urteil vom 9. Januar 2009 Pontos Persönlichkeitsrechte allerdings nicht verletzt und berief sich – interessanterweise - auf die Freiheit der Kunst, die die Macher des Films nun gerade nicht für sich reklamieren. Ihr Bundesverdienstkreuz hatte Ignes Ponto zu diesem Zeitpunkt längst zurückgegeben. Ein anderes Beispiel für einen „memory contest“ ist der Einwand von Berthold Graf Schenk von Stauffenberg, der sich in der „Süddeutschen Zeitung“ dagegen aussprach, dass Tom Cruise in Bryan Singers Hollywoodfilm seinen Vater spielt – unter anderem weil Cruise Scientologe ist. Dabei ist Skepsis gegenüber den Geschichtsdarstellungen in einem Spielfilms bei weitem keine deutsche Spezialität; in Polen etwa war Edward Zwicks Film „Defiance“ - es geht darin um eine jüdische Partisanentruppe in Ostpolen, die Hauptrolle spielt Daniel Craig - schon angegriffen worden, bevor überhaupt der Dreh zum Abschluss kam. Populäre, medial erzeugte, massenwirksame Erinnerung steht hier gegen die Erinnerung von Beteiligten und/oder Nachkommen, was allerdings nicht heißt, dass die Beteiligten und Nachkommen zwangsläufig richtig, der Spielfilm zwangsläufig falsch erinnert – schließlich ist Erinnerung insgesamt eine unzuverlässige, bewussten und unbewussten Interessen verpflichtete Größe. Zu umso mehr Verschiebungen kommt es, je weiter die Ereignisse zurückliegen, um die es geht. Und hier kommt die Authentizitätsbehauptung insofern gelegen, als sie Sicherheit suggeriert: Solange man „So ist's gewesen“ sagen kann, kann man sich davor drücken, Fragen nach der Unzuverlässigkeit von Erinnerung, nach der Unzuverlässigkeit von Zeitzeugen, nach der Unzuverlässigkeit von Dokumenten zu beantworten. Erinnerungsforscher sprechen heute von „post memory“-Prozessen oder von „prosthetic memory“ - also davon, dass Erinnerungen im Zeitalter der Massenmedien ihre Unmittelbarkeit eingebüßt haben. Der Filmwissenschaftler Robert Burgoyne schreibt: „Prosthetic memory beschreibt die Art und Weise, wie massenmediale Technologien der Erinnerung Individuen in die Lage versetzen, Ereignisse, denen sie selbst nicht beigewohnt oder an denen sie nicht teilgehabt haben, so zu erfahren, als ob es persönliche Erinnerungen seien.“[7] Und zum Begriff der „postmemory“ erläutert die Literaturwissenschaftlerin Marianne Hirsch: „Postmemory most specifically describes the relationship of children of survivors of cultural or collective trauma to the experiences of their parents, experiences that they 'remember' only as the narratives and images with which they grew up, but that are so powerful, so monumental, as to constitute memories in their own right.“[8] Die geschichtliche Erfahrung, die eine Generation macht, wird weitergegeben an die folgende. Die war zwar selbst nicht mehr unmittelbar beteiligt, mittelbar aber durchaus – durch mündliche Überlieferung im Familienkreis genauso wie durch mediale Bilder und Inszenierungen, und eben dies wird Teil der eigenen Erinnerung, so dass sich nicht trennen lässt, was selbst erinnert wird und was von außen kommt und verinnerlicht wird.
Und zugleich schwingt noch etwas mit - der Zuschauer weiß etwas, was die Filmfigur nur ahnt. Viele Frauen, die den Krieg überlebten, wurden von Angehörigen der Roten Armee vergewaltigt. Zu diesem Thema gibt es inzwischen auch einen Spielfilm - „Anonyma“, gedreht von Max Färberböck, auch eine Produktion der Constantin. Die gezeigte Sequenz aus „Der Untergang“ ist heute, in der Rückschau, wie eine Vorwegnahme von „Anonyma“. Sie legt nahe, dass auch Traudl Junge Opfer einer Vergewaltigung werden könnte. Es ist eine sehr bittere Volte, dass unter dieser von den Bildern insinuierten Bedrohung Traudl Junges tatsächliche, schmerzhafte Selbstreflexion verloren geht. Anmerkungen[1] S. Dirk Kurbjuweit: „Bilder der Barbarei“, in: „Der Spiegel“ 37/2008, S. 42-48, bes. S. 44. [2] S. www.welt.de/kultur/article2479112/Andreas-Baader-redete-ziemlichen-Murks.html. [3] vgl. hierzu: Diedrich Diederichsen: „Der Chef brüllt schon wieder so“, in: „die tageszeitung“, 15. September 2004, S.15-16, S.16. [4] „Ich halte mich an die Geschichte“ (Interview mit Bernd Eichinger, ohne Autorangabe), in: „Der Spiegel“ 17/2003, S. 153. [5] Wim Wenders: „Tja, dann wollen wir mal. Warum darf man Hitler in 'Der Untergang' nicht sterben sehen? Kritische Anmerkungen zu einem Film ohne Haltung“, www.zeit.de/2004/44/Untergang_n [6] Thomas Elsaesser: „Hollywood heute. Geschichte, Gender und Nation im postklassischen Kino“, Berlin 2009, S. 181. Im Folgenden: Elsaesser. [7] zitiert nach Elsaesser, S. 182. [8] Marianne Hirsch: „Surviving Images: Holocaust Photographs and the Work of Postmemory“, www.fritz-bauer-institut.de/gastprofessur/weissberg/09_Marianne-Hirsch_2.pdf, S. 9. [9] Georg Seeßlen: „Das faschistische Subjekt“, www.zeit.de/2004/39/Hitler-Filme |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/61/cn1.htm
|
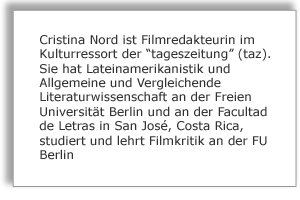 Gut zwei Wochen, bevor „Der Baader Meinhof Komplex“ am 25. September 2008 ins Kino kommen soll, widmet „Der Spiegel“ dem Film eine Titelgeschichte. Die abgedruckten Filmstills werden mit zeitgenössischen Fotografien kombiniert, so dass die Ähnlichkeiten zwischen den Fotos von damals und den Filmbildern von heute ins Auge stechen. Sei es das Autokennzeichen auf dem Bild, das die Leiche Benno Ohnesorgs zeigt, sei es die Blutlache rund um den Kopf des toten Baader, sei es das karierte Hemd von Rudi Dutschke: Ganz offensichtlich haben die Macher des Films viel Wert darauf gelegt, möglichst viele Übereinstimmungen zu den Bildern zu erzeugen, die in den siebziger Jahren zirkulierten und Bestandteil der visuellen Überlieferung wurden.
Gut zwei Wochen, bevor „Der Baader Meinhof Komplex“ am 25. September 2008 ins Kino kommen soll, widmet „Der Spiegel“ dem Film eine Titelgeschichte. Die abgedruckten Filmstills werden mit zeitgenössischen Fotografien kombiniert, so dass die Ähnlichkeiten zwischen den Fotos von damals und den Filmbildern von heute ins Auge stechen. Sei es das Autokennzeichen auf dem Bild, das die Leiche Benno Ohnesorgs zeigt, sei es die Blutlache rund um den Kopf des toten Baader, sei es das karierte Hemd von Rudi Dutschke: Ganz offensichtlich haben die Macher des Films viel Wert darauf gelegt, möglichst viele Übereinstimmungen zu den Bildern zu erzeugen, die in den siebziger Jahren zirkulierten und Bestandteil der visuellen Überlieferung wurden. In einem Interview mit Edel, Moritz Bleibtreu und Johanna Wokalek vom 23. September 2008 sagt der Interviewer, der Filmkritiker Hans-Georg Rodek, zu Bleibtreu, dem Darsteller des Andreas Baader: „Sie spielen eine Figur, an der sich die Wut bündelte, von der es aber kaum authentische Dokumente gibt.“ Bleibtreu antwortet: „Kurz vor Drehbeginn tauchte plötzlich ein Tonbandmitschnitt des Prozesses in Stammheim auf. Da saßen wir alle zusammen in Berlin und haben den angehört: Baader redete, und er redete ziemlich langsam, mit einem leichten Lispeln, und es war ziemlicher Murks, den er erzählte. Man konnte richtig sehen, wie einige Illusionen aus unseren Gesichtern heraus gefallen sind. Ich habe Uli dann gefragt: Soll ich das soo spielen?!“ Uli Edel antwortet Bleibtreu: „Natürlich nicht! Wir drehten ja keine Komödie!“
In einem Interview mit Edel, Moritz Bleibtreu und Johanna Wokalek vom 23. September 2008 sagt der Interviewer, der Filmkritiker Hans-Georg Rodek, zu Bleibtreu, dem Darsteller des Andreas Baader: „Sie spielen eine Figur, an der sich die Wut bündelte, von der es aber kaum authentische Dokumente gibt.“ Bleibtreu antwortet: „Kurz vor Drehbeginn tauchte plötzlich ein Tonbandmitschnitt des Prozesses in Stammheim auf. Da saßen wir alle zusammen in Berlin und haben den angehört: Baader redete, und er redete ziemlich langsam, mit einem leichten Lispeln, und es war ziemlicher Murks, den er erzählte. Man konnte richtig sehen, wie einige Illusionen aus unseren Gesichtern heraus gefallen sind. Ich habe Uli dann gefragt: Soll ich das soo spielen?!“ Uli Edel antwortet Bleibtreu: „Natürlich nicht! Wir drehten ja keine Komödie!“ Trotzdem hält „Der Baader Meinhof Komplex“ - wie andere jüngere Filme zur deutschen Geschichte auch - viel darauf, authentisch zu sein, d. h. der Film behauptet von sich, von den historischen Ereignissen so zu erzählen, wie sie wirklich waren. Nun hat diese Behauptung etwas sehr Naives. Denn es ist eine Binsenweisheit, dass es Authentizität weder im Spiel- noch im Dokumentarfilm gibt, und deswegen haben auch die Historiker, die bisweilen die Ungenauigkeiten und Verfälschungen, die sich ein Film gestattet, akribisch und en detail auflisten, etwas Rührendes – ihre Kritik geht auf seltsame Weise am Gegenstand vorbei. Schon die Wahl einer Kameraeinstellung ist ein Eingriff, eine Entscheidung, die ästhetische und moralische Konsequenzen hat. Und wie geht man als Regisseur damit um, wenn widerstreitende Aussagen von Zeitzeugen es erst gar nicht möglich machen, letztgültig zu rekonstruieren, was wie geschehen ist? Was tut ein Drehbuchautor, wenn eine historische Konstellation keine Sympathieträger kennt, ein den Spielregeln des Erzählkinos gehorchender Film aber sympathische Figuren braucht? Und was tut er, wenn sich diese Konstellation nicht in narrative Formen – etwa die der Tragödie - gießen lässt, er aber gleichwohl eine solche narrative Form braucht? Die Tragödie beispielsweise setzt schuldlos-schuldige Akteure voraus, sie braucht Helden, die nicht anders handeln können, als sie es tun, die also die Schuld nolens volens auf sich laden. Eine solche Charakterisierung trifft für reale Personen der Geschichte und Zeitgeschichte nicht zu, egal ob es sich um Ulrike Meinhof, Andreas Baader, Adolf Hitler oder Joseph Goebbels handelt.
Trotzdem hält „Der Baader Meinhof Komplex“ - wie andere jüngere Filme zur deutschen Geschichte auch - viel darauf, authentisch zu sein, d. h. der Film behauptet von sich, von den historischen Ereignissen so zu erzählen, wie sie wirklich waren. Nun hat diese Behauptung etwas sehr Naives. Denn es ist eine Binsenweisheit, dass es Authentizität weder im Spiel- noch im Dokumentarfilm gibt, und deswegen haben auch die Historiker, die bisweilen die Ungenauigkeiten und Verfälschungen, die sich ein Film gestattet, akribisch und en detail auflisten, etwas Rührendes – ihre Kritik geht auf seltsame Weise am Gegenstand vorbei. Schon die Wahl einer Kameraeinstellung ist ein Eingriff, eine Entscheidung, die ästhetische und moralische Konsequenzen hat. Und wie geht man als Regisseur damit um, wenn widerstreitende Aussagen von Zeitzeugen es erst gar nicht möglich machen, letztgültig zu rekonstruieren, was wie geschehen ist? Was tut ein Drehbuchautor, wenn eine historische Konstellation keine Sympathieträger kennt, ein den Spielregeln des Erzählkinos gehorchender Film aber sympathische Figuren braucht? Und was tut er, wenn sich diese Konstellation nicht in narrative Formen – etwa die der Tragödie - gießen lässt, er aber gleichwohl eine solche narrative Form braucht? Die Tragödie beispielsweise setzt schuldlos-schuldige Akteure voraus, sie braucht Helden, die nicht anders handeln können, als sie es tun, die also die Schuld nolens volens auf sich laden. Eine solche Charakterisierung trifft für reale Personen der Geschichte und Zeitgeschichte nicht zu, egal ob es sich um Ulrike Meinhof, Andreas Baader, Adolf Hitler oder Joseph Goebbels handelt. Es nimmt nicht Wunder, dass „Der Untergang“ sich bei weitem nicht in jedem Detail an die historischen Tatsachen hält – pars pro toto möchte ich hier nun doch ein Beispiel nenen, weil es signifikant ist. Eine Nebenfigur, Ernst Günther Schenck, gespielt von Christian Berkel, erscheint als vernunftbegabte Gestalt inmitten all der todessehnsüchtigen und halbwahnsinnigen Nazis. Schenck war im echten Leben Ernährungsinspekteur bei der Waffen-SS war und zog in Konzentrationslagern Häftlinge zu Nahrungsmittelversuchen heran. Die Umdeutung der Figur mag zunächst der Logik des Erzählkinos geschuldet sein: Es braucht schließlich die eine oder andere positive Figur, damit sich der Zuschauer identifizieren kann. Oder ist es doch eher eine Spielart von Revisionismus, wenn Schenck als Retter in der Not entworfen wird? In dieser Lesart wäre die Figur Teil einer folgenschweren Umdeutung: Die meisten Deutschen hätten im Nationalsozialismus ihre Menschlichkeit eben nicht verloren; selbst ein Mitglied der Waffen-SS wäre zu heroischen Taten imstande, die Verantwortung für die Verbrechen des Nationalsozialismus läge in allererster Linie bei dem Mann, der sich im Führerbunker verschanzt.
Es nimmt nicht Wunder, dass „Der Untergang“ sich bei weitem nicht in jedem Detail an die historischen Tatsachen hält – pars pro toto möchte ich hier nun doch ein Beispiel nenen, weil es signifikant ist. Eine Nebenfigur, Ernst Günther Schenck, gespielt von Christian Berkel, erscheint als vernunftbegabte Gestalt inmitten all der todessehnsüchtigen und halbwahnsinnigen Nazis. Schenck war im echten Leben Ernährungsinspekteur bei der Waffen-SS war und zog in Konzentrationslagern Häftlinge zu Nahrungsmittelversuchen heran. Die Umdeutung der Figur mag zunächst der Logik des Erzählkinos geschuldet sein: Es braucht schließlich die eine oder andere positive Figur, damit sich der Zuschauer identifizieren kann. Oder ist es doch eher eine Spielart von Revisionismus, wenn Schenck als Retter in der Not entworfen wird? In dieser Lesart wäre die Figur Teil einer folgenschweren Umdeutung: Die meisten Deutschen hätten im Nationalsozialismus ihre Menschlichkeit eben nicht verloren; selbst ein Mitglied der Waffen-SS wäre zu heroischen Taten imstande, die Verantwortung für die Verbrechen des Nationalsozialismus läge in allererster Linie bei dem Mann, der sich im Führerbunker verschanzt. Ich glaube, dass man mit der Authentizitätsbehauptung solche komlexen Vorgänge überhaupt nicht zu fassen bekommt. Um noch einmal auf „Der Untergang“ zurückzukommen: Wie schwierig es für Traudl Junge war, mit ihrem Leben klarzukommen, nachdem sie Hitlers Sekretärin gewesen war, zeigt der Dokumentarfilm „Im toten Winkel – Hitlers Sekretärin“ von André Heller und Othmar Schmiederer aus dem Jahr 2002 eindringlich. Zentral ist, dass sich Junge irgendwann in ihrem Leben zu ihrer Verantwortung bekennen konnte – dass sie sagen konnte: Es war ein Fehler, dass ich mich habe verführen lassen, es war ein Fehler, dass ich mitgemacht habe, es war ein Fehler, dass ich dumm und naiv war und nicht nachgedacht habe. Bei Eichinger und Hirschbiegel hingegen ist und bleibt Traudl Junge die junge, naive Sympathieträgerin. Wenn sie am Ende des Films den Führerbunker verlässt und durch ein Spalier sowjetischer Soldaten schreitet, einen kleinen Jungen an der Hand, dann stecken viel Unheil, viel Drohung in der Szene. Georg Seeßlen schreibt zu diesen Bildern: „Schließlich folgt die deutsche Erlösung und Wiedergeburt als Flucht der Sekretärin durch die Reihen der Roten Armee, denen die Flüchtende unter keinen Umständen in die Augen sehen darf. (Aber warum muss Traudl Junge durch die Reihen der Rotarmisten an der festen Hand jenes Nibelungen-blonden Jungen geführt werden, der eben noch von Hitler selbst mit dem Eisernen Kreuz dekoriert wurde?) Offensichtlich weigert sich der Film, den Untergang des Faschismus als eine Befreiung zu sehen. In seiner mythischen Tiefenstruktur konstruiert er stattdessen Kontinuität: der Hitlerjunge, der sich von seinem Wahn befreite, und die Sekretärin des Führers [...] fliehen vor der neuen Gefahr aus dem Osten – ein perfides Bild für eine deutsche Selbstbefreiung.“
Ich glaube, dass man mit der Authentizitätsbehauptung solche komlexen Vorgänge überhaupt nicht zu fassen bekommt. Um noch einmal auf „Der Untergang“ zurückzukommen: Wie schwierig es für Traudl Junge war, mit ihrem Leben klarzukommen, nachdem sie Hitlers Sekretärin gewesen war, zeigt der Dokumentarfilm „Im toten Winkel – Hitlers Sekretärin“ von André Heller und Othmar Schmiederer aus dem Jahr 2002 eindringlich. Zentral ist, dass sich Junge irgendwann in ihrem Leben zu ihrer Verantwortung bekennen konnte – dass sie sagen konnte: Es war ein Fehler, dass ich mich habe verführen lassen, es war ein Fehler, dass ich mitgemacht habe, es war ein Fehler, dass ich dumm und naiv war und nicht nachgedacht habe. Bei Eichinger und Hirschbiegel hingegen ist und bleibt Traudl Junge die junge, naive Sympathieträgerin. Wenn sie am Ende des Films den Führerbunker verlässt und durch ein Spalier sowjetischer Soldaten schreitet, einen kleinen Jungen an der Hand, dann stecken viel Unheil, viel Drohung in der Szene. Georg Seeßlen schreibt zu diesen Bildern: „Schließlich folgt die deutsche Erlösung und Wiedergeburt als Flucht der Sekretärin durch die Reihen der Roten Armee, denen die Flüchtende unter keinen Umständen in die Augen sehen darf. (Aber warum muss Traudl Junge durch die Reihen der Rotarmisten an der festen Hand jenes Nibelungen-blonden Jungen geführt werden, der eben noch von Hitler selbst mit dem Eisernen Kreuz dekoriert wurde?) Offensichtlich weigert sich der Film, den Untergang des Faschismus als eine Befreiung zu sehen. In seiner mythischen Tiefenstruktur konstruiert er stattdessen Kontinuität: der Hitlerjunge, der sich von seinem Wahn befreite, und die Sekretärin des Führers [...] fliehen vor der neuen Gefahr aus dem Osten – ein perfides Bild für eine deutsche Selbstbefreiung.“