
Liebe Gemeinde, liebe Studierende, Kolleginnen und Kollegen!

Mit diesen Versen beginnt das Johannesevangelium in seiner griechischen Fassung, dem Quelltext aller Übertragungen. In nahezu sämtlichen deutschen Übersetzungen lauten sie: "Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort." (Joh 1.1)[1] So auch in der Luther-Bibel.
Im Rahmen eines Universitätsgottesdienstes einen Literatur- und Kulturwissenschaftler über diese Verse sprechen zu lassen, und keinen Biologen, Politologen oder Theologen, die das auch und vielleicht sogar besser könnten, ist so ganz abwegig nicht: Immerhin wird in diesen Eingangsversen in einer emphatischen, poetisch klingenden Sprache vom "Wort" gesprochen.[2]
Wovon ist die Rede? Bereits ein erstes Hineinhören in diese ein wenig vertrackten Eingangsverse lässt uns einige Begriffe erkennen, die in einem Fragenzusammenhang stehen. Im Zentrum steht die Frage nach dem Ursprung aller Dinge, genauer gesagt die Frage, wie dieser Ursprung, der Ausgangs- und Bezugspunkt all unseren Denkens, Handelns und Fühlens beschaffen ist: "Wort" und "Gott", "Gott" und "Wort" sind dabei in einer geheimnisvoll-zirkulären Weise aufeinander bezogen. Rätsel gibt in diesem Zusammenhang vor allem der Begriff "Wort" auf, rätselhaft erscheint aber auch das Verhältnis von "Wort" und "Gott", "Gott" und "Wort" zueinander. Und erklärungsbedürftig ist nicht zuletzt, ob dieser grundlegende Bezugspunkt für unser Denken, Fühlen und Handeln eine Einheit darstellt? Ist er als Identität, als etwas in sich Stimmiges, Sinnhaftes und Widerspruchsfreies, also wirklich als ein Punkt vorzustellen oder als Differenz, als etwas Verschiedenes, vielleicht sogar in sich Widersprüchliches, also eher als ein Bezugsfeld?
Mit dieser letzten Frage sind wir in einen Diskussionszusammenhang geworfen, der die Geistesgeschichte seit der Antike bewegt und spätestens mit dem Beginn der Moderne vor gut 200 oder 250 Jahren zu den unerlässlichen Entscheidungsfeldern einer jeden sozio-kulturellen Verständigung geworden ist. Die Antworten, die dabei gegeben werden, haben sehr konkrete Auswirkungen, im Personalen wie im Sozialen, hier und jetzt. Sie bestimmen die Vorstellungen, die wir uns von unserer persönlichen Identität machen, ebenso wie etwa die Diskussion darüber, ob wir in Deutschland in einer homogenen Nationalkultur leben oder in einer multikulturellen Gesellschaft? Sie bestimmen nicht nur wer wir sind und was wir sind, sondern auch wie wir sind. Es sind allemal aktuelle Fragen.
Doch geht es in unseren Versen vorderhand ja gar nicht um lebensweltliche Aktualität. Zuerst einmal handelt es sich um einen Glaubenstext. Das nach Johannes benannte Evangelium ist ein ursprünglich jüdischer Text in – wie wir gehört haben – griechischer Sprache. Er ist um etwa 100 nach Christus entstanden, wahrscheinlich in Ephesus in der heutigen westlichen Türkei, einem Wirtschafts- und Kulturzentrum der damaligen Welt, wo sich frühe Christengemeinden als Teil einer innerjüdischen Reformbewegung gebildet hatten.
Blicken wir vor diesem Hintergrund noch einmal auf die Verse und auf ihre Stellung im Gesamttext: "Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort." Die Verse stehen nicht isoliert da, sondern sind Teil eines Prologs, also eines Vorworts – eines allerdings recht merkwürdigen Vorworts: Wir erfahren nämlich nichts über Inhalt und Gliederung des Nachfolgenden; auch eine Begründung der Verfasserabsicht, wie wir sie etwa bei Lukas haben, gibt es in diesem Prolog nicht. Er ist vielmehr ein in sich geschlossener, rätselhafter Text, der erst dann verständlich wird, wenn man den nachfolgenden Evangelientext auf ihn zurück bezieht.[3] Der Haupttext erläutert also das Vorwort, statt umgekehrt.
Textgeschichtlich ergibt sich diese Eigenart des Prologs aus der Funktion, die die Eingangsverse ursprünglich einmal hatten: Es handelte sich bei größeren Teilen des Prologs um ein Gemeindelied, in das der Verfasser des Evangeliums oder ein späterer Bearbeiter, Erweiterungen und Kommentare eingearbeitet hat. Damit kann ein wenig schon die etwas vertrackte Form des Eingangsteils und insbesondere der ersten Verse erklärt werden. Wie bei bestimmten Liedformen nimmt eine jeweils nächste Verszeile ein Wort der vorigen auf und führt es aus: "Im Anfang war das Wort", aufgenommen wird nun ‚Wort‘: "und das Wort war bei Gott", aufgenommen wird nun ‚Gott‘: "und Gott war das Wort." Das Verfahren macht den Text eingängig, leicht auswendig zu lernen und betont die tragenden Begriffe.
In der wiederholten Aufnahme des Begriffs "Wort" wird dessen zentrale Bedeutung für den gesamten Text deutlich. Wir hörten, dass im griechischen Quelltext von "logos" die Rede ist. Unsere gängigen Begriffe ‚Logik‘ oder ‚logisch‘ weisen auf den Terminus zurück, unterscheiden sich aber im Bedeutungsgehalt deutlich von der Verwendung im Evangelientext. In der antiken Literatur und Philosophie hatte der Begriff vielfältige Bedeutungsfacetten, meinte im Kern aber meist eine die Welt durchwirkende Gesetzmäßigkeit, ein Sinnprinzip. Im hellenistischen, also: griechisch geprägten, Judentum der Zeit bezeichnete der Begriff das ewige Denken des einen Gottes, das beim Schöpfungsakt aus Gott heraustritt. In dieser letztgenannten Tradition sind auch unsere Eingangsverse zu verstehen.
Nun verweist das Vorwort des JohEvs auf einen Haupttext, der, wie wir gehört haben, das Vorwort erst verständlich macht. Wovon handelt nun dieser Haupttext? Wie bei den drei anderen Evangelien, den sogenannten Synoptikern, steht auch bei Johannes das Leben und Sterben von Jesus von Nazareth im Vordergrund. Noch weniger als bei Markus, Matthäus und Lukas geht es im JohEv dabei allerdings um einen historisch treuen Bericht, sondern primär um die Entfaltung des Bekenntnisses zum Gekreuzigten und Wiederauferstandenen. Von Jesu "Zeichen" ist die Rede, mittels der er sich als Jesus Christus, also als ewiger Gottessohn, offenbart hat. Entsprechend heißt es in einem ersten Schluss des Buches: "Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes" (JohEv 20,31). Es geht also um Bekenntnis und Beglaubigung, nicht um Berichterstattung – und es geht um Mission.
Die Offenlegung der Verfasserabsicht im Epilog lässt bereits eine erste Deutung der Eingangsverse in ihrem religiösen Gehalt zu: Jenes "Wort", von dem gesprochen wird, das im Anfang war, mit Gott gleich, aber doch von ihm verschieden, ist auf Jesus gemünzt: "Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns", heißt es im weiteren Verlauf des Prologs (JohEv 1,14). Durch den Kreuzestod und die Wiederauferstehung erweist Jesus sich dem Gläubigen als ewiger Gottessohn, der Teil hat an der Präexistenz des Vaters: "und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit" – so der Schluss des Einleitungsteils (Joh 1,14). Im Haupttext wird dieser Anspruch dann durch Jesusworte bekräftigt; besonders prägnant in Joh 10,30: "Ich und der Vater sind eins." Das "Wort" und "Gott" sind dem Gläubigen also eine Einheit, die alles bestimmende Sinngebung.
Eine letzte textgeschichtliche Einordnung sei vorgenommen: Die Eingangsverse verraten bereits in ihrer sprachlichen Gestaltung einen programmatisch-proklamatorischen Anspruch, indem sie die berühmten Eingangsverse der Genesis "Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde" (Gen 1,1) in einer für die jüdische und jüdisch-christliche Kulturgemeinschaft der damaligen Zeit unüberhörbaren Weise anklingen lassen. Im Rahmen der johanneischen Bekenntnisschrift wird Jesus als das Fleisch gewordene Wort Gottes durch diese Traditionsanknüpfung in besonderer Weise hervorgehoben: Der Verfasser oder die Bearbeiter des Evangeliums setzen sich selbstbewusst als Erbe und Fortsetzer des Judentums, zu dem das frühe Christentum in dieser Zeit wohl noch zu zählen ist.
Die Eingangsverse sind damit sicherlich ein Zeugnis der frühen innerjüdischen Auseinandersetzungen und ein Akt der Entgegensetzung durch die jüdisch-christliche Gemeinschaft. Vor dem Hintergrund des interreligiösen Dialogs heute scheint mir aber die Erinnerung an die gemeinsamen Quellen von Christentum und Judentum wichtiger zu sein. In den Versen klingt unüberhörbar nämlich auch die Tradition der jüdischen Weisheitsliteratur der hebräischen Bibel, unserem Alten Testament, an. So wird etwa in den Sprüchen Salomos die Weisheit als Wesen Gottes in Worten vorgestellt, die im Eingangsvers des Evangeliums hörbar nachklingen.[4] Eine jüngere Übertragung des JohEvs versucht dem Rechnung zu tragen: In der Bibel in gerechter Sprache lauten die Eingangsverse des JohEvs deshalb wie folgt: "Am Anfang war die Weisheit und die Weisheit war bei Gott und die Weisheit war wie Gott."[5]
Verloren geht bei dieser an sich schönen und klugen Übertragung allerdings der Zitatcharakter, den die Eingangsverse des JohEvs im heutigen Deutsch gewonnen haben. Die Verse sind längst zum ‚geflügelten Wort‘ geworden und zeugen damit von der besonderen Sprachkraft dieser Sentenz. Gerade der erste Teilvers begegnet immer wieder als unmittelbares Zitat, vor allem natürlich in der Literatur,[6] die ja vom Zitat lebt: Literatur ist gerade in ihren besseren Zeugnissen oft Literatur aus Literatur aus Literatur.
Wie es sich für ein ‚geflügeltes Wort‘ gehört, lebt der Vers viel häufiger aber in der Anspielung, innerhalb wie außerhalb der Literatur. Dass dies besonders in Verbindung mit Kirche und Religion zu beobachten ist, verwundert nicht.[7] Um ein schönes Beispiel zu finden, brauchen wir gar nicht weit zu gehen oder zu schauen. Als im letzten Jahr hier in der Stiftskirche zum Auftakt der 675-Jahresfeier die wunderbare Kreuz-Installation aus Papier, Wort und Licht präsentiert wurde, die den Kirchraum danach für längere Zeit schmücken sollte, begann die Präsentation sicherlich nicht zufällig mit den Worten "Am Anfang war die Idee…". Johannes hat offensichtlich Pate gestanden!
Aber selbst, wer nur die Zeitung aufschlägt, wird über entsprechende Belege nur so stolpern. Etwa in der Rubrik "Wissen" unserer heimischen Rheinpfalz. Eine kleine Blütenlese sei erlaubt: "Am Anfang war das Nichts" war am 15. Februar 2009 eine Artikelfolge über die Entstehung des Universums betitelt. Etwas versteckter, in der Kapitelüberschrift eines Beitrags über das Singen, Wandern und Sterben von Dünen (RP, Nr. 175 v. 29.7.2008), konnte man in einer früheren Ausgabe lesen: "Am Anfang steht ein Hindernis". Ins Witzige rutscht ein Titel von Ende Januar über die Anfänge der Zivilisation: Nein, nicht das "Wort" – "Am Anfang war das Bier" (RP vom 25. Januar 2009, S. 17) erfahren wir in diesem Artikel!
Sucht man in der Literatur der Moderne nach Zeugnissen einer ernsthaften geistigen Auseinandersetzung mit den Eingangsversen des JohEvs,[8] stößt man schnell auf eine illustre Traditionslinie. Sie ist in besonderer Weise mit den Namen Johann Wolfgang Goethe und Friedrich Nietzsche verbunden, also zentralen Bezugspunkten unserer nationalkulturellen wie überhaupt der modernen Bildungstradition.[9] Mit diesen beiden nach Luther wohl bedeutendsten sprachschöpferischen Potenzen der deutschen Literatur- und Kulturgeschichte sind nicht nur zwei Stationen einer Entwicklung in der jüngeren Auseinandersetzung mit den johanneischen Eingangsversen bezeichnet, sondern zugleich Zeugnisse einer Sinnsuche in der Moderne, wie sie auch heute noch unverändert aktuell ist.
Das ohne Zweifel bekannteste literarische Beispiel einer produktiven Aufnahme der johanneischen Verse ist der Monolog des lebensmüden Faust im ersten Teil der Tragödie. Der Text ist noch immer Schullektüre. Sie erinnern sich: Der greise Gelehrte Faust verzweifelt an seinem menschlichen Unvermögen, das Unbegreifliche und Unfassbare, die Wahrheit vor und hinter aller Wirklichkeit, zu begreifen. Der vorletzte Versuch lässt ihn zum Neuen Testament, zum griechischen Quelltext greifen, bevor er sich schließlich der Magie ausliefern wird, die ihn dann zum Pakt mit Mephisto, dem Teufel, führt, aus dem ihn letzten Endes nur die Gnade Gottes wieder befreien wird.
An der entscheidenden Scharnierstelle seiner vergeblichen Suche nach der tiefsten Wahrheit beginnt Faust also den griechischen "Grundtext" in sein – wie es heißt – "geliebtes Deutsch zu übertragen" (V. 1223f.). Ich zitiere:
Geschrieben steht: "Im Anfang war das Wort!"
Hier stock’ ich schon! Wer hilft mir weiter fort?
Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen,
Ich muß es anders übersetzen,
Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin.
Geschrieben steht: Im Anfang war der Sinn.
Bedenke wohl die erste Zeile,
Daß deine Feder sich nicht übereile!
Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft?
Es sollte stehn: Im Anfang war die Kraft!
Doch, auch indem ich dieses niederschreibe,
Schon warnt mich was, daß ich dabei nicht bleibe.
Mir hilft der Geist! Auf einmal seh’ ich Rat
Und schreibe getrost: Im Anfang war die Tat![10]
Damit enden dann auch die Übertragungsversuche Faustens. Der Pudel, den Faust vom Osterspaziergang mit Heim gebracht hat und in dem sich der unselige Mephisto verborgen hält, heult jämmerlich und beendet so auf grotesk-komische, aber wirkungsvolle Weise alle weiteren Annäherungen des Gelehrten an die Heilige Schrift.
Dessen Übertragungsbemühungen kreisen alle um die Deutung jenes griechischen Wortes "logos", das wir ganz zu Beginn gehört haben. Johann Gottfried Herders Erläuterungen zum Neuen Testament von 1775 folgend, lässt Goethe seinen Faust zuerst Luthers Übersetzung "Wort" erwägen sowie die Begriffe "Sinn" und "Kraft". Sie alle aber werden verworfen, um schließlich den Begriff "Tat" niederzuschreiben.[11] Damit ist der weitere Lebensweg des Gelehrten bezeichnet: Der Denker und Lehrer stürzt sich in der Folge in Begleitung des Teufels ins pralle Leben, er wird zu einem Tat-Menschen, einem ‚Macher‘, der seinen Lebenssinn im Handeln zu verwirklichen sucht, aber dann doch nur zum Verführer und – unschuldig-schuldig – zum Verbrecher wird. Die in sich stimmige, widerspruchsfreie Tat als Sinn stiftende Instanz hat sich jedenfalls nicht realisieren lassen.
Eine der klügsten geistig-literarischen Auseinandersetzungen mit den Eingangsversen des JohEvs stammt von dem großen Aphoristiker und Philosophen Friedrich Nietzsche, einem Pfarrerssohn und lebenslangen Sinnsucher. Die Schriftstellerin und Nietzsche-Vertraute Lou Andreas-Salomé bezeichnete ihn zutreffend als "im Grunde eine religiöse Natur, ein von der Religion herkommender Gottsucher ".[12] In Menschliches, Allzumenschliches lesen wir von diesem ‚Gottsucher‘:
Historia in nuce. – Die ernsthafteste Parodie, die ich je hörte, ist diese: "im Anfang war der Unsinn, und der Unsinn war, bei Gott! und Gott (göttlich) war der Unsinn".[13]
Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Die Rede von der "ernsthafteste[n] Parodie" zielt nicht auf Komisierung der Johannesverse. Gemeint ist, dass in der parodistischen Umformulierung ein Erkenntnisgewinn verborgen liegt, der ernst zu nehmen ist. Der Begriff "Unsinn" meint deshalb auch nicht ‚Quatsch‘ oder ‚Blödsinn‘, sondern verweist als ‚Un-Sinn‘, als ‚Nicht-Sinn‘ auf jenes Moment, das wir zu Beginn unserer Textbetrachtung schon fixieren konnten: auf Differenz. Wie der Faust in Goethes Tragödie in seiner Übersetzung der griechischen Eingangsverse Deutungen erprobt und schließlich die eine setzt, so füllt der Aphoristiker das griechische "logos", Luthers "Wort", auf seine eigene Weise. Der Ausgangs- und Zielpunkt allen Denkens, Handelns und Fühlens ist ihm nicht das Widerspruchsfreie, das in sich Stimmige, nicht der eine Sinn, ob er nun "Wort", "Kraft" oder sonst wie genannt wird, sondern ein Vielgestaltiges, ein in sich durchaus Widersprüchliches. Dieses ist dann immer auch etwas Dialogisches, so wie auch Gott etwas Dialogisches ist – jemand, zu dem ich spreche und der zu mir spricht und der sich mir im Dialog mit meinen Mitmenschen kund tut. Mit der Rede vom ‚Un-Sinn‘ formuliert der ‚Gott suchende‘ Philosoph keine Gegenrede gegen den johanneischen Text, sondern bietet eine Lesart im Lichte der Moderne. Sein "Im Anfang war der Unsinn" ist eine dialektische Entgegensetzung gegen die Behauptung des Eindeutigen, Monologischen, Diktatorischen. Gott ist nichts davon! Bewahrt wird durch den expliziten Bezug auf das JohEv die Sinnsuche, biblisch-religiös gesprochen: die Gottsuche als Aufgabe eines jeden einzelnen Menschen. Der Akzent liegt auf ‚Suche‘, weist auf Dialog und Offenheit; wer Gott meint gefunden zu haben, hat ihn – so diese Perspektive – vielleicht gerade verloren.
"Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort." Horchen wir in der Spurrille der literarischen Auseinandersetzung in der Moderne noch ein letztes Mal in die Eingangsverse des JohEvs hinein: Im Anfang war die Suche, nicht die Gewissheit, war die Differenz, ein Ich und Du, der Dialog. Das heißt nicht ein Durchstreichen des biblischen Textes, sondern im Gegenteil ein Lauschen auf die Vielstimmigkeit der Klänge, wie wir sie nicht nur im JohEv selbst hören, sondern in der Bibel als Ganzem, im Mit-, Neben- und Gegeneinander der Synoptiker, von Altem und Neuem Testament, von jüdischer Quelle und christlicher Überlieferung. Das Bewusstsein von der Vielstimmigkeit, von der Differenz bringt ein Offensein mit sich – ein Offensein für das Andere und Fremde, hier und anderswo. Die eigene Wahrheit steht unter dem Vorbehalt der immer nur begrenzten Erkenntnisfähigkeit. Die letzte Wahrheit, Gott, blieb selbst einem Faust unbegreiflich, aber gerade in der Suche nach ihr liegen ihr Wesen und ihre immerwährende Herausforderung.
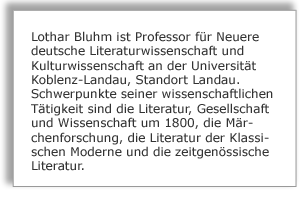 Für den Lehrenden hier und jetzt und im neuen Semester heißt das, sein Wissen nicht absolut zu setzen, es nicht als Geißel und Marterwerkzeug zu missbrauchen und nicht als der Weisheit letzter Schluss anzusehen, sondern es in Demut und pädagogischer Verantwortung als Dialogangebot zu unterbreiten – selbst in überfüllten Seminaren; für die Studierenden heißt das, dieses Wissen nicht als Diktat zu missachten, sondern als Kommunikationsangebot anzunehmen und im weiterführenden Gespräch für sich und andere produktiv werden zu lassen, selbst in der Entgegensetzung zu ihren Dozenten – trotz aller Noten und Notennöte. Für den Lehrenden hier und jetzt und im neuen Semester heißt das, sein Wissen nicht absolut zu setzen, es nicht als Geißel und Marterwerkzeug zu missbrauchen und nicht als der Weisheit letzter Schluss anzusehen, sondern es in Demut und pädagogischer Verantwortung als Dialogangebot zu unterbreiten – selbst in überfüllten Seminaren; für die Studierenden heißt das, dieses Wissen nicht als Diktat zu missachten, sondern als Kommunikationsangebot anzunehmen und im weiterführenden Gespräch für sich und andere produktiv werden zu lassen, selbst in der Entgegensetzung zu ihren Dozenten – trotz aller Noten und Notennöte.
Das wünsche ich Ihnen, liebe Studierenden und Kollegen, und auch mir im neuen Semester.
Und Ihnen, liebe Gemeinde, wünsche ich einen guten Sonntag und bitte um Nachsicht wegen soviel Wort und Sinn und ‚Un-Sinn‘.
[1] Hier und in der Folge wird nach der folgenden Ausgabe zitiert: Das Neue Testament. Griechisch und Deutsch. Griechischer Text: 27. Aufl. des Novum Testamentum Graece in der Nachfolge von Eberhard und Erwin Nestle gemeinsam verantwortet von Barbara und Kurt Aland u.a. Deutsche Texte: Revidierte Fassung der Lutherbibel von 1984 und Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift 1979. Hrsg. von B. und K. Aland. Stuttgart 32000, S. 247.
[2] Auf den poetischen Charakter insbesondere des Eingangsteils des JohEvs wies in den 1770er Jahren vor allem Johann Gottfried Herder in seinen Erläuterungen zum Neuen Testament aus einer neu eröffneten morgenländischen Quelle hin, wobei die Beschreibung eng mit seinem poetischen Schöpfungsbegriff verknüpft war. J.G. Herder: Sämtliche Werke. Hrsg. von Bernhard Suphan. Bd. 7. Berlin 1884, S. 335-470. Siehe hierzu und zum zeitlichen Kontext auch Daniel Weidner: Geist, Wort, Liebe. Das Johannesevangelium um 1800. In: Das Buch der Bücher – gelesen. Lesarten der Bibel in den Wissenschaften und Künsten. Hrsg. von Steffen Martus und Andrea Polaschegg. Bern 2006, S. 435-470, insb. S. 443-449. Noch immer lesenswert ist Dieter Gutzen: Poesie der Bibel. Beobachtungen zu ihrer Entdeckung und ihrer Interpretation im 18. Jahrhundert. Bonn 1972. Umfassend zur Deutungsgeschichte ist Henning G. von Reventlow: Epochen der Bibelauslegung. 4 Bde. München 1990-2001.
[3] Er ist eine Einführung in dem Sinne, in dem Rudolf Bultmann sie einmal beschrieben hat, als "eine Ouvertüre, die aus der Alltäglichkeit herausführt in eine neue und fremde Welt der Klänge und Gestalten". Rudolf Bultmann: Das Evangelium des Johannes. Unveränderter Nachdruck der 10. Aufl. [1941]. Göttingen 1978, S. 1.
[4] Siehe etwa Spr 8,22f.: "Der Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf, von Anbeginn her. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war."
[5] Bibel in gerechter Sprache. Hrsg. von Ulrike Bail u.a. Gütersloh 2006, S. 1982. – Zur Diskussion um die Edition siehe aus kulturwissenschaftlicher Perspektive Young-Mi Lee: Probleme der ‚Über-Setzung‘. Anmerkungen zur Bibel in gerechter Sprache. In: Wirkendes Wort 57 (2007), H. 2, S. 299-313.
[6] Zwei Beispiele: Der Krimi-Freund wird sich an den Erfolgsroman Am Anfang war das Wort der israelischen Schriftstellerin Batya Gur (München: Goldmann, 1991) erinnern, der in der deutschen Übersetzung die Eingangsverse des JohEv als Titel trägt. Im hebräischen Original lautet der Titel – wörtlich übersetzt – "Tod in der Fakultät für Literatur", was inhaltlich auch besser passt, da es eine Kriminalgeschichte im Universitätsmilieu ist, also in einer Welt, "in der Worte töten können", wie der etwas reißerische Werbetext auf dem Buchrücken tönt. – In satirischer Funktion verwendet Bodo Kirchhoff das Zitat in seinem jüngsten Roman bei der Charakterisierung seiner zentralen Erzählfigur Daniel Deserno: "Am Anfang war bekanntlich das Wort, nicht der Größenwahn, der kam erst nach der Schöpfung, und Worte stehen auch oft am Beginn von Karrieren, Omerta etwa bei der Mafialaufbahn oder Ruhm bei einer Filmkarriere. Und auch in meinem Fall kam das Wort nicht von Gott, sondern aus Amerika und hieß einfach hedge […] und das Hedging war die […] jeden Winkel nutzende große Geldvermehrung. Kurz: Ich war Investmentbanker […]." B. Kirchhoff: Erinnerungen an meinen Porsche. Hamburg: Hoffmann und Campe, 2009, S. 8.
[7] Ein schönes Beispiel bietet ein Artikel zur Kultur der Auseinandersetzung im frühen Christentum und in der frühen Kirche von Hakan Baykal: Am Anfang war der Streit. In: Epoc 03/2009, S. 18-24.
[8] Mit dem Themenfeld hat sich die Wissenschaft schon verschiedentlich beschäftigt; siehe zuletzt: Am Anfang war... Ursprungsfiguren und Anfangskonstruktionen der Moderne. Hrsg. v. Inka Mülder-Bach u. Eckhard Schumacher. München 2008.
[9] Aus der Fülle der Veröffentlichungen zur Rezeption der Bibel in der Literatur sei allein auf die folgenden Titel verwiesen: Johann Holzner und Udo Zeilinger (Hrsg.): Die Bibel im Verständnis der Gegenwartsliteratur. St. Pölten/Wien 1988; Tom Kleffmann (Hrsg.): Das Buch der Bücher. Seine Wirkungsgeschichte in der Literatur. Göttingen 2004; Christoph Gellner: Schriftsteller lesen die Bibel. Die Heilige Schrift in der Literatur des 20. Jahrhunderts. Darmstadt 2004; Olaf Berwald und Gregor Thuswaldner: Der untote Gott. Religion und Ästhetik in der deutschen und österreichischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Köln, Wien 2007. Materialreich, aber umstritten ist Georg Langenhorst: Theologie und Literatur. Ein Handbuch. Darmstadt 2005. Siehe dazu u.a. Hans-Rüdiger Schwab: Theologie und Literatur. Kritische Bemerkungen zu einem ‚Handbuch’. In: Wirkendes Wort 57 (2007), H. 2, S. 291-298.
[10] Johann W. Goethe: Faust. Eine Tragödie. In: Werke. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden. Bd. 3. Textkritisch durchgesehen und kommentiert von Erich Trunz. München 1982, S. 44 (V. 1224-1237).
[11] Siehe dazu Albrecht Schöne: Johann Wolfgang Goethe: Faust. Kommentare. (Sämtliche Werke im DKV-Verlag: I. Abt.; Bd. 7/2) Frankfurt/M. 1994, S. 246f.
[12] Lou Andreas-Salomé: Lebensrückblick – Grundriß einiger Lebenserinnerungen. (1951) Frankfurt/M. 1994, S. 84.
[13] Friedrich Nietzsche: Menschliches, Allzumenschliches. Kritische Studienausgabe. Hrsg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari. Band 2. München 1988, S. 388 (Vermischte Meinungen und Sprüche, Nr. 22).
|

