
Film-Lektüren |
Sterben in den Zeiten des Neoliberalismus
Bemerkungen zu Rob Reiners sentimentaler Screwball-Komödie The Bucket ListHans J. Wulff
Damit endet das erste Drittel des Films. Ein Kammerspiel, voller witziger Dialoge, Spitzen, die der eine dem anderen zukommen läßt. Kleine Verletzungen, die paradoxerweise eine Beziehung entstehen lassen. Es sind Coles Wunschvorstellungen, die von nun an die Geschichte antreiben - mit einem Fallschirm abspringen zu wollen, einen Ford Mustang 500 zu fahren, allerlei Sehenswürdigkeiten zu sehen, auf Großwildjagd zu gehen, das schönste Mädchen der Welt zu küssen. Die beiden gehen auf eine Weltreise, auf der sie die Liste abarbeiten. Sie geraten in eine wahre Kaskade von Urlaubsszenarien, unterbrochen durch Gespräche über Todesvorstellungen in der einen oder anderen Kultur. Phase II der Entwicklung ist angefangen, die sich ganz den Wunschvorstellungen einer kapitalistischen Glücksindustrie unterwirft. Carter widersetzt sich der Verführung durch eine schöne Frau; und er verhindert, dass Cole einen Löwen schießt. Ganz am Ende, nach den Pyramiden (bis zur Spitze erstiegen), dem Taj Mahal, der chinesischen Mauer (mit dem Motorrad befahren) und anderen touristischen Highlights, sind sie im Himalaya angelangt, doch der Berg liegt im Nebel, zeigt sich den beiden Todgeweihten nicht. Sie kehren zurück.
Nun - Phase III des Films beginnt - wird klar, dass Carter nur eine Katalysator-Figur ist, die Cole zu den wirklich bedeutsamen Werten des menschlichen Lebens bekehrt. Greifbar schon in einer der ersten Szenen nach der Rückkehr: Ein Abendessen; Carter im Kreis der Familie, mit den Kindern und den Enkeln, bei einem üppigen Festessen; im Gegenschnitt Cole, der in seiner ebenso modernen wie kalten und abweisenden Wohnung ein Fertiggericht aus der Mikrowelle zu essen versucht. Der Kontrast der beiden Männer scheint erneut auf, als Carter und seine Frau nach dem Essen die Nacht miteinander verbringen wollen, eine Verführungsszene aus ihrer beider Jugend wiederholend (gegen den deutlich promisken Cole, der trotz seines Alters immer noch die Rolle des Verführers spielt). Carter bricht zusammen, wird erneut eingeliefert, stirbt bei einer Operation. Cole hält die Totenrede für seinen Leidensgenossen, besinnt sich danach auf eine Tochter, die er nach der Scheidung einer seiner vier Ehen zurückgelassen hatte, sucht sie auf. Es kommt nicht nur zur Wiedervereinigung von Vater und Tochter, Cole kann auch die Enkelin, von der er nichts wußte, in die Arme schließen. Der letzte Punkt der Liste - einen fremden Menschen zu etwas Besserem machen - streicht Cole aus: Er ist selbst derjenige, der von Carter gelernt hat, das Wichtige im Leben zu sehen. So führt denn der Film einen Wertediskurs, der unterhalb der Geschichte liegt. Da geht es um zwei Lager, die einander entgegengestellt sind: dominante Orientierung an Geld und Reichtum versus Orientierung an sozialen Verpflichtungen; sexuelle Promiskuität versus eheliche Treue; Konsumismus und Luxus versus Dienst am Familienzusammenhalt und -wohlstand; Narzißmus und Selbstverliebtheit versus Akzeptieren der Pflicht, die Familie zufrieden zu machen; Lust am Exzeptionellen und Genuss des Extravangenten versus Befriedigung durch die Normalität des Alltagslebens. Der vieldimensionale Kontrast der beiden Hauptfiguren führt mitten hinein in einen Wertekonflikt der amerikanischen Realität, der naiver kaum sein könnte. Angesichts einer gesellschaftlichen Realität, in der Armut und Unsicherheit, Instabilität der Arbeitsverhältnisse und einer zunehmenden Verunsicherung von Identität alltägliche Wirklichkeit der meisten (und damit auch der meisten Zuschauer) ausmacht, angesichts auch eines durch die allgegenwärtige Werbung proklamierten Konsumismus (den man zynischerweise als „Ich konsumiere, also bin ich“ resümieren könnte) ist die Botschaft „Geld macht nicht glücklich“, die der Film vorträgt, das Eingeständnis einer fundamentalen ideologischen und moralischen Ratlosigkeit. Die Rückkehr zu fundamentalen Werten, die den Familienzusammenhalt als Kern eines moralischen Universums ansieht, entspringt einem Konservatismus, der die Augen vor den Konditionen eines Alltagslebens, das von neoliberalen Rahmenbedingungen abhängt, schlicht verschließt. Es mag für die Sehnsucht eines vor allem in den USA beheimateten Millionenpublikums sprechen, die eigene Unfähigkeit, Lebensperspektiven auf die Bedingungen des Spätkapitalismus auszurichten, wenn man die Besucher-Zahlen des Films sieht - 19,4 Millionen US-$ am Startwochenende (Spitzenreiter der US-Kinocharts), bis heute (4.3.2008) fast 88 Millionen US-$ Gesamtumsatz (bei 45 Millionen US-$ Produktionskosten); die 750.000 deutschen Besucher (bei annähernd 5 Millionen Euro Umsatz) nehmen sich dagegen eher bescheiden aus. Zuschauerzahlen signalisieren die Sympathie des Publikums für die Stars. Aber sie sind auch ein Indikator für die Themen und den Tonfall, in dem Themen behandelt werden. Das Beste kommt zum Schluß beantwortet eine Sinnfrage, die sich in Amerika anders stellt als in Europa - soviel darf geschlossen werden. Und nimmt dabei eine bewusst eingenommene naiv-konservative Haltung ein, wie wir sie schon aus den Komödien Frank Capras aus den 1930er Jahren kennen. Der Glaube an eine ursprüngliche Gutheit der Natur und des Menschen als eines Geschöpfes der Natur ist schon in diesen Filmen im Kontrast eigentlich „naiver“ Helden mit Figuren artikuliert, die dem urbanen, dem modernen, dem Geld-Amerika zugeordnet sind. Handlungsorientierungen wie Geldgier, Hedonismus gepaart mit Verantwortungslosigkeit, Entfremdung, Einsamkeit und Anonymität bilden eine Gegenwelt, gegen die die Helden ihre ursprünglichen Werte durchsetzen müssen (manchmal unter Zuhilfenahme solcher erzählerischer Tricks wie des Wunders resp. des deus ex machina). Filme wie Mr. Smith Goes to Washington (1939), Meet John Doe (1941) und vor allem It's a Wonderful Life (1946) exemplifizierten diese Wertewelt als eine ebenso einfache wie eindrückliche Rückbesinnung auf fundamentale Orientierungen der amerikanischen Tiefenideologie. Das alles gemahnt an die Wertewelt von Reiners Film. Ironischerweise inszenierte Capra die Vorstellungsbilder eines ruralen und pastoralen Amerika aber als Projektionen, als rückwärtsgewendete Phantasien des modernen, urbanen Amerika. Die Figur des John Doe trifft die „Farmerfiguren“, die ihn als Idol verehren, in New York, nicht in den Flächenstaaten. Diese Ironie sucht man in Das Beste kommt zum Schluß vergeblich. Es ist vor allem die Schlichtheit des moralischen Disputs, der dem Film unterliegt, die ihn so enttäuschend macht. Dabei wären die Ingredienzien erstklassig: Ein erfahrener Komödienregisseur (Rob Reiner hat u.a. Stand by Me, 1985, und Harry und Sally, 1989, gemacht). Zwei brillante Hauptdarsteller, die lustvoll das eigene Alter und die Gebrechlichkeit ihrer Körper ausspielen (Morgan Freeman oft allzu zurückhaltend, den moralisch gefestigten, vom Exzess überforderten Gutmenschen markierend, Jack Nicholson dagegen in augenzwinkerndem Overacting manchmal schon allzusehr den jungenhaft gebliebenen Faun gebend). Die exquisit erdachte und gespielte Sidekick-Rolle des Thomas, der Coles ebenso serviler wie renitenter Sekretär ist (die spitzen Dialoge zwischen den beiden gehören zum Ausgefeiltesten, was man derzeit an stichelnd-freundlichem Austausch zwischen Figuren im Kino geboten bekommt). Dazu eine erste halbe Stunde Kammerspiel im Krankenzimmer, die auf Bestes hoffen macht. Der Film verschenkt aber seine Chance, mehr als ein naives Sozialmärchen zu sein, schnell. Am Schluß treten das Respektlos-Komische und das Naiv-Kitschige noch einmal gegeneinander: Der sterbende Carter erzählt Cole vom Kopi Luwak, dem teuersten Kaffe der Welt - in Sumatra gebe es Baumkatzen, die Kaffeebohnen auffräßen, diese allerdings unbeschadet wieder ausschieden; die Einwohner sammelten den Katzenkot und gewännen erst daraus die Rohbohnen, die zu Kaffee geröstet würden (und Carter und Cole lachen, bis ihnen die Tränen kommen). Dagegen dann der Schluß - der Film beginnt und endet mit dem Ende der Geschichte: Carters Stimme erzählt im Voice-Over, dass Cole mit 81 Jahren an einem sonnigen Maitag verstorben sei: „Die Augen geschlossen, aber das Herz geöffnet.“ Coles Mitarbeiter Thomas erfüllt Coles letzten Wunsch und trägt dessen Asche (allein!) auf den Gipfel des Himalaya-Gebirges, wo schon Carters Asche in einem einfachen Schrein aus Steinen liegt. Beider Asche ist in einfache Kopi-Luwak-Blechbüchsen gefüllt, die einst den Kaffee aus dem Katzenkot enthielten. Filmographische Angaben: The Bucket List (Das Beste kommt zum Schluss); USA 2007. R: Rob Reiner. UA: 16.12.2007 (USA); 24.1.2008 (BRD). D: Jack Nicholson (Edward Cole), Morgan Freeman (Carter Chambers), Sean Hayes (Thomas), Beverly Todd (Virginia Chambers), Rob Morrow (Dr. Hollins). V: Warner. 97min, Farbe. FSK: Ohne Altersbeschränkung. |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/52/hjw7.htm |
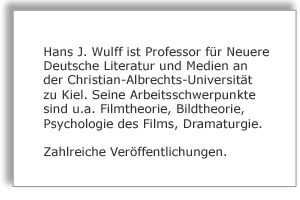 Zwei Männer, Ende der 60. Der eine Milliardär, der andere Automechaniker. Der eine trinkt den teuersten Kaffee der Welt - Kopi Luwak aus Sumatra -, der andere beharrt auf Instant-Kaffee. Beide haben Krebs. Sie lernen sich im Krankenhaus kennen, das dem Reichen gehört. Zweibettzimmer, grundsätzlich, es gebe keine Unterschiede, hatte der Reiche ganz am Anfang proklamiert. Das ungleiche Paar gewöhnt sich aneinander, Chemotherapien egalisieren, bei aller Distanz, die spürbar bleibt.
Zwei Männer, Ende der 60. Der eine Milliardär, der andere Automechaniker. Der eine trinkt den teuersten Kaffee der Welt - Kopi Luwak aus Sumatra -, der andere beharrt auf Instant-Kaffee. Beide haben Krebs. Sie lernen sich im Krankenhaus kennen, das dem Reichen gehört. Zweibettzimmer, grundsätzlich, es gebe keine Unterschiede, hatte der Reiche ganz am Anfang proklamiert. Das ungleiche Paar gewöhnt sich aneinander, Chemotherapien egalisieren, bei aller Distanz, die spürbar bleibt.  Es ist die Gebrechlichkeit des Körperlichen, die Phasen des Erbrechens, der Erschöpfung, der Müdigkeit, die in der erzwungenen Nähe der beiden Protagonisten ihre Annäherung möglich macht. Erst als für beide feststeht, dass die Befunde schlecht sind und ihnen ein halbes, vielleicht ein ganzes Jahr Lebenszeit verbleibt, solidarisieren sie sich. Carter, der Mechaniker, hatte eine Liste aufzuschreiben begonnen, auf der er diejenigen Dinge, die in seinem Leben noch zu tun bleiben, notiert. So zum Lachen zu kommen, dass er weinen muß; etwas Erhabenes sehen. Die Idee dazu stammte aus dem einen halben Semester Philosophiestudium, in der die Studenten eine solche Liste zusammenstellen sollten. Angesichts des schlechten Befundes zerknüllt er die Liste, Cole, der Milliardär, findet sie, setzt sie seinerseits fort. „Löffelliste“ - die Liste, die man sich vornimmt, „bevor man die Löffel abgibt“: Der Zynismus der Benennung deutet auf die Selbstdistanz hin, mit der die beiden Todgeweihten ihre lebensgeschichtliche Situation wahrnehmen.
Es ist die Gebrechlichkeit des Körperlichen, die Phasen des Erbrechens, der Erschöpfung, der Müdigkeit, die in der erzwungenen Nähe der beiden Protagonisten ihre Annäherung möglich macht. Erst als für beide feststeht, dass die Befunde schlecht sind und ihnen ein halbes, vielleicht ein ganzes Jahr Lebenszeit verbleibt, solidarisieren sie sich. Carter, der Mechaniker, hatte eine Liste aufzuschreiben begonnen, auf der er diejenigen Dinge, die in seinem Leben noch zu tun bleiben, notiert. So zum Lachen zu kommen, dass er weinen muß; etwas Erhabenes sehen. Die Idee dazu stammte aus dem einen halben Semester Philosophiestudium, in der die Studenten eine solche Liste zusammenstellen sollten. Angesichts des schlechten Befundes zerknüllt er die Liste, Cole, der Milliardär, findet sie, setzt sie seinerseits fort. „Löffelliste“ - die Liste, die man sich vornimmt, „bevor man die Löffel abgibt“: Der Zynismus der Benennung deutet auf die Selbstdistanz hin, mit der die beiden Todgeweihten ihre lebensgeschichtliche Situation wahrnehmen.