
Kirchenmusik |
Con moto agitatoEin kirchenmusikalisches Thema mit zwölf Variationen und einer CodaWolfgang Vögele Kirchenmusikalisches Thema
Dieser Essay besitzt erst einmal kein Thema, er muss es erst finden. Denn wer Kirchenmusik sagt, kann damit ganz Unterschiedliches meinen. Unter dem baldachinartigen Oberbegriff verbergen sich ganz verschiedene Musikstile und Phänomene: Orgelmusik und Orgelbau, Chorsingen in kleinen und großen Ensembles, Motetten, Oratorien und Kantaten, Gospelkirchentage und Posaunenchorarbeit, geistliche Popmusik und gregorianischer Gesang, liturgische Stücke und Anbetungslieder, Luther-Oratorien und Bonhoeffer-Musicals sowie anderes mehr.
Kirchenmusik geht keineswegs mehr auf in den Stichworten Orgel, Kantorei, Bläserkreis, Kirchenchor, Gottesdienstbegleitung und Weihnachtsliedersingen. Entsprechend haben sich die Aufgaben von Kantoren verschoben. Die alte Generation großer musikalischer Persönlichkeiten, die sich vom Orgelspielen bis zum Chordirigieren um alles selbst gekümmert haben, ist abgelöst worden von einer neuen Generation von Kantoren, die in ihrer Arbeit bestimmte Schwerpunkte setzen, manchmal bestimmt nur durch eigene Vorlieben und Talente, manchmal bestimmt durch ein reflektiertes Programm. Aus den kirchenmusikalischen Generalisten, die oftmals auch Generäle waren, sind Spezialisten geworden, die sich auf wenige Aufgaben konzentrieren und ansonsten (hoffentlich) bereit sind, eine Aufgabe auch einmal zu delegieren. Für diesen Essay habe ich mir die Aufgabe gestellt, einige neue Entwicklungen der protestantischen Kirchenmusik aus der Perspektive des musikalisch interessierten Theologen zu beleuchten. Subjektivität ist selbstverständlich, Vollständigkeit wird nicht angestrebt, die verbreitete Unübersichtlichkeit lässt sich nicht in klare Gegensätze auflösen – so wie man in den Sechzigern und Siebzigern den zentralen Konflikt der Kirchenmusik als einen Gegensatz zwischen U- und E-Musik beschreiben konnte. Es geht darum, in einem ersten Schritt Beobachtungen zu sammeln und zu ordnen, vielleicht darüber nachzudenken, was im Dialog zwischen Kirchen und Musik die Aufgabe der Theologie sein könnte. Ein Freund pflegte nach bestimmten kirchenmusikalischen Veranstaltungen das Bonmot zu äußern, manche Kantoren betrieben Kirchenmusik, andere Musik in der Kirche. Aber auch dieser Gegensatz beschreibt nicht hinreichend das, was ich in den folgenden Variationen an Beobachtungen und Schlussfolgerungen zusammengetragen habe. Ich habe am Ende auch meine eigene Meinung einfließen lassen, womit ich nicht bestreite, dass man das vielfältige kirchenmusikalische Ganze auch völlig anders sehen kann. Wenn man diese Beobachtungen zu einer These verdichten will, dann würde ich vorläufig sagen: In der Kirchenmusik verschwimmt zunehmend die Grenzen zwischen Innen und Außen, zwischen funktionaler Gottesdienstbegleitung und künstlerischer Leistung, zwischen professionellen Leistungen historischer Aufführungspraxis und der genauso faszinierenden Arbeit mit Laien, Kindern, Jugendlichen und Senioren. Spannend wird dieses Überschreiten von Grenzen dort, wo nicht Bekanntes wiederholt, Beliebtes in die Kirche übertragen und Erfolgreiches einfach kopiert wird, sondern wo Neues, Erhellendes, Reflektierendes den Raum des Musikalischen und Theologischen erweitert. Wo das geschieht, lohnt sich das Nachdenken. Bei der zigsten Aufführung des Mozart-Requiems und beim Luther-Oratorium mit Tausenden von Sängern fehlt dieses Moment des Reflektierenden und Neuen. Diesem allen will ich nun in kirchenmusikalischen Variationen nachgehen, im Konzertsaal, auf dem Podest, beim Oratorienkonzert, in verschiedenen Registern der Orgel bis hin zu den Proben von Kinderchören und den Anbetungsliedern in Lobpreisgottesdiensten. Variation I: Extra musicam ecclesiae nulla salus?Keineswegs ist die musikalische Auseinandersetzung mit Religion auf die Kirchenmusik beschränkt. In den letzten Jahren waren spannende Entwicklungen auf der Bühne des Theaters und im Konzertsaal wahrzunehmen.[1] Der Regisseur Herbert Wernicke brachte in Basel ein Stück mit Bach-Kantaten („Actus tragicus“) auf die Bühne. Nach seinem frühen Tod wurde die Inszenierung in Stuttgart übernommen und erzielte dort große Erfolge. Andere Regisseure habe es Wernicke nachgetan, sie unterlegten andere Bach-Kantaten mit inszenierten Geschichten. Händels Messias wurde szenisch am Theater an der Wien gezeigt. Dabei wurde dem Stück eine tragische bürgerliche Geschichte unterlegt. In der Spannung zwischen erzählter Geschichte und vertonten Bibelversen entstanden neue Resonanzräume für die Musik, die manchmal nicht ohne Ironie Händels gelegentlich steif pompösem Oratorium neue Deutungsaspekte abgewannen. In Berlin und Baden-Baden studierte der Regisseur Peter Sellars Bachs Johannes- und Matthäuspassion halb szenisch ein, mit ganz einfachen Mitteln, beinahe ohne Requisiten. Die Berliner Philharmoniker führten beide Werke zusammen mit dem Berliner Rundfunkchor auf. Es war faszinierend zu sehen, wie Sellars im Nachhinein der zeitgenössischen barocken Kritik Recht gab, die Bachs Passionen als zu theatralisch und damit einer Kirche unangemessen empfand. Auf der Konzertbühne wurden die Passionen plötzlich als menschliche Leidensgeschichten sichtbar, plötzlich befreit von all dem Wust theologischer Deutungen, der sich in Jahrhunderten angesammelt hatte. Das heißt nicht, dass die Auseinandersetzung über Kreuzestheologie von Sellars ausgeblendet worden wäre. Aber es heißt, dass die Verlagerung eines Kontextes, hier von der Kirche in den Konzertsaal, manchmal Räume öffnet, die dem neuen theologischen Verständnis von alten Texten zuträglich sind, zumal wenn dadurch die Texte der Passionsgeschichte von vielem Deutungswust befreit werden. Das gilt ausdrücklich auch dann, wenn der Regisseur Sellars vermerkt, er habe mit seiner Interpretation der Johannespassion keine neue theologische Deutung vorlegen wollen. Vielmehr lag es in seiner Absicht, eine solche Deutung ausdrücklich dem Zuschauer zu überlassen. Ob der Zuschauer, der Musiker oder Regisseur anfängt, sich theologische Gedanken beim Hören und Sehen der Passionsgeschichte zu machen, sollte letztendlich keine Rolle spielen. Solche Verlagerungen des Kontextes können auch misslingen, wie es bei einer von Aufführung von Bachs h-Moll-Messe durch das renommierte Bach Collegium Japan unter Masaaki Suzuki ebenfalls im Baden-Badener Festspielhaus zu erleben war. Das Werk verlor den Charakter einer Messe, wie sich das kleine Ensemble auf der riesigen Bühne und der Klang im riesigen Konzerthaus verloren. Dieser Versuch, Kirchenmusik auf virtuose Aufführungspraxis zu reduzieren, muss als misslungen betrachtet werden. Das Ergebnis wirkte ebenso schal wie steril. Ein letztes Beispiel: Auf die Konzerte des Heidelberger Dirigenten Walter Nußbaum habe ich schon an anderer Stelle hingewiesen[2]. Zuletzt hörte ich in Karlsruhe im Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) den Abend „Heimathen“ mit der Schola Heidelberg und dem Ensemble Aisthesis. Dieser Abend des ehemaligen Kirchenmusikers Nußbaum war nicht darauf angelegt, Werke aus der Kirche in einen Saal, der normalerweise elektronischer neuer Musik vorbehalten ist, zu transformieren. Mir wurde beim Hören etwas anderes wichtig: In allen an diesem Abend aufgeführten Werken setzte sich Nußbaum mit den Themen Exil, Heimat, Vertreibung, Flucht auseinander. Dafür hatte das Ensemble eigens Kompositionsaufträge vergeben, dafür führte man aber auch klassische romantische Werke von Brahms und Silcher auf, die die Zuhörer in diesem Kontext gar nicht vermutet hätten. Im Ergebnis entstand so eine philosophisch-musikalische Meditation über das Thema Flucht und Exil. Das Konzertprogramm bildete sich aus einer Collage von ganz heterogenen Werken, deren gemeinsame Aufführung neue Perspektiven eröffnete. Das Nebeneinander des eigentlich nicht Zusammenpassenden schuf eine neue, reflektierte gedankliche Sphäre, welche über die akustische Wahrnehmung hinaus die Hörer zum Nachdenken anregte. Genau das scheint mir ein wesentliches Moment reflektierter Musik (wie reflektierter Kultur überhaupt): Sie verleiht Erfahrungen Ausdruck, die ohne die Aufführung der Werke verloren geblieben wären. Und diese Erfahrung geht nicht im Sentimentalen auf, sie lässt den Zuhörer nicht in Emotionen versinken, sondern lässt ihm genügend freien Raum, um neben der Emotion zu eigenem Nachdenken zu kommen. Sage niemand, Nußbaums Konzerte richteten sich an nur ein Spezialistenpublikum: In Heidelberg hat sich der Musiker über die Jahre einen Zuhörerstamm aufgebaut, der nun regelmäßig für ausverkaufte Säle und Kirchen sorgt, gerade weil jeder Konzertbesucher weiß, dass er dort nicht nur das Übliche geboten bekommt. Dieser Typus, Konzertprogramme zusammenzustellen ist einem zweiten, in der Kirchenmusik viel häufigeren Typus der Konzertplanung entgegengesetzt: Letzterer setzt ausschließlich auf das Prinzip der Wiederholung des Bewährten und Bekannten. Und jeder Connaisseur weiß um den schmalen Kanon etablierter Oratorienkonzerte. Dabei ist zu sagen: Im Bereich der Oper und der philharmonischen Musik wird das Etablierte und Bewährte, das Risikolose genauso totgeritten wie im Bereich oratorischer Kirchenmusik. Die dreiundfünfzigste Aufführung des Weihnachtsoratoriums unterscheidet sich in nichts von der seit Jahrzehnten bewährten Repertoire-Aufführung der Zauberflöte oder der wiederholten Aufführung von Beethovens Violinkonzert beim Abonnementsabend. Die Wiederholung macht die (Kirchen-)Musik zum Ritual, die Uraufführung neuer Werke macht sie zum Experiment. Rituale schaffen Gewohnheiten, Experimente schaffen Reformen und Reformationen. Kirchenmusik, die von klerikalen Funktionären bevormundet wird, kann nichts Neues hervorbringen. Aber davon später. Variation II: Hörst du nicht die Glocken?Kirchenmusik wird ja nicht nur mit Orgel und Stimmen aufgeführt. Zur Kirchenmusik im weiteren Sinne gehören mit Sicherheit auch die Glocken im Turm, schon deshalb weil sich bei ihnen das Verhältnis von Innen und Außen in besonderer Weise justiert und sich am Beispiel der Glocken besonders gut musikalisch-akustische Veränderungen zeigen lassen. Spätestens seit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert, die neue Lärmquelle wie Motoren und Maschinen mit sich brachte, sind die Glocken im Kirchturm nicht mehr die einzige Quelle akustischer Signale. Dazu kamen Sirenen, Hupen der Autos und anderes mehr. Vor der Modernisierung strukturierten Glocken die Zeit, sowohl die tägliche Zeit vom Morgengebet bis zum Abendläuten als auch die Zeit des Kirchenjahres mit hervorgehobenem Läuten am Sonntag und bei hohen kirchlichen Festen. Besondere Glocken zeigten Taufen, Beerdigungen und Trauungen an. Andere Glocken warnten vor Gefahren bei Gewitter, Feuer, Sturm und bei feindlichen Angriffen. Alle diese sozialen Funktionen von Glockenläuten traten mit der Modernisierung an den Rand und fielen schließlich zum großen Teil weg. Für Tageszeiten und Termine benutzt jeder eine Armbanduhr oder das Smartphone, Gewitterwarnungen liefert eine Katastrophen-App auf dem Handy. Zusätzlich wird der Glockenklang durch störende Lärm- und Geräuschquellen wie Verkehr, Motorgeräusche und anderes immer weiter in den Hintergrund gedrängt. In der Stadt hat sich dieser Prozess noch sehr viel stärker ausgewirkt als auf dem Dorf. Dort, wo noch Glocken im Kirchturm hängen, werden diese zwar von Liebhabern noch regelmäßig gepflegt und vor allem zur Ankündigung von Gottesdienst regelmäßig geläutet, aber unbedingt nötig wäre das nicht mehr. Gemeindeglieder müssen sich nicht an den Glocken orientieren, um pünktlich zum Gottesdienst zu erscheinen. Viele Menschen, die diese soziale Funktion des Läutens vergessen haben, empfinden den Klang von Glocken als Lärm und bemühen die Gerichte, um das regelmäßige Schlagen in der Nacht oder am frühen Morgen zu unterbinden. Bisher haben die Gerichte zwar regelmäßig das Läuten aus Anlass eines Gottesdienstes mit dem Verweis auf die Religionsfreiheit gebilligt, aber beim Glockenschlag zur Anzeige der Uhrzeit gingen sie sehr viel restriktiver vor. Das Bewusstsein, dass dieser zunehmende Verlust des Läutens die akustische Kultur von Städten und Dörfern in den letzten Jahrzehnten vollständig verändert hat, ist noch nicht bis in die Breite der Bevölkerung durchgedrungen. Und dieser Verlust einer Kultur akustischer Aufmerksamkeit ist auch von Kantoren und Kirchen nicht richtig bemerkt worden. Nun kann man sagen: Die Moderne ist sehr viel stärker auf Bilder und Filme fixiert als auf akustische Signale. Gegen die Wendung zu den Bildern ist nichts zu sagen, aber mit diesem Prozess sind nicht nur Gewinne, sondern im Bereich des Akustischen auch Verluste verbunden. Projekte, die dieser akustischen Glockenvergessenheit entgegenzusteuern versuchen, kommen fast schon zu spät. Doch der Tod der Glocken zeigt auch einen Bedeutungsverlust der Kirchenmusik an. Die Glocken besitzen noch einen großen Kreis von Liebhabern, deren Motiv für die Glockenschwärmerei liegt aber häufig in einer gewissen Nostalgie, in der Sehnsucht nach einer vergangenen guten alten Zeit, die unwiederbringlich verloren ist. Deswegen sind Spendenprojekte für neue Glocken meist ohne große Fundraisingmaßnahmen erfolgreich. Wer aber die Glocken an den Kirchtürmen retten will, sollte sich nicht auf ein nostalgisches Gefühl verlassen, sondern an der Rückgewinnung ihrer Gegenwartsbedeutung arbeiten. Glocken zielen nicht auf das Konzert, sondern auf den Alltag. Wer über den Alltag nachdenkt, der bemerkt, wie vielen störenden akustischen Signalen und Geräuschen er den ganzen Tag über ausgesetzt ist. Lärm als Umweltproblem konnte erst entdeckt werden, nachdem im Zuge der Industrialisierung Maschinen intensiv eingesetzt wurden. Glocken als musikalische Signalinstrumente, die in Westeuropa meist an die Kirch- und Rathaustürme gebunden sind, haben den Kampf gegen Lärmbelastung, störende Geräusche und die Individualisierung des akustischen Raums (Kopfhörer, MP3-Player) längst verloren. Es fehlt weitgehend an kirchenmusikalischen Konzepten, den Glocken trotzdem etwas von der Würde ihrer alten Funktion zu bewahren. Hier besteht dringender Änderungsbedarf. Variation III: Nobody Knows the Trouble I‘ve SeenZu den Neu-Entwicklungen der letzten Jahrzehnte zählt der Gospelchor, der in der Kirchenmusik neben Oratorienchor, Kammerchor und Kinderchor getreten ist. Gospel ist entstanden als Musik afrikanischer Sklaven, die auf Baumwollplantagen der amerikanischen Südstaaten Zwangsarbeit leisten mussten. Zum Gospel gehörte im Kontext von Sklaverei und Benachteiligung der farbigen Bevölkerung stets ein Moment des Biblischen und des Befreienden, das er über ein Jahrhundert später durch seinen Import nach Westeuropa wie selbstverständlich verloren hat. An die Stelle von Bibel und Befreiung treten das Bedürfnis nach Emotionalität, nach Lässigkeit und eine gewisse Nähe zur Popkultur, die den Gospel von traditioneller Kirchenmusik absetzt. Neben Emotionalität ist Rhythmus ein wichtiges Element, die Zuschauer müssen nicht still sitzen, sondern es darf geklatscht werden. Es herrscht gelegentlich der Eindruck des Eintönigen vor, weil alle Chöre immer von neuem die alten Standards wiederholen: Glory, glory, hallelujah und When the Saints go marching in und Go down Moses. Der Gesang klingt gelegentlich zu emotional, zu optimistisch, zu wenig abwechslungsreich. Eine Freude des Glaubens wird beschworen, in der alles Negative, Böse, Störende ausgeblendet wird. Die Melancholie und die Trauer, die Gospel als Musik von Sklaven einmal besaß, werden preisgegeben für eine Dauerberieselung in Dur, die nach dem dritten Programmpunkt fade und eintönig wirkt. Manchmal kann auch das Lockere, Gelöste, Heitere sehr anstrengend sein. Trotzdem ist nach dem unbestreitbaren Erfolg der Gospelbewegung zu fragen. Sogenannte Gospelkirchentage kopieren das erfolgreiche Kirchentagskonzept mit Papphockern und Massenveranstaltungen und Chorworkshops. Es ist zu vermuten, dass der Grund für den Erfolg in diesem Dauerzustand positiver Emotionalität liegt, welcher ein Gegengewicht bildet zu den chaotischen, überfordernden mentalen Zuständen des Alltags. Gospelmusik macht die Welt angeblich einfacher – jedoch kann man leider nicht dauernd proben. Irgendwann kommt unweigerlich der Punkt, an dem jeder die – man muss das so sagen - Produktionsweise dieser Emotionalität durchschaut und sich nicht mehr davon blenden lässt. Das gilt auch für die Milieus der Menschen, die Proben von Gospelchören besuchen. Man merkt unweigerlich irgendwann, dass Gospel seinen ursprünglichen Sitz im Leben verloren hat. Solange dieses Leerlaufen emotionaler Positivität nicht als Vorspiegelung falscher Tatsachen durchschaut wird, kann sich die große Bewegung der Gospelchöre über mangelnden Zulauf nicht beklagen. Chöre von über zehntausend Menschen bei Gospelkirchentagen erinnern jedoch unweigerlich an musikalische Zeltmission, wie überhaupt nach dem theologischen Element im Gospel zu fragen ist. Der Drang nach Emotionalität, nach Herzensglauben, nach praktischem Christentum gibt der ganzen Bewegung ein anti-intellektuelles, um nicht zu sagen pietistisches Element, das kirchenmusikalisch und kirchlich durch kein Gegengewicht abgefedert wird. Kirchlich erfreut sich die Gospelbewegung aus dem einfachen Grund großer Beliebtheit, weil sie bei den Sängern der Chöre und den Besuchern der Konzerte große Zulaufzahlen erreicht. Deshalb hat man flugs in den größeren Städten Gospelgottesdienste eingerichtet, die mit mehr Musik und weniger Liturgie und Predigt bei den entfremdeten Gottesdienstbesuchern zu punkten versuchen. Schlimmer und problematischer wird es, wenn die Kirchen sich breitschlagen lassen, kirchliche Musicals (Luther, Die zehn Gebote und unvermeidlich Bonhoeffer) in riesigen Hallen mit riesigen Chören, für die man vorher innerkirchlich kräftig die Werbetrommel gerührt hat, mit großen finanziellen Mitteln zu unterstützen. Musikalisch haben solche Massenveranstaltungen keinen großen Wert, kirchlich lassen sie sich von der simplen Devise leiten, dass alles gut sein muss, was möglichst viele Teilnehmer, Engagierte und Zuhörer zusammenbringt. Dafür drücken die klerikalen Marketingexperten, die sich als Theologen ausgeben, gern einmal beide Augen zu, wenn nur die zehntausende in die Messehallen strömen. Die Kirchenmusik macht sich hier aus offensichtlichen Gründen zur Dienerin des Massenauflaufs und des Massengeschmacks. Variation IV: Yeah, yeah, yeahMassengeschmack ist ein Reizwort, das gar nicht gern gehört wird, und selbstverständlich haben sich auch in der Kirchenmusik die Grenzen zwischen dem Elitären und dem Allgemeinverständlichen in den letzten Jahrzehnten stark verschoben. Die vormals starren und unüberwindlichen Grenzen sind durchlässig geworden. An einem theologisch überaus reflektierten Song wie Leonard Cohens „Halleluja“ lässt sich dieser sehr spannende Prozess sehr anschaulich studieren.[3] Er zeigt auch, wie nahe Gebrauch und Missbrauch beieinanderliegen. Denn wenn etwa André Rieux diesen Song mit einem Orchester von Streicherinnen, die alle eine Art Hochzeitskleider aus synthetischem rosa Stoff tragen müssen, aufführt, dann wird ein anspruchsvolles Lied als Schmachtfetzen zum Geldverdienen missbraucht. Das gilt umso mehr, als Rieux nicht davor zurückschreckt, gerade bei diesem Stück lokale Musikgruppen mit behinderten Menschen einzubeziehen, um den Schmachtcharakter der Musik noch zu verstärken. Nun weiß auch jeder Besucher solcher Konzerte, dass André Rieux trotz der Beteuerung des Gegenteils vor allen Dingen Geld verdienen und keine Kirchenmusik aufführen will. Das Beispiel zeigt sehr gut, dass es vor allen Dingen auf Kontexte ankommt. Musik wird nicht im leeren Raum gespielt, sondern der Raum trägt zur Musik bei. Gelegentlich predige ich in einer CVJM-Gemeinde. Dabei spielt jedes Mal eine Band, Gitarre, Schlagzeug, Bass, Querflöte, Gesang, die Besetzung ist jedes Mal neu, jedes Mal sind andere junge Leute engagiert. Der technische Aufwand mit Mikrophonen und Verstärkern ist enorm. Die Texte der Lieder werden via Beamer an die Wand projiziert. Ich vermute, aus Rücksicht auf mich spielt die Band bei jedem Gottesdienst, in dem ich mitwirke, einen Choral. Die Texte der anderen Songs sind in der Regel englisch, aber das hindert niemanden am Mitsingen. Die Lieder haben eine gewisse Nähe zu Schlager und Popsongs. Im Unterschied zum „klassischen“ Gottesdienst folgt nach der Predigt eine Phase, in der mindestens vier oder fünf Lieder hintereinander gesungen werden. So bekommt die Musik des Gottesdienstes ein größeres Eigengewicht. Man könnte nun diesen Songs den Vorwurf des christlichen Populismus machen, wie beim Gospel, aber trotzdem wirkt innerhalb des Gottesdienstes die Musik stimmig und angemessen. Sie ist gut gemacht, sie ist liturgisch und theologisch integriert, sie setzt sich nicht davon ab und widerspricht oder kontrastiert den gesprochenen Teilen des Gottesdienstes nicht. Kurzum: Die Musik ist in diese Gottesdienste in authentischer Weise integriert. Sie wird professionell aufgeführt und ordnet sich in den Gottesdienst ein. Sie nimmt die Lebenswelt derjenigen auf, die ihr zuhören, ohne banal oder oberflächlich zu wirken. Die Lieder repräsentieren gegenwärtigen Musikgeschmack. Manchmal kann man das einfach so stehen lassen. Die Einbindung in den Gottesdienst bedeutet einen wichtigen Unterschied: Das Konzert von André Rieux‘ oder das biblische Musical in der Messehalle nehmen religiöse Lieder in Gebrauch und nutzen emotionale wie musikalische Gehalte für ihre Zwecke, während die Lieder der CVJM-Band in ein bestimmtes liturgisches und theologisches Konzept von Gottesdienst integriert sind. Es geht nicht um Funktionalisierung, sondern um Integration, nicht um Dominanz, sondern um Einbindung. Ein anderes Beispiel: Während meiner Gemeindetätigkeit erlebte ich mehrere Jahreskonzerte einer Tensing-Gruppe. Das Konzept kommt ursprünglich aus Norwegen. Eine Gruppe Jugendlicher trifft sich ein ganzes Jahr lang jede Woche zu Proben und führt als Abschluss ein selbstgeschriebenes Musical auf, das selbstgeschriebene Chormusik mit Cover-Versionen bekannter Pop- und Rocksongs miteinander verbindet. Die Gruppen betreiben enormen Aufwand für Sound- und Beleuchtungsanlage. Zur Aufführung kommen nicht religiöse Lieder, sondern solche Musik, die Jugendlichen hören und die in die selbst entwickelte Geschichte hineinpassen. Der Fokus der Veranstaltung liegt nicht auf der Aufführung am Ende der jährlichen Probenphase, der Fokus liegt auf den Proben, auf dem gemeinsamen Leben, auf den Abstimmungsprozessen über die Geschichte. In jeden Probenabend ist eine gemeinsame Andacht integriert. Tensing ist Jugendarbeit mit musikalischen Mitteln. Die Konzerte sind nur Höhepunkt, aber nicht der eigentliche Zweck. Die aufgeführte Musik orientiert sich sichtlich an dem, was die Jugendlichen, die sich beteiligen, gerade hören. Man kann fragen: Ist das überhaupt noch Kirchenmusik? Oder ist das nur Jugendarbeit mit viel Lärm beim Abschlusskonzert? Jeder Besucher, der die dreißig überschritten hat, wird genau das während des Konzerts mindestens einmal denken. Auf der anderen Seite sind solche Konzerte nicht für Besucher über dreißig gemacht. Sie repräsentieren die musikalische Lebenswelt von jungen Leuten, die sonst mit dem, was sie in ihren Knöpfen im Ohr hören, in der Kirche gar nicht präsent sind. Wer fragt, ob das noch Kirchenmusik ist, der muss genauso fragen: Wo kommen die jungen Leute mit ihrer Lebenswelt in der Kirche und in der Kirchenmusik vor? Bei Gregorianik, Choral, Bachkantate oder Oratorium? Variation V: Vox céleste und Bombarde
Aber Handwerk hat zu Recht seinen Preis, deswegen werden in der Bundesliga des Orgelbaus mindestens genauso viele Konzertorgeln wie Kirchenorgeln verkauft. Die Zahl der Pfeifen und Register spielt manchmal eine größere Rolle als der veritable Preis. Die Installation und Stimmung einer Orgel in einem Konzertsaal oder in einer Kirche ist ein langwieriger Prozess, der mehrere Monate in Anspruch nimmt[5]. Raum, Akustik und Instrument gehen miteinander eine feste Verbindung ein. Die Konjunktur für Konzertorgeln bildet ein Indiz, dass die Orgelmusik im Moment dabei ist, sich aus ihren kirchenmusikalischen Zwängen zu befreien. Dazu kommt, dass die Ansprüche an Orgeln gestiegen sind. Kantoren schreiben dann gerne, dass die Orgel so ausgestattet sein soll, dass Literatur aus allen musikalischen Epochen darauf gespielt werden kann. Elektronische Registraturen machen den Wechsel zwischen Klangfarben, Manualen und Pedalen einfacher. Der Kirchendiener, der den Blasebalg für die Orgel treten musste, ist schon vor langer Zeit in den Ruhestand getreten. Das wird auch das Schicksal des Orgelschülers sein, der bei den Konzerten neben seinem Lehrer steht und als einziger die Registrierungsanweisungen zu entziffern und umzusetzen versteht. Die zunehmende Zahl von Registern, die Zahl der Kombinationsmöglichkeiten von Registrierungen macht die Orgel zunehmend zur genialen Spieldose, der sich Myriaden von Klangfarben entlocken lassen. Nicht alle Organisten geben dieser Versuchung nach, aber die Verlockung ist groß, besonders bei den im Moment in Mode gekommenen Orgelbearbeitungen von Stücken, die für andere Instrumente geschrieben sind. Man kann das erwähnte „Halleluja“ Leonard Cohens, das dieser mit rauchiger Bassstimme mehr spricht als singt, selbstverständlich auch für die Orgel registrieren, wie auch die Cellosuiten Bachs auf dem Pedal spielen oder Wagners Meistersinger-Ouvertüre im Tutti sämtlicher Register auftrumpfen lassen. Trotz aller Pflege und Bewunderung für die Handwerkstradition, den von Hand gemachten Klang ist diese europäische Orgeltradition im Moment mit einer amerikanischen Entwicklung konfrontiert, die alles Handwerkliche, Greifbare, Physische souverän ignoriert. Amerikanische Orgelbauer haben begonnen, rein elektronische Orgeln zu entwerfen und zu bauen[6]. Die Pfeifen fallen dabei weg, der Klang wird durch einen Synthesizer erzeugt, der zwischen Spieltisch und Lautsprecher geschaltet wird. In Europa wird diese Entwicklung bisher, so weit zu sehen ist, noch ignoriert, aber der amerikanische Organist Cameron Carpenter, von dem gleich noch zu reden sein wird, hat mit seiner „Touring Organ“ neue Wege bestritten, die auch in Europa wahrgenommen werden. Für alteuropäische Ohren klingt das zuerst einmal nach dem stolzen Friedhofsbetreiber, der anstelle einer Pfeifenorgel ein billiges elektronisches Instrument gekauft hat und dann meint, er habe für die kaputte Pfeifenorgel vollständigen Ersatz gefunden. So war es einmal, als die Qualität der Instrumente, vor allem des Klangs, der Pfeifenorgel noch nicht gleichkam. Die neueren elektronischen Instrumente machen es schwieriger, digitalen und originalen Klang voneinander zu unterscheiden. Aber dieser Platz in der Kirche hat sich in den letzten hundert Jahren ebenfalls verändert. Früher war der Ort der Orgel hinten, gegenüber dem Altar, auf der Westempore, vielleicht noch auf der Seitenempore. Spätestens mit dem Wiesbadener Programm des Kirchenbaus[7] hat sich das geändert. Die Orgel formte nun zusammen mit Altar und Kanzel das gottesdienstliche Dreieck, das ganz selbstverständlich vorne, im Sichtbereich aller Gottesdienst- und Konzertbesucher konzentriert war. Die altvorderen Wiesbadener Theologen und Architekten hatten der Orgel eine eigene Rolle bei der Begleitung des Gemeindegesangs im Gottesdienst zugedacht. Mit der zunehmenden Vergrößerung von Orgeln verschiebt sich allerdings auch das Gleichgewicht des gottesdienstlichen Dreiecks. Die Orgel wird vom Begleit- zum Konzertinstrument. Der vorher unsichtbare Organist ist plötzlich zu sehen. Er wird vom musikalischen Begleiter, vom Kooperator mit dem Liturgen im Gottesdienst, zum Virtuosen, der sich präsentiert. Einigen Kantoren ist so viel Sichtbarkeit zu viel geworden. Als vor Jahren die Orgel der Heiliggeistkirche in Heidelberg neben dem Altar eingebaut wurde, ließ der zuständige Kantor bald eine spanische Wand anschaffen, hinter der er sich bei Konzerten und beim Üben ins Unsichtbare zurückziehen konnte. Variation VI: Nischenprogramm im rasanten Konzertbetrieb
So war auf Facebook während der Fußball-Europameisterschaft 2016 in Frankreich ein Video zu sehen, das einen Organisten an der Orgel eines Gemeindezentrums zeigte, der Fußballspiele adhoc mit Orgelimprovisationen begleitete. Das Beispiel lohnt aus mehreren Gründen die Analyse. Denn fußballbegeisterte Bischöfe und Oberkirchenräte haben in den letzten Jahren immer wieder dafür gesorgt, dass Gemeinden zum public viewing einladen konnten, stets mit populistischen Interessen im Hintergrund. Verschämt wurde die Annahme geäußert, dass jemand, der zum public viewing in ein Gemeindehaus kommt, dann auch an einem Sonntag den Weg in den Gottesdienst findet. Dass Fußball und Gottesdienst wenig miteinander zu tun haben, dass es sich hier um peinlichste Anbiederung handelt, muss eigentlich nicht extra gesagt werden. Der besagte Organist führte dann das public viewing noch weiter, indem er den Fernsehton mit den Reporterphrasen abdrehte und stattdessen Orgel spielte, im Stil von Kinoorganisten, die in den zwanziger Jahren Stummfilme mit ihren Improvisationen begleiteten. Abgesehen davon, dass sich die Zuhörer die in der Regel banalen Kommentare des Fernsehreporters ersparen, ist aber nicht richtig zu sehen, wo der Nutzen dieser Unternehmung liegen soll. Das führt zur drögen Unternehmung des Orgelkonzerts, vorzugsweise der Matinee am Sonntagvormittag, wo die Gottesdienstbesucher dann gleich in den Bänken sitzen bleiben, um sich eine gute Stunde mit Orgelmusik anzuhören. Sehr oft folgt das Programm einem einfachen Schema: ein Stück aus der Zeit vor Bach, zwei Stücke von Bach selbst, ein romantisches oder klassisches Stück, ein Werk aus der Moderne, im einfallslosen Fall von Messiaen oder Duruflé, im besseren Fall von einem unbekannten Komponisten. Die klassischen Heroen der Orgelmusik sind Bach, dann wieder Bach, dann nochmals Bach, dann Sweelinck, Buxtehude, Reger, Liszt, Widor, Messiaen. Organisten, die sich mehr zutrauen, spielen eine Improvisation über eine Choralmelodie; wer richtig mutig ist, lässt das Publikum über den Choral abstimmen. Verwegene Organisten bieten an, über jede vom Publikum genannte Melodie, von der Nationalhymne bis zum Volkslied zu improvisieren. Solche Orgelkonzerte halten sich zäh in den Kirchenräumen, obwohl sie in ihrer Phantasielosigkeit nur ältere Kirchgänger, die aus Tradition und Gewohnheit in der Bank sitzenbleiben, überzeugen können. Wer als Organist dieses Desinteresse bemerkt hat, nimmt seine Zuflucht – wie erwähnt – zu Bearbeitungen. Man kann die Goldberg-Variationen auf der Orgel spielen, Vorspiele von Wagner-Opern und vieles andere mehr. Der gesamte musikalische Kanon der Gegenwart lässt sich für die Orgel bearbeiten, aber der Gewinn, der sich damit erzielen lässt, ist leider relativ billig: So hört sich das also auf dieser Steinmeyer-, Klais- oder sonstigen Orgel an. Wer das Werk eines großen Symphonieorchesters für Orgel bearbeitet, der erzeugt bestenfalls eine Simulation. Die Klavierbearbeitung diente Ende des 19. und Anfang des 20.Jahrhunderts noch dazu, große Werke bei Laien und Liebhabern bekannt zu machen. Sie sollten die Gelegenheit bekommen, sich vor dem Hören des Originals mit den Werken zu beschäftigen. Für die grassierenden Orgelbearbeitungen kann man das nicht sagen. Man bemerkt an diesen Orgelmatineen vor allen Dingen Routine, man dudelt bestimmte Werke einfach herunter und erzeugt damit nur gepflegte Langeweile, im besten Fall. Es fehlt das Risiko, und zwar unter Aspekten der Technik und der Virtuosität, aber auch unter Aspekten der musikalischen Fortentwicklung. Das Publikum wird nicht mehr gefordert, es dämmert nur noch im Halbschlaf. Die Auseinandersetzung mit der neuen Musik und der musikalischen Avantgarde unterbleibt. Genauso unterbleiben Risiko, Virtuosität, Provokation. Das Interesse der Zuhörer schwindet. Das heißt: Einer macht eine Ausnahme. Das ist der amerikanische Organist Cameron Carpenter, nicht zufällig genau derjenige, der mit seiner Touring Organ die Bewegung der Digitalklang-Orgel wesentlich befördert hat. Carpenter spielte zu Beginn seiner Karriere auch als Organist einer New Yorker Kirche. Seine Auftritte sind schrill, grell und überdreht, man hat seine Konzerte als Show und als leeres Virtuosentum abgetan, und dennoch bringen seine Improvisationen und Bearbeitungen, sein unorthodoxes Spiel ein ganz anderes und größeres Publikum in die Konzertsäle und Kirchen als es bei konventionellen Orgelmatineen und -konzerten der Fall ist. Sein Umgang mit dem Pedal, der am Stepptanzen geschult ist, zeigt eine Virtuosität, die Carpenters Auftritte an die Klaviervirtuosen des 19.Jahrhunderts erinnern lässt. Bei seinen Auftritten in Kirchen sind besondere Kameras auf Spieltisch und Pedal gerichtet, damit die Zuhörer seine aberwitzige Kraft und Technik auf einer Leinwand verfolgen können. Carpenters Spiel kann man für albern oder überdreht halten, man kann ihm hohles Virtuosentum vorwerfen. Dennoch erschließt er mit seinem Spiel der Orgel neue Räume und Dimensionen. Sein Virtuosentum ist geradezu darauf angelegt, das Orgelspiel aus seiner babylonischen Gefangenschaft in der Kirchenmusik zu befreien. In jedem Fall setzt er einen Kontrapunkt zur verbreiteten Orgelkonzert-Malaise. Die beamteten Organisten, die sich noch in der Kirchenmusik engagieren, sind ihm bisher jedenfalls eine Antwort schuldig geblieben. Variation VII: Kyrie und KantateWer anstatt Kirchenmusik Musik in der Kirche betreibt, der gibt als Kantor offen oder verdeckt die Beziehung zur Theologie auf. Er lässt sich von der Kirche nicht mehr in Frage stellen. Wer als Kantor seine Orgel- und Chorkonzerte für wichtiger hält als die Mitarbeit im Gottesdienst, sich nur noch um das erste und nicht mehr um das zweite kümmert, ohne das den Pfarrern, mit denen er zusammenarbeitet, zu kommunizieren, hat seine Aufgabe nicht richtig begriffen. Kirchenmusik rutscht dann als Selbstzweck in eine Position, für die sie eigentlich gar nicht gedacht war. Das Kantorenamt verkommt dann zu einer Art Selbstrechtfertigungsbetrieb, der zwar unablässig Musik erzeugt, aber theologisch und liturgisch nicht mehr an die eigentliche Aufgabe der Kirche zurückgebunden ist. Die Folgen sind vielfältig: die Weigerung, bei Kasualien die Orgel spielen, schlechte und schlampige liturgische Begleitung, fehlende Kommunikation mit den Pfarrern und anderes mehr. In der Regel führt das Programm „Musik in der Kirche“ auch zu einem fehlgeleiteten Professionalisierungsprozess, der das Niveau des Kammerchores zum Maßstab nimmt, zuerst den Gemeindegesang, der für Gottesdienste so wichtig ist, aus dünkelhaften Erwägungen zu vernachlässigen. Wer sich als Kantor dann auch noch zu schade ist, bei Trauungen oder anderen Kasualien die Orgel spielen, weil man sich den musikalischen Wünschen der Brautleute nicht aussetzen will, der muss sich dann auch nicht wundern, wenn à la longue in der Gemeinde niemand mehr singt. Die Brautpaare suchen sich dann ihre eigenen Sänger, die das gewünschte „Over the Rainbow“ singen, für deren Begleitung sich der Kantor zu schade ist. Viele Sänger wissen das mittlerweile und bringen lieber den eigenen Ghettoblaster zur Begleitung mit. Das Paradox besteht darin: Auf der einen Seite verachten viele Kantoren die Musikwünsche, die aus der Gemeinde kommen. Sie sind sich zu fein dafür, solche Stücke zu spielen. Auf der anderen Seite beschweren sie sich über verbreitete musikalische Unbildung in der Gemeinde. Dabei ist das nicht den Menschen vorzuwerfen, die nicht professionell Musik betreiben, sondern den Kantoren, die ihren kirchenmusikalischen Bildungsauftrag nicht mehr ernst nehmen. Solche Fehlentwicklungen, die in den letzten Jahren vermehrt zu beobachten sind, zeitigen paradoxe Folgen. Die Hinordnung der Kirchenmusik auf den Gottesdienst verschwindet langsam zugunsten einer Abteilung Musik in der Kirche, die irgendwann auch nicht mehr rechtfertigen kann, wieso sich Chöre auf das geistliche Repertoire beschränken und wieso ein Orgelkonzert ein Programm aufbietet, das mehr auf Virtuosentum als auf geistliche Erbauung ausgerichtet ist. Das Problematische am Programm „Musik in der Kirche“ liegt darin, dass in diesem Fall die Musik beliebig wird (anything goes!). Der Kirchenraum verkommt zum zufälligen Ort, dessen Gemeinde zwar Musik in beträchtlichem Ausmaß finanziert, aber dafür eine zunehmend geringere kulturelle und musikalisch-theologische Gegenleistung enthält. In der Regel scheuen sich die kirchlichen Beamtenapparate, solche Konflikte zu thematisieren, weil man nicht will, dass die noch sehr gut besuchten Oratorienkonzerte gefährdet werden. In diesem Fall verhindert der musikalische Erfolg die theologische Auseinandersetzung. Wer in Gemeinden, wo solches passiert, eine Bachkantate im Gottesdienst erlebt, der erlebt Musik und Liturgie als Fremdkörper, die sich gegenseitig abstoßen. Die Musik ist in keiner Weise auf die Liturgie, die Predigt und den Gottesdienst bezogen. Im Grunde genommen könnte man sich das auch ersparen, dass der Kantor seine Freunde zu gut bezahlten Muggen auf die Empore bittet. Erfreulicherweise ist das auch anders zu erleben. In der Neustädter Hof- und Stadtkirche in Hannover findet monatlich an einem Sonntagnachmittag ein Kantatengottesdienst statt, bei dem ein Chor und ein kleines Orchester, das historisch informiert spielt, eine Bachkantate aufführt. Die Reihe heißt „Bach um Fünf“[8]. Die Predigt ist, wenn möglich, auf den Bibeltext bezogen, der auch der Kantate zugrunde liegt[9]. Das eröffnet die Möglichkeit, die Entstehungsgeschichte der Kantate mit einzubeziehen. Man kann das Libretto der Kantate als Ausdruck der Wirkungsgeschichte des Bibeltextes verstehen. Man kann die nicht zu leugnenden Grenzen, aber auch die besonderen Erkenntnisgewinne der barocken Texte in die Predigt hineinnehmen, um der Gemeinde den Bibel- und Kantatentext gleichermaßen nahezubringen. Denn dass der Text der Bachkantate gesungen und nicht gesprochen wird, macht ihn ja um keinen Deut theologisch verständlicher, er bedarf wie alle alten Texte der Hermeneutik und auch der Auslegung. Variation VIII: Historisch informierte MassenchöreBachs Passionen galten ja Zeitgenossen als viel zu theatralisch, man meinte, sie würden vom Wort des Evangeliums ablenken. Heute ist eine gegenteilige Bewegung zu beobachten. Die klassischen Oratorienkonzerte, die in der Kirche stattfinden, wandern aus auf die Bühne oder gleich in die Oper. Händels „Saul“[10] war jüngst in Glyndebourne in einer Inszenierung zu sehen, der Regisseur Peter Sellars hat mit den Berliner Philharmonikern die Matthäus- und die Johannespassion in Berlin und Baden-Baden halbszenisch auf die Bühne gebracht. In den Oratorienkonzerten der Kirchen sind diese Neuentwicklungen noch nicht richtig angekommen. Diese haben sich zum Gral protestantischer Bürgerreligion entwickelt, die an ihrem eigenen Erfolg zu ersticken drohen. Das Oratorienkonzert wird inszeniert als die Vollversammlung der protestantischen Bildungsbürger, es ist zum musikalischen Gottesdienstersatz geworden: wenn schon nicht die Christmette am Heiligen Abend, dann doch wenigstens die ersten drei Kantaten des Weihnachtsoratoriums. Das Repertoire dieser Konzerte ist erschreckend klein: Bachs Passionen, das Weihnachtsoratorium und die h-Moll-Messe, das Requiem von Mozart, Verdi und Brahms, Mendelssohns Elias und wenige mehr. Schon kleine Abweichungen von diesem klassischen Kanon wie Frank Martins „Golgotha“ oder Carl Loewes „Hiob“ kosten Zuschauer. Dagegen sind die Standardwerke totgespielt, ihnen ist nichts neues, keine neue musikalische Interpretation, kein interessanter kulturgeschichtlicher oder gar theologischer Zusammenhang mehr abzugewinnen. Das Konzert vermittelt keine neue musikalische Erfahrung mehr, statt dessen wird es zum Ritual der Wiederholung, das die schwindende Strahlkraft des Protestantismus, der im Theologischen oder im Gottesdienst nicht mehr wirkt, durch eine Massenveranstaltung beschwören soll. An der heiligen Kuh des Oratorienkonzerts darf derzeit niemand Kritik üben. Dabei wäre bei den professionellen Ensembles nicht nur alter Musik einiges zu lernen. Das Paradigma historischer Aufführungspraxis hat sich auch in der Kirchenmusik durchgesetzt, aber die dabei eingesetzte Formel des „historisch informierten“ Spiels bleibt schwammig, mit gutem Grund, denn sie muss an die aktuellen Bedingungen angepasst werden. Historisch informiert spielen in der Regel nur die Orchestermusiker, während die riesigen, sopranlastigen Chöre keineswegs historischer Praxis entsprechen. Man kann in Chorproben heftige Auseinandersetzungen um „italienische“ oder „deutsche“ Aussprache des Lateinischen hören, die dann häufig diejenigen gewinnen, die sagen: Das haben wir schon immer so gemacht. Wer immer so weiter macht wie bisher, der geht kein Risiko ein und der wird irgendwann untergehen. Musikalisch hat man sich auf den mainstream der historisch informierten Aufführungspraxis geeinigt, und man ist dabei, dieses Stichwort wieder zum Dogma zu verabsolutieren. Was historisch informiert heißt, das bestimmen Kantoren und Dirigenten – und legen dabei den Begriff jeweils zugunsten der lokalen Verhältnisse aus. Die theologische Auseinandersetzung mit den Werken ist in die Programmhefte ausgewandert und findet auch dort nur noch in Rudimenten statt. Sie sind zum Ersatz für die Predigt geworden. Die Texte bewegen sich in stets derselben Zitatkultur. Allerdings lesen die meisten Konzertbesucher diese Artikel nicht mehr. Insgesamt ist festzustellen, dass die großen Oratorienkonzerte die Tendenz zu einer gewissen Verbürgerlichung zeigen: Kantoren treten plötzlich im Frack auf, Applaus des Publikums ist auch bei Passionsmusiken ganz selbstverständlich geworden, schon Wochen vor dem Konzert stören riesige Podeste für die Chöre die liturgischen Vollzüge des Gottesdienstes im Altarbereich. Die Chöre stehen auch nicht mehr auf den Emporen, sondern sind heruntergezogen in den Altarraum. Dirigent, Orchester und Chor sollen beim Musizieren zu sehen sein. Zu all dem habe ich an anderer Stelle bereits mehr gesagt.[11] Diese Entwicklungen kann man nun im Wesentlichen als unbedenklich bezeichnen, wenn sie nicht verbunden wäre mit einer gleichzeitigen Entfremdung vom kirchlichen und – was noch wichtiger ist – theologischen Kontext. In den Programmheften zu den Oratorienkonzerten herrschen Hans Blumenberg und Theodor W. Adorno[12]. Bach muss gegen seine Liebhaber verteidigt werden, also die Kantoren als Kenner und das Publikum als dilettierende Ignoranten. Blumenberg wird als Kronzeuge für eine Distanzierung der Passionen aus dem kirchlichen Kontext gelesen. Einmal abgesehen davon, ob diese Kantoren-Rezeption den beiden Philosophen gerecht wird, spürbar ist eine Tendenz sich von Gemeinde, theologischen Aussagen und biblischen Erwägungen zu distanzieren, damit das Oratorienkonzert nicht an der Kritik partizipiert, die Gottesdienst und Kirche gelten. Die Gemeinden werden damit à la longue zum Geldgeber reduziert, dem man jede Kompetenz in theologischen Fragen abspricht. Damit will die Kirchenmusik nicht mehr behelligt werden, während sie die jährliche finanzielle Unterstützung gerne annimmt. Traurig an diesen Entwicklungen ist, dass viele Kantoren nicht den Mut besitzen, Neues zu wagen und das geneigte Publikum mit neuer Musik, neuen theologischen Themen und neuer Aufführungspraxis zu konfrontieren. Die vielfach gegründeten Kammerchöre, die nun neben die „großen“ Oratorienchöre treten, könnten das Spielbein sein, um hier das kirchenmusikalische Repertoire zu erweitern. Aber auch hier beschränken sich viele darauf, zuerst einmal das überkommene Kammerchor-Repertoire zu erarbeiten. Variation IX: Heiliger Johann Sebastian, bete für uns!
Aufklären kann das nur eine konsequente Historisierung von Bachs Leben[13] und Werk. Denn die protestantische Bach-Bewunderung deckt ja auch einiges zu: die Konflikte des Komponisten mit Presbyterien, Stadträten und Pfarrern, seine Klage über mangelnde finanzielle Unterstützung und schlechte musikalische Ausstattung der Stellen. Viele der barocken Kantatentexte sind nur vor ihrem historischen Hintergrund zu verstehen und lassen sich nicht so ohne weiteres aktualisieren. Wenn Bach sein Luthertum so wichtig war, dann fällt doch auf, dass eines der Hauptwerke, nämlich die h-Moll-Messe gerade dem katholischen Gottesdienst galt. Und Bach hat neben den kirchlichen Werken – Kantaten und Passionen – auch eine ganze Reihe von säkularer Musik geschrieben.
Variation X: Der gute Hirte der MusikbegeistertenNach diesen Reflexionen über den Schutzheiligen der protestantischen Kirchenmusik ist nach der veränderten Rolle der Kirchenmusiker zu fragen. Bisher wurden im Bereich der Kirchenmusik Prozesse der Differenzierung und Spezialisierung sowie eine zunehmende Ablösung von kirchlichen Bindungen diagnostiziert. Damit verändert sich auch die Aufgabe von Kantoren. Sie verwandeln sich von Spezialisten in den Einzeldisziplinen (Organist, Chorleiter, Dirigent) in Manager, die vor allem die Aufgabe haben, das Miteinander der kirchenmusikalischen Sparten zu organisieren. Man kann sich als Kantor dieser Vermittlungs- und Kommunikationsaufgabe entziehen und sich autistisch auf die Orgelbank zurückziehen. Man kümmert sich nicht mehr um das, was über die eigenen besonderen Interessen hinausgeht. Kommentare zum Gemeindeleben müssen die anderen Mitarbeiter mühsam aus den allgegenwärtigen Orgelimprovisationen heraushören. Planungen und Entwicklungen werden nicht weiter kommuniziert. Außer den kirchenmusikalischen Lieblingsfeldern des Kantors verkümmern mit der Zeit alle übrigen Bereiche. Andere stellen sich der Kommunikations- und Organisationsaufgabe, bezahlen dafür aber den Preis, dass diese Aufgabe immer mehr Zeit auffrisst. Der Kantor kann nicht überall präsent und beteiligt sein, kann nicht überall Initiativen und Ideen einbringen. Um das kirchenmusikalische Leben einer Gemeinde zu ordnen, sind Schwerpunktsetzungen nötig und nach meiner Überzeugung auch eine Vision, welche Richtung eingeschlagen werden soll. Niemand muss diese Entwicklung als Schwierigkeit oder Hindernis begreifen, er kann sie auch als spannende und sinnvolle Gestaltungsaufgabe sehen. Problematisch wird es nur, wenn ein Kantor Kirchenmusik nur als Arbeitsfeld zur Entfaltung seiner eigenen Talente begreift. Ähnlichkeiten mit den Problemen und Schwierigkeiten, denen sich Pfarrer bei ihrem Selbstverständnis und in ihrer Gemeindearbeit gegenübersehen, sind rein zufällig. Ich sehe das allerdings als eine zusätzliche Chance, gemeinsam mit Pfarrern und Gemeinden eine Kirchenmusik zu entwickeln, die die Kooperation mit der Gemeindearbeit im engeren Sinne neu befruchtet und belebt und sich nicht weiter in die splendid isolation auf der Orgelbank und in den Probenraum für den Chor zurückzieht. Die historische bewährte Allianz zwischen Kirchenmusik und Theologie ist noch nicht an ihr Ende gelangt, sie bedarf gegenwärtig nur, wie vieles andere auch, der Reform und der Erneuerung. Ich würde vier Eckpunkte nennen:
Dazu kommt nach meiner Auffassung ein obligatorischer Schwerpunkt bei der Jugend- und Nachwuchsarbeit. Dieser scheint mir so wichtig, dass ihm eine eigene Variation gewidmet ist. Variation XI: Die Saat der SängerknabenAm schönsten wäre es, wenn alle Gemeindeglieder singen oder ein Instrument spielen würden. Aber es muss auch Menschen geben, die Konzerte besuchen und zuhören. Ein Professor für Dirigieren erzählte mir einmal, seine Schulmusikstudenten wüssten in großer Zahl nicht mehr, welche biblische Geschichte der Johannes- oder Matthäuspassion Bachs zugrunde liegen würde. Sie kennen, so sagte er, auch die Choräle nicht mehr. Dieser erschreckende Mangel hat keineswegs mit Glauben und Theologie zu tun, er ist schlicht ein Defizit an Kultur und kulturellem Verständnis.
Auch aus diesem Grund legen prominente kleinere Chorensembles wie Chanticleer[14] oder Voces8[15] einen Schwerpunkt bei der Nachwuchsarbeit. Wenn solche Arbeit vor Ort und in den Kirchengemeinden geleistet wird, ist das nur umso mehr zu begrüßen. Variation XII (Minore): Druckstellen der klerikalen UmarmungVon den kirchenmusikalischen Versuchen, sich von der Kirche unabhängig zu machen, war bereits die Rede, so als ab man das vermeintlich negative Image der Kirche abstreifen und sich allein auf musikalische Professionalität konzentrieren könne. Das scheint aber das klassische Beispiel für das Sägen auf dem Ast, auf dem man es sich schön bequem gemacht hat. Die umgekehrten Umarmungsversuche fallen jedoch nicht weniger merkwürdig aus. Den kirchlichen Bürokratien gilt alles als erstrebenswert und wichtig, was möglichst viele Menschen beteiligt, daher die Vorliebe für Luther-Musicals mit riesigen Chören in Hallen, die sonst für die Spiele der Eishockey-Bundesliga genutzt werden. Die EKD versucht in ihrem Text „Kirche klingt“[16], schlichtweg die gesamte Kirchenmusik zu umarmen, A-, B- und C-Kantoren, Chöre, Gospel- und Posaunengruppen, Kinderchorarbeit, Musicals, Bands, kirchliche Singer-Songwriter, Rapper. Erlaubt ist, was gefällt und Besucher in Kirche oder Gemeindezentrum bringt. Die klerikale Verwaltung umarmt alle, für die sie einen Aktendeckel angelegt hat. „Eine vielgestaltige Kirchenmusik ist als ein wesentliches Kennzeichen der evangelischen Kirche in ihrer missionarischen und kulturellen Bedeutung für die Zukunft kaum zu überschätzen. Gleichwohl steht die Kirchenmusik wie die Kirche insgesamt vor erheblichen Konzentrations- und Umwandlungsprozessen.“[17] Wir finden alles gut, aber wir haben kein Geld mehr. Diese Grundthese wird dann aufgelöst in die Forderungen: Qualität wollen, Pluralität zulassen, Traditionen pflegen, Gemeinschaft stärken, Menschen einladen.[18] Das ist so allgemein formuliert, das könnte auch im Grundwerteprogramm einer beliebigen Partei stehen.
Nötig aber wären Experimentieren und Provozieren, der erneuerte Dialog zwischen Kirchenmusik und Theologie, die Frage nach der gemeinsamen Praxis von Theologie und Musik in Liturgie und Gottesdienst. Und das sollte über die rein funktionale Wahrnehmung der Kirchenmusik zum Füllen der Gottesdiensträume bei Kantaten und Oratorien hinausgehen. Auch der Ratsvorsitzende Bedford-Strohm nahm sich des Themas der Kirchenmusik bei einem Gottesdienst in Stuttgart im Juli 2016 an[19]. Er predigte unter dem Eindruck der Attentate in München und anderswo in den Tagen davor und sagte dann: „2,3 Millionen Menschen in ganz Deutschland singen in Chören, die allermeisten davon in Kirchenchören. Sie singen aus Freude und gewinnen daraus Kraft für den Alltag. Ob Gospel, Hymnen, Paul Gerhardt oder Johann Sebastian Bach: das Singen tut der Seele gut. Und es öffnet unser Herz für Gott und den Anderen.“ Und dann fuhr er fort: „Und wie die Choräle und Songs nur schön klingen, wenn die unterschiedlichen Stimmen zusammenklingen, so wird unser gemeinsames Singen zum Beispiel für eine Welt, in der sich die Menschen gerade in ihrer Verschiedenheit annehmen und achten und vielleicht ja sogar lieben.“ Vielleicht sogar lieben? Nun räume ich gern ein, dass eine Predigt nicht alles bis in die Tiefe durchdringen und differenzieren kann. Dennoch ist mir diese Seid-umschlungen-Millionen-Metaphorik zu einfach. Musik, auch Kirchenmusik geht nicht in ihrer gemeinschaftsstiftenden Funktion auf. Sie ist keineswegs nur dafür Gleichnis. Sie ist auch ganz anderes. Coda: Dissonanzen bei den himmlischen Chören. Tempo primoWer über Musik nachdenkt, vergisst darüber oft das Hören. Kirchenmusik geht nicht auf im Nachdenken über ihr Verhältnis zum großen Musikbetrieb, über ihre Beziehung zu Theologie und Gemeinde, zu den Geldgebern, zu den Konzertbesuchern, über ihre institutionellen Bindungen. Wer etwas über Kirchenmusik erfahren will, muss sich Konzerte und Gottesdienste anhören – und daraus Schlüsse ziehen.
Eine solche Kirchenmusik, die Neues wagt, braucht für ihre Reflexion Partner auf Augenhöhe. Diese werden nur in der Theologie zu finden sein, nicht bei denen, die sich um frommes Marketing bemühen oder nach Gottesdienstquoten schielen. Ohne Gesprächspartner und ohne Verbündete wird sich Kirchenmusik innerhalb der Kirche isolieren. Das gilt zum Beispiel für die anstehende Reform des evangelischen Gesangbuchs, die nun in Gang zu kommen scheint.[20] „Sollt ich meinem Gott nicht singen?“[21] – Selbstverständlich! Aber man sollte sich dann auch Gedanken machen, welche Töne, welche Melodien und Texte, Harmonien und Dissonanzen man in den Himmel steigen lässt. Anmerkungen
|
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/103/wv26.htm |
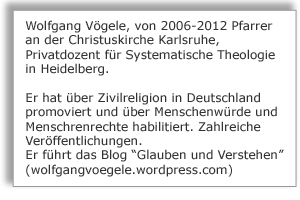 Goldberg-Variationen, Diabelli-Variationen, Paganini-Variationen: Einige der größten Werke der Musikgeschichte verarbeiten ein einfaches Thema in einer Vielzahl von Veränderungen. Auch in einer klassischen Klaviersonate von Beethoven oder Schubert steht am Anfang ein Thema, zu dem später noch ein zweites tritt. Dieses Thema wird in vielen Varianten durchgespielt, bis der Komponist am Ende in der Reprise auf die ursprüngliche Melodie zurückkommt.
Goldberg-Variationen, Diabelli-Variationen, Paganini-Variationen: Einige der größten Werke der Musikgeschichte verarbeiten ein einfaches Thema in einer Vielzahl von Veränderungen. Auch in einer klassischen Klaviersonate von Beethoven oder Schubert steht am Anfang ein Thema, zu dem später noch ein zweites tritt. Dieses Thema wird in vielen Varianten durchgespielt, bis der Komponist am Ende in der Reprise auf die ursprüngliche Melodie zurückkommt. Kirchenmusik ist unübersichtlicher geworden in den letzten drei, vier Jahrzehnten, sie verzweigt sich, fließt in immer neue Nischen; sie hat sich an den musikalischen Stilen und (Jugend-)Kulturen der Gegenwart angedockt, von Rap und Gospel über Jazz und Folk zu Hiphop. Choräle sind seltener geworden. Der alte Dreiklang von Orgel, Oratorium und Liturgie ist explodiert in eine Vielfalt von Stilen, Melodien und Texten. Kirchenmusik ist nicht mehr in Schubladen, nur noch in Labyrinthen zu denken. Sie hat viele Entwicklungen der musikalischen Kultur, die ihrerseits auch vielfältiger geworden ist, nachvollzogen: historisch informierte Aufführungspraxis, Pop- und Musical-Seligkeit, Massenaufführungen und Gospelmusik. Ihre skeptische Abneigung gegen avantgardistische neue Musik hat sie nicht überwinden können. Sie ist offener geworden gegenüber sozialen Funktionalisierungen, was ein ambivalenter, zu untersuchender Prozess ist.
Kirchenmusik ist unübersichtlicher geworden in den letzten drei, vier Jahrzehnten, sie verzweigt sich, fließt in immer neue Nischen; sie hat sich an den musikalischen Stilen und (Jugend-)Kulturen der Gegenwart angedockt, von Rap und Gospel über Jazz und Folk zu Hiphop. Choräle sind seltener geworden. Der alte Dreiklang von Orgel, Oratorium und Liturgie ist explodiert in eine Vielfalt von Stilen, Melodien und Texten. Kirchenmusik ist nicht mehr in Schubladen, nur noch in Labyrinthen zu denken. Sie hat viele Entwicklungen der musikalischen Kultur, die ihrerseits auch vielfältiger geworden ist, nachvollzogen: historisch informierte Aufführungspraxis, Pop- und Musical-Seligkeit, Massenaufführungen und Gospelmusik. Ihre skeptische Abneigung gegen avantgardistische neue Musik hat sie nicht überwinden können. Sie ist offener geworden gegenüber sozialen Funktionalisierungen, was ein ambivalenter, zu untersuchender Prozess ist. Gospel ist engagierte Musik, nicht nur für die Aufführenden, auch für die Zuschauer. Diese Popularität verträgt keine schrägen Harmonien oder Dissonanzen, die alte Verwandtschaft mit dem Blues wurde längst abgestreift. Manchmal wirkt das alles ein wenig bieder. Dennoch gibt es hervorragende Gospelchöre, vor allem wenn sie die amerikanische Acapella-Tradtion des Barbershop-Singens aufnehmen. Bei Take Six klingt Gospel schon ganz anders als in der Variante mit drei Dur-Akkorden.
Gospel ist engagierte Musik, nicht nur für die Aufführenden, auch für die Zuschauer. Diese Popularität verträgt keine schrägen Harmonien oder Dissonanzen, die alte Verwandtschaft mit dem Blues wurde längst abgestreift. Manchmal wirkt das alles ein wenig bieder. Dennoch gibt es hervorragende Gospelchöre, vor allem wenn sie die amerikanische Acapella-Tradtion des Barbershop-Singens aufnehmen. Bei Take Six klingt Gospel schon ganz anders als in der Variante mit drei Dur-Akkorden. Neben der Kantorei steht die Orgel im Zentrum der protestantischen Kirchenmusik. Noch nicht so veraltet ist die Meinung, dass ein Sakrileg begehe, wer einen Gottesdienst mit Gitarren-, Klavier-, Bandbegleitung feiere. Als ich vor Jahren als Gefängnisseelsorger arbeitete, stand im Gottesdienstraum des Untersuchungsgefängnisses, in dem ich tätig war, ein quietschendes Harmonium. Das mindestens, so die übereinstimmende Meinung von Häftlingen und Vollzugsbeamten, musste im Gottesdienst gespielt werden, als unvollkommener Ersatz einer Orgel. Weil die Orgel so wichtig ist, sind ihr zwei Variationen gewidmet, eine über das Bauen, eine zweite über das Spielen. In keinem Bereich der Kirchenmusik vollziehen sich derzeit auch so starke Veränderungen.
Neben der Kantorei steht die Orgel im Zentrum der protestantischen Kirchenmusik. Noch nicht so veraltet ist die Meinung, dass ein Sakrileg begehe, wer einen Gottesdienst mit Gitarren-, Klavier-, Bandbegleitung feiere. Als ich vor Jahren als Gefängnisseelsorger arbeitete, stand im Gottesdienstraum des Untersuchungsgefängnisses, in dem ich tätig war, ein quietschendes Harmonium. Das mindestens, so die übereinstimmende Meinung von Häftlingen und Vollzugsbeamten, musste im Gottesdienst gespielt werden, als unvollkommener Ersatz einer Orgel. Weil die Orgel so wichtig ist, sind ihr zwei Variationen gewidmet, eine über das Bauen, eine zweite über das Spielen. In keinem Bereich der Kirchenmusik vollziehen sich derzeit auch so starke Veränderungen. Orgelbaufirmen besitzen ihren eigenen handwerklichen Charme, denn sie arbeiten im Grunde in industrialisierter Zeit als Manufaktur
Orgelbaufirmen besitzen ihren eigenen handwerklichen Charme, denn sie arbeiten im Grunde in industrialisierter Zeit als Manufaktur Der Bonner Orgelbauer Philipp Klais betont in Interviews immer wieder, dass das Holz für seine Orgeln grundsätzlich nur bei abnehmendem Mond geschlagen wird, weil es dann weniger Wasser enthalte. Aber wie es sich mit solchen Details auch verhalten mag, den Betrachter wie den Zuhörer überwältigt die Menge der Holz- und Metallpfeifen ebenso wie der Spieltisch, der mit seinen vielen Schaltern, Tasten und Pedalen dem Cockpit eines mittelgroßen Passagierflugzeugs gleicht, oder wie die komplizierte Mechanik, welche die Verbindung zwischen Tastatur und Pfeifen besorgt. Dazu kommt die schiere Größe von Orgeln, die sie einmalig, aber eben auch unverrückbar machen. Wer sie transportieren will, braucht mehrere Lastwagen. Virtuosen der Geige oder Piccoloflöte haben es einfacher.
Der Bonner Orgelbauer Philipp Klais betont in Interviews immer wieder, dass das Holz für seine Orgeln grundsätzlich nur bei abnehmendem Mond geschlagen wird, weil es dann weniger Wasser enthalte. Aber wie es sich mit solchen Details auch verhalten mag, den Betrachter wie den Zuhörer überwältigt die Menge der Holz- und Metallpfeifen ebenso wie der Spieltisch, der mit seinen vielen Schaltern, Tasten und Pedalen dem Cockpit eines mittelgroßen Passagierflugzeugs gleicht, oder wie die komplizierte Mechanik, welche die Verbindung zwischen Tastatur und Pfeifen besorgt. Dazu kommt die schiere Größe von Orgeln, die sie einmalig, aber eben auch unverrückbar machen. Wer sie transportieren will, braucht mehrere Lastwagen. Virtuosen der Geige oder Piccoloflöte haben es einfacher. Die elektronische Klangerzeugung vergrößert noch einmal die Möglichkeiten, Klangfarben wiederzugeben. Sie ermöglicht es, kleinere und vor allem auch billigere Orgeln zu bauen, die durch neue Möglichkeiten der Mikrofon- und Computertechnik den alten, mechanischen Orgeln im Klang zunehmend ähnlicher werden. Eine solche elektronische Orgel kann wie eine mechanische Spieldose, wie eine Jahrmarktsorgel, wie eine Kirchenorgel klingen. Sie vergrößert ein weiteres Mal die Möglichkeiten der Klangvielfalt.
Die elektronische Klangerzeugung vergrößert noch einmal die Möglichkeiten, Klangfarben wiederzugeben. Sie ermöglicht es, kleinere und vor allem auch billigere Orgeln zu bauen, die durch neue Möglichkeiten der Mikrofon- und Computertechnik den alten, mechanischen Orgeln im Klang zunehmend ähnlicher werden. Eine solche elektronische Orgel kann wie eine mechanische Spieldose, wie eine Jahrmarktsorgel, wie eine Kirchenorgel klingen. Sie vergrößert ein weiteres Mal die Möglichkeiten der Klangvielfalt. Damit ist ein alter Konflikt wieder aufgerufen, der beileibe nicht nur Orgeln betrifft, nämlich der zwischen originalem, mechanisch erzeugtem und digital imitiertem Klang. Man muss kein Prophet sein, um zu sagen, auf welcher Seite die Lobby der Orgelbauer steht. Aber man kommt nicht umhin zu konstatieren, dass auf dem Gebiet des Orgelbaus im Moment vieles in Bewegung gerät. Trotzdem gilt: Hierzulande findet man elektronische Orgeln minderer Qualität nur in Friedhofskapellen. In der Kirche selbst behauptet nach wie vor die mechanische Pfeifenorgel ihren Platz.
Damit ist ein alter Konflikt wieder aufgerufen, der beileibe nicht nur Orgeln betrifft, nämlich der zwischen originalem, mechanisch erzeugtem und digital imitiertem Klang. Man muss kein Prophet sein, um zu sagen, auf welcher Seite die Lobby der Orgelbauer steht. Aber man kommt nicht umhin zu konstatieren, dass auf dem Gebiet des Orgelbaus im Moment vieles in Bewegung gerät. Trotzdem gilt: Hierzulande findet man elektronische Orgeln minderer Qualität nur in Friedhofskapellen. In der Kirche selbst behauptet nach wie vor die mechanische Pfeifenorgel ihren Platz. Die Konzertbesucher wollen seine Finger- und Fußfertigkeit bewundern. Was von den Wiesbadenern als Kooperation gedacht war, verwandelt sich plötzlich in eine Rivalität zwischen Liturgie und Konzert.
Die Konzertbesucher wollen seine Finger- und Fußfertigkeit bewundern. Was von den Wiesbadenern als Kooperation gedacht war, verwandelt sich plötzlich in eine Rivalität zwischen Liturgie und Konzert. Auf der einen Seite haftet an der Orgel die Faszination der wunderbaren Spieldose, der immer neue, zuvor nicht gekannte Klänge entlockt werden können, auf der anderen Seite gelten Orgelkonzerte als langweilig und verschnarcht. Vielen Musikinteressierten gilt das Orgelkonzert als Inbegriff klerikal-musikalischer Bräsigkeit. Das haben mittlerweile auch die Organisten selbst gemerkt.
Auf der einen Seite haftet an der Orgel die Faszination der wunderbaren Spieldose, der immer neue, zuvor nicht gekannte Klänge entlockt werden können, auf der anderen Seite gelten Orgelkonzerte als langweilig und verschnarcht. Vielen Musikinteressierten gilt das Orgelkonzert als Inbegriff klerikal-musikalischer Bräsigkeit. Das haben mittlerweile auch die Organisten selbst gemerkt. Während die Kirchenmusik sich mit Hilfe von Blumenberg und Adorno von der Kirche distanziert, geht die protestantische Kirche genau den umgekehrten Weg. Sie vereinnahmt Johann Sebastian Bach, ihren Hauskomponisten als fünften Evangelisten. Man tut so, als habe der Protestantismus Bachs Musik und die Werke anderer bedeutender evangelischer Komponisten wie Schütz und anderen erst hervorgebracht. Dabei läuft die kirchliche Bach-Bewunderung parallel mit der musikalischen Bach-Verehrung, die ja völlig zu Recht die überragende Qualität, Komplexität und Vielfalt der Werke betont. Aber das kirchliche Lob des Komponisten hat dabei etwas Zweideutiges, weil es Hintergedanken verfolgt.
Während die Kirchenmusik sich mit Hilfe von Blumenberg und Adorno von der Kirche distanziert, geht die protestantische Kirche genau den umgekehrten Weg. Sie vereinnahmt Johann Sebastian Bach, ihren Hauskomponisten als fünften Evangelisten. Man tut so, als habe der Protestantismus Bachs Musik und die Werke anderer bedeutender evangelischer Komponisten wie Schütz und anderen erst hervorgebracht. Dabei läuft die kirchliche Bach-Bewunderung parallel mit der musikalischen Bach-Verehrung, die ja völlig zu Recht die überragende Qualität, Komplexität und Vielfalt der Werke betont. Aber das kirchliche Lob des Komponisten hat dabei etwas Zweideutiges, weil es Hintergedanken verfolgt. Dagegen hilft nur eine doppelte Strategie: zum einen die konsequente Historisierung, die Einordnung der Werke in ihren musikhistorischen und damaligen gemeindetheologischen Kontext, zum anderen die aktuelle Auseinandersetzung mit den von Bach vertonten Texten, vor allem der Kantaten. Bei den antijudaistischen Passagen der Johannespassion hat diese Auseinandersetzung schon begonnen. Sie wäre auf weitere Punkte auszudehnen. Würde man diese Auseinandersetzung ernst nehmen, würde die Aufführung Bachscher Werke zur musikalischen und theologischen Auseinandersetzung mit barocker Musik und ihren Aufführungsgepflogenheiten. Das könnte ein Vehikel sein, Theologie und Kirchenmusik wieder näher in Kontakt zu bringen.
Dagegen hilft nur eine doppelte Strategie: zum einen die konsequente Historisierung, die Einordnung der Werke in ihren musikhistorischen und damaligen gemeindetheologischen Kontext, zum anderen die aktuelle Auseinandersetzung mit den von Bach vertonten Texten, vor allem der Kantaten. Bei den antijudaistischen Passagen der Johannespassion hat diese Auseinandersetzung schon begonnen. Sie wäre auf weitere Punkte auszudehnen. Würde man diese Auseinandersetzung ernst nehmen, würde die Aufführung Bachscher Werke zur musikalischen und theologischen Auseinandersetzung mit barocker Musik und ihren Aufführungsgepflogenheiten. Das könnte ein Vehikel sein, Theologie und Kirchenmusik wieder näher in Kontakt zu bringen. Die traditionell protestantische Vision von der Kirchenmusik als gleichschenkligem Dreieck zwischen Gottesdienst und Liturgie, Oratorium und Chor sowie der Orgelmusik, der sich Musiker wie zum Beispiel der jüngst verstorbene Kantor Rolf Schweitzer in Pforzheim jahrzehntelang verpflichtet fühlten, gerät zunehmend aus dem Gleichgewicht. Die Berufsaufgaben sind nicht mehr selbstverständlich festgelegt, der Kantor muss mit Blick auf Gemeinde und Pfarrer eine begründete Auswahl treffen. Aus der Pflicht, einfach bestimmte Aufgabe zu erfüllen, wird ein Zwang zu Gestaltung und Organisation.
Die traditionell protestantische Vision von der Kirchenmusik als gleichschenkligem Dreieck zwischen Gottesdienst und Liturgie, Oratorium und Chor sowie der Orgelmusik, der sich Musiker wie zum Beispiel der jüngst verstorbene Kantor Rolf Schweitzer in Pforzheim jahrzehntelang verpflichtet fühlten, gerät zunehmend aus dem Gleichgewicht. Die Berufsaufgaben sind nicht mehr selbstverständlich festgelegt, der Kantor muss mit Blick auf Gemeinde und Pfarrer eine begründete Auswahl treffen. Aus der Pflicht, einfach bestimmte Aufgabe zu erfüllen, wird ein Zwang zu Gestaltung und Organisation. Dennoch, solch eine verwaschene Allgemeinheit bleibt unbefriedigend, sie ist typisch für kirchenamtliche Dokumente, was sie aber in keiner Weise geeigneter macht, kirchenmusikalisches Profil zu schärfen. Man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass sich bei den anstehenden mittel- und langfristigen Kürzungsprozessen die etablierten kirchenmusikalischen Institutionen durchsetzen werden.
Dennoch, solch eine verwaschene Allgemeinheit bleibt unbefriedigend, sie ist typisch für kirchenamtliche Dokumente, was sie aber in keiner Weise geeigneter macht, kirchenmusikalisches Profil zu schärfen. Man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass sich bei den anstehenden mittel- und langfristigen Kürzungsprozessen die etablierten kirchenmusikalischen Institutionen durchsetzen werden. Selbstverständlich spiegelt sich die Vielfalt gesellschaftlichen Musikgebrauchs spiegelt auch in der Kirche, wie könnte das anders sein. Und das ist kein Prozess, der in irgendeiner Weise individuell oder institutionell zu beeinflussen wäre. Es besteht ein Prozess der Osmose zwischen Kirchenmusik und unterschiedlichen sozialen Musikkulturen. Es scheint mir nicht möglich vorherzusagen oder gar zu steuern, wohin sich diese Musikkulturen bewegen und wie sie Kirchenmusik beeinflussen. Und trotzdem hat jeder Kirchenmusiker für sich die Möglichkeit, seine eigenen Akzente zu setzen.
Selbstverständlich spiegelt sich die Vielfalt gesellschaftlichen Musikgebrauchs spiegelt auch in der Kirche, wie könnte das anders sein. Und das ist kein Prozess, der in irgendeiner Weise individuell oder institutionell zu beeinflussen wäre. Es besteht ein Prozess der Osmose zwischen Kirchenmusik und unterschiedlichen sozialen Musikkulturen. Es scheint mir nicht möglich vorherzusagen oder gar zu steuern, wohin sich diese Musikkulturen bewegen und wie sie Kirchenmusik beeinflussen. Und trotzdem hat jeder Kirchenmusiker für sich die Möglichkeit, seine eigenen Akzente zu setzen. Er kann eigene Akzente setzen – oder das Konventionelle und Traditionelle immergleich wiederholen. Musik zielt nicht nur auf Harmonie und Gemeinschaft, auf das: Seid umschlungen, fromme Millionen!, sondern eben auch auf Reflexion, Provokation, Wagnis, Anregung, ja sogar Verstörung. Das muss auch möglich sein, ich würde sogar sagen, das ist gegenwärtig dringend notwendig. Kirchenmusik ohne Provokation und neue Wege kommt mir vor wie Amtskirche ohne Theologie.
Er kann eigene Akzente setzen – oder das Konventionelle und Traditionelle immergleich wiederholen. Musik zielt nicht nur auf Harmonie und Gemeinschaft, auf das: Seid umschlungen, fromme Millionen!, sondern eben auch auf Reflexion, Provokation, Wagnis, Anregung, ja sogar Verstörung. Das muss auch möglich sein, ich würde sogar sagen, das ist gegenwärtig dringend notwendig. Kirchenmusik ohne Provokation und neue Wege kommt mir vor wie Amtskirche ohne Theologie.